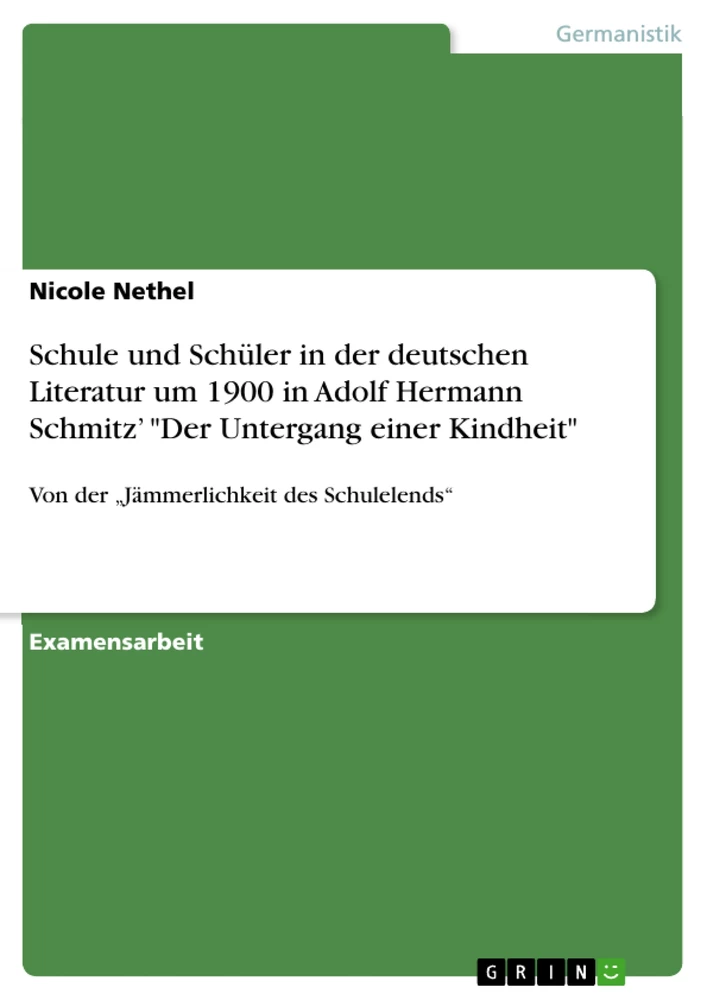Die These lautet, dass die Zeit- und Literaturepoche der beginnenden Moderne symptomatisch ist für das Verständnis schulspezifischer Texte um 1900. Dass sich dies nicht auf den ersten Blick erschließt, stellt den Anlass dar, sich innerhalb dieser Arbeit näher mit den schulkritischen Texten um 1900 auseinanderzusetzen:
An der Epochenwende zum 20. Jahrhundert entstanden zahlreiche schulspezifische Texte; trotzdem ist eine Wahrnehmung jener als Werkgruppe der frühen literarischen Moderne unüblich und lediglich die ‚Klassiker’ unter ihnen werden heute noch rezipiert (Hermann Hesse „Unterm Rad“ oder Rainer Maria Rilke „Die Turnstunde“).
In der Fachwissenschaft ist man aufgrund der inhaltlichen Kompatibilität dazu übergegangen, den neueren Zweig der Adoleszenzliteratur als Überordnungssystem auf jene schulkritischen Texte anzuwenden. Während die schulspezifischen Texte aber nicht nur eine andere Adressatengruppe ansprechen als es die Autoren von Adoleszenzliteratur gewöhnlich beabsichtigen, ist auch das spezifische Motiv der Schule durch die weit gefasste Adoleszenzproblematik nicht hinreichend abgegrenzt. Insofern soll ein erstes Ziel dieser Arbeit darin bestehen, aufzuzeigen, unter welchen Gesichtspunkten die schulspezifische Literatur der Jahrhundertwende als Gattung der Erwachsenenliteratur, genauer noch als Kategorie frühmoderner Literatur, Bedeutung erhalten kann. Dies soll anhand unterschiedlichster Werkbeispiele geschehen.
Die vernachlässigte Auseinandersetzung mit dem Textkorpus der Schulliteratur unter einer eher literaturhistorischen Perspektive macht schnell plausibel, warum bislang kein tatsächlicher Überblick der erschienenen Schuldichtungen um 1900 besteht. Das kann auch im Rahmen dieser Arbeit schwer verwirklicht werden.
Stattdessen soll als zweites großes Ziel dieser Arbeit ein Text exemplarisch in den Vordergrund der Untersuchung gerückt werden, um an jenem epochenspezifische Aspekte schulkritischer Werke der literarischen Moderne zu manifestieren. Es handelt sich dabei um den weitgehend unbekannten Roman "Der Untergang einer Kindheit" von Oscar Adolf Hermann Schmitz. Erzählt werden die Kinder- und Jugendjahre Lothar Danecks, die in ihrem Verlauf mehrheitlich von der „Jämmerlichkeit des Schulelends“ überschattet sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Sozial- und bildungsgeschichtliche Grundlegung
- 1.1 Kindheit und Jugend im kaiserzeitlichen Deutschland
- 1.1.1 Kindheiten
- 1.1.2 Jugendleben
- 1.1.2.1 Idealbild der Jugend und gelebte Jugend
- 1.1.2.2 Organisierte Jugend und Jugendbewegung
- 1.2 Das deutsche Schulwesen im Kaiserreich
- 1.2.1 Dichotomie des Schulwesens
- 1.2.1.1 Höheres Schulwesen
- 1.2.1.2 Niederes Schulwesen
- 1.2.2 ‚Untertanenerziehung‘
- 1.3 Schule in der Krise und Reformpädagogik
- 1.3.1 Bildungs- und Gesellschaftskrise
- 1.3.2 Populäre reformpädagogische Ansätze
- 2. Schule und Schüler als Motive der Literatur um 1900
- 2.1 Versuch einer gattungsmäßigen Bestimmung
- 2.1.1 Das Schul- und Schülermotiv als Adoleszenzthematik der Kinder- und Jugendliteratur
- 2.1.1.1 Wurzeln des klassischen beziehungsweise traditionellen Adoleszenzromans
- 2.1.1.2 Der klassische beziehungsweise traditionelle Adoleszenzroman
- 2.1.2 Das Schul- und Schülermotiv als Stoffgruppe der Allgemeinliteratur und Zeugnis der literarischen Moderne
- 2.2 Themen moderner Schul- und Schülergeschichten um 1900
- 2.2.1 Der Schüler im Angesicht des Feindbildes Schule
- 2.2.2 Der Schüler im Angesicht seines Seelenlebens
- 2.2.3 Der Schüler im Angesicht seines sozialen Umfeldes
- 2.2.4 Der Schüler im Angesicht der Lebenswirklichkeit
- 2.3 Zwischenbilanz
- 3. Oscar A. H. Schmitz' Der Untergang einer Kindheit
- 3.1 Oscar Adolf Hermann Schmitz – Ein Schriftsteller des Fin de siècle
- 3.2 Der Untergang einer Kindheit - Literarisierte Autobiographie
- 3.2.1 Inhalt
- 3.2.2 Entstehungs- und Wirkungsgeschichte
- 3.3 Der Untergang einer Kindheit – Ein Schülerroman
- 3.3.1 Vorbemerkung
- 3.3.2 Entwicklungsstationen des Protagonisten
- 3.3.2.1 Früheste Kinderzeit im Geburtshaus – Vorprägung eines inneren Zwiespalts
- 3.3.2.2 Kinderjahre in der Villa Gabriel – Bindung an Familie und Garten
- 3.3.2.3 Ende der Kindheit und Beginn der Schülerzeit - Ahnungen von der Schule als „böse Macht“ und Vorboten einer sexuellen Reife
- 3.3.2.4 Neue Heimat, neue Schule – Das ganze Ausmaß der Schulmisere
- 3.3.2.5 Erfahrungen der Pubertät – Alte Zerrissenheit und neue Gefühlsdimensionen
- 3.3.2.6 Künstlerische Reifung - Schule als „Kerker“ des Geistes
- 3.3.2.7 Die letzten Jahre als Schüler – Akzeptieren der Schule als notwendiges Übel
- 3.3.3 Bilanz zu Oscar A. H. Schmitz' Schülerroman
- Die Situation von Schule und Schülern als zentrales Thema in der Literatur um 1900
- Die Kritik an der autoritären und unzeitgemäßen Schulstruktur des Kaiserreichs
- Die Auswirkungen der Schule auf die psychische und soziale Entwicklung des Schülers
- Die Bedeutung der Reformpädagogik in der Auseinandersetzung mit den Problemen des Schulwesens
- Die literarische Bearbeitung des Schülermotivs als Ausdruck gesellschaftlicher und individueller Krisen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Darstellung von Schule und Schülern in der deutschen Literatur um 1900 am Beispiel von Oscar Adolf Hermann Schmitz' Roman „Der Untergang einer Kindheit“. Ziel ist es, die literarischen Motive und Kritikpunkte aufzuzeigen, die sich in diesem Kontext entwickelten, sowie die Rolle der Schule in der gesellschaftlichen und bildungsgeschichtlichen Entwicklung der damaligen Zeit zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Entstehung eines neuen literarischen Diskurses über Schule und Schüler im Kaiserreich. Kapitel 1 bietet einen soziohistorischen Kontext, der die gesellschaftlichen und bildungspolitischen Rahmenbedingungen für die Darstellung von Schule und Schülern in der Literatur um 1900 verdeutlicht. Kapitel 2 analysiert die vielfältigen Motivbereiche und Themenfelder, die in den literarischen Werken dieser Zeit behandelt werden, und untersucht die Gattungszugehörigkeit der Schülerromane. Kapitel 3 beschäftigt sich mit Oscar A. H. Schmitz' Roman „Der Untergang einer Kindheit“ als exemplarischem Beispiel für die literarische Auseinandersetzung mit der Schule und ihren Auswirkungen auf den Schüler.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter sind: Schule, Schüler, Kaiserreich, Literatur, Fin de siècle, Reformpädagogik, Adoleszenz, Schülerroman, ‚Untergang einer Kindheit‘, Oscar A. H. Schmitz, Sozialgeschichte, Bildungsgeschichte, Kritik, Autobiographie.
Was thematisiert die Schulliteratur um 1900?
Sie kritisiert das autoritäre Schulwesen des Kaiserreichs, die "Untertanenerziehung" und das Leiden der Schüler unter Leistungsdruck und mangelndem Verständnis für ihr Seelenleben.
Worum geht es in O.A.H. Schmitz' "Der Untergang einer Kindheit"?
Der Roman beschreibt die Kinder- und Jugendjahre von Lothar Daneck, dessen Leben durch das "Schulelend" und den inneren Zwiespalt zwischen kindlicher Freiheit und schulischem Kerker überschattet wird.
Was ist der "Adoleszenzroman"?
Ein literarisches Genre, das die Krisen und Entwicklungen der Pubertät thematisiert, wobei die Schule oft als feindlicher Raum dargestellt wird.
Warum ist die Reformpädagogik um 1900 wichtig?
Die Reformpädagogik entstand als Reaktion auf die Bildungs- und Gesellschaftskrise, um kindgerechtere Lernformen und eine Abkehr von der reinen Disziplinierung zu fordern.
Welche bekannten Autoren schrieben über das Schülerschicksal?
Neben Schmitz sind Hermann Hesse ("Unterm Rad") und Rainer Maria Rilke ("Die Turnstunde") prominente Vertreter dieser literarischen Strömung.