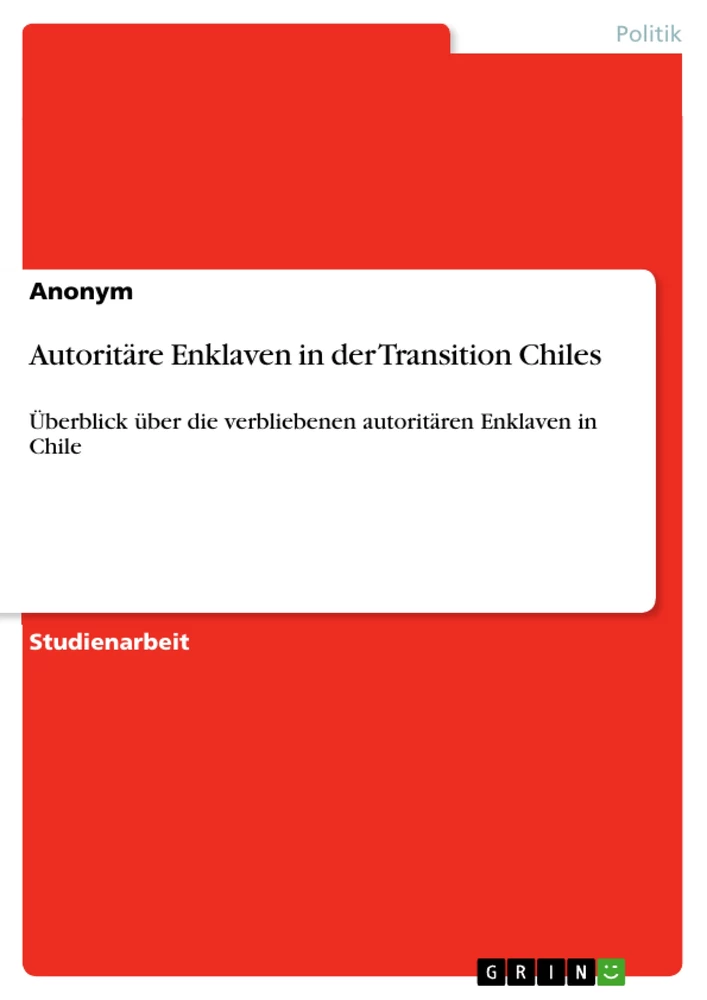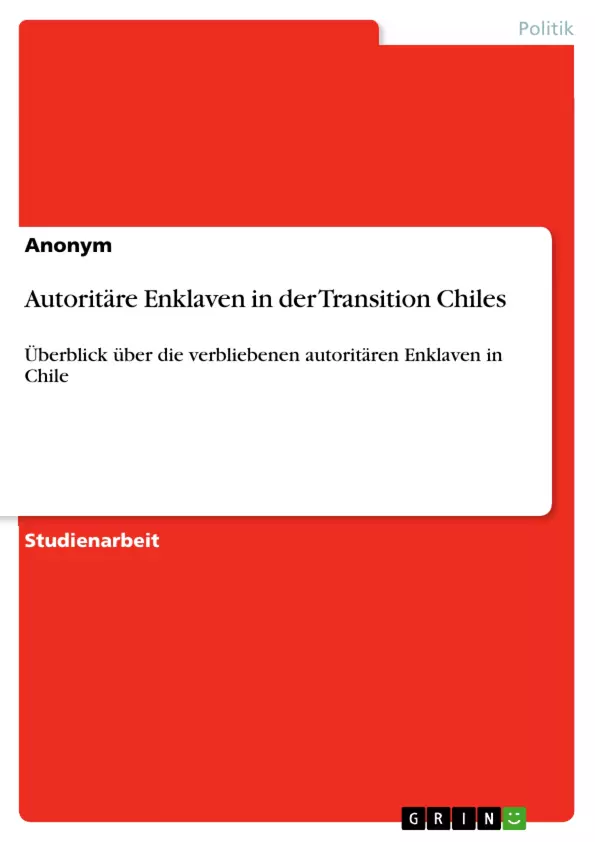In dieser Arbeit werden die autoritären Enklaven im postdiktatorischen Chile ermittelt und im größeren Kontext der chilenischen Transition dargestellt. Dabei wird die Frage im Vordergrund stehen, welche Rolle diese Überbleibsel aus den Zeiten der Pinochet-Diktatur während Chiles Übergang zur Demokratie spielten und inwiefern es gelungen ist, sie im Rahmen dessen komplett abzuschaffen. Um dies wirklich qualifiziert beantworten zu können, wird dafür erst die politische Struktur jener Überbleibsel ausgemacht, um diese dann im Einzelnen identifizieren zu können. Zunächst muss dafür der Begriff der autoritären Enklave untersucht werden. Da es noch keine einheitliche wissenschaftliche Definition für ihn gibt, muss anhand des bisher vorhandenen Materials ein eigener Begriff erarbeitet werden. Danach wird ein kurzer Überblick über die Transition in Chile gegeben, vom Ende der Herrschaft des Diktators Pinochet bis in die heutige Zeit. Nötig ist dies, um anschließend einzelne Enklaven und deren Bewältigung herauszuarbeiten und so ein qualifiziertes Fazit mit einschließender Beantwortung der Frage liefern zu können. Dabei wird vor allem der Zeitraum der letzten Jahre auf Neuigkeiten überprüft, die im Kontext der Transition neue Erkenntnisse bringen und diese dokumentieren, da so die aktuelle Entwicklung miteinbezogen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das theoretische Konzept der autoritären Enklaven
- Die Transition Chiles
- Autoritäre Enklaven in Chile
- Militär
- COSENA
- Kupfergesetz
- Amnestiegesetz
- Verfassung
- Bildungssystem
- Wahlsystem
- Militär
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den autoritären Enklaven im postdiktatorischen Chile und untersucht deren Rolle während der chilenischen Transition zur Demokratie. Die Arbeit analysiert, inwieweit diese Überbleibsel aus der Pinochet-Diktatur in den Prozess der Demokratisierung eingegriffen haben und ob es gelungen ist, sie vollständig abzuschaffen. Hierfür wird zunächst das Konzept der autoritären Enklaven erörtert und eine eigene Definition erarbeitet. Anschließend erfolgt ein Überblick über die chilenische Transition, bevor die einzelnen Enklaven und deren Bewältigung im Detail dargestellt werden. Die Arbeit bezieht dabei aktuelle Nachrichten sowie Fachliteratur zur politischen Entwicklung des postautoritären Chiles ein.
- Begriffserklärung und Entwicklung des Konzepts „autoritäre Enklaven“
- Analyse der chilenischen Transition zur Demokratie
- Identifizierung und Analyse von autoritären Enklaven im chilenischen Staatswesen
- Bewertung der Auswirkungen der Enklaven auf die politische und soziale Entwicklung Chiles
- Beurteilung des Erfolgs der Transition hinsichtlich der Abschaffung der autoritären Enklaven
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung der autoritären Enklaven für die chilenische Transition. Sie legt die Forschungsfrage dar und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2 widmet sich der Definition des Begriffs „autoritäre Enklaven“ und analysiert seine Entwicklung in der politikwissenschaftlichen Literatur. Es beleuchtet die Entstehung dieser Enklaven nach autoritären Regimen und ihre Merkmale.
- Kapitel 3 gibt einen Überblick über die chilenische Transition von der Diktatur zur Demokratie. Es beschreibt die historische Entwicklung Chiles, die Rolle der USA im kalten Krieg und die Auswirkungen des Militärputsches von 1973.
- Kapitel 4 untersucht die verschiedenen autoritären Enklaven in Chile, die nach der Pinochet-Diktatur bestehen blieben. Es analysiert deren Auswirkungen auf die Politik, die Gesellschaft und das Staatswesen Chiles.
Schlüsselwörter
Autoritäre Enklaven, chilenische Transition, Postdiktatur, Demokratie, Militär, Verfassung, Bildungssystem, Wahlsystem, Pinochet, Concertación, Garretón, Menschenrechtsverletzungen, neoliberales System, politische Struktur, politischer Einfluss, gesellschaftliche Entwicklung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Autoritäre Enklaven in der Transition Chiles, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/900350