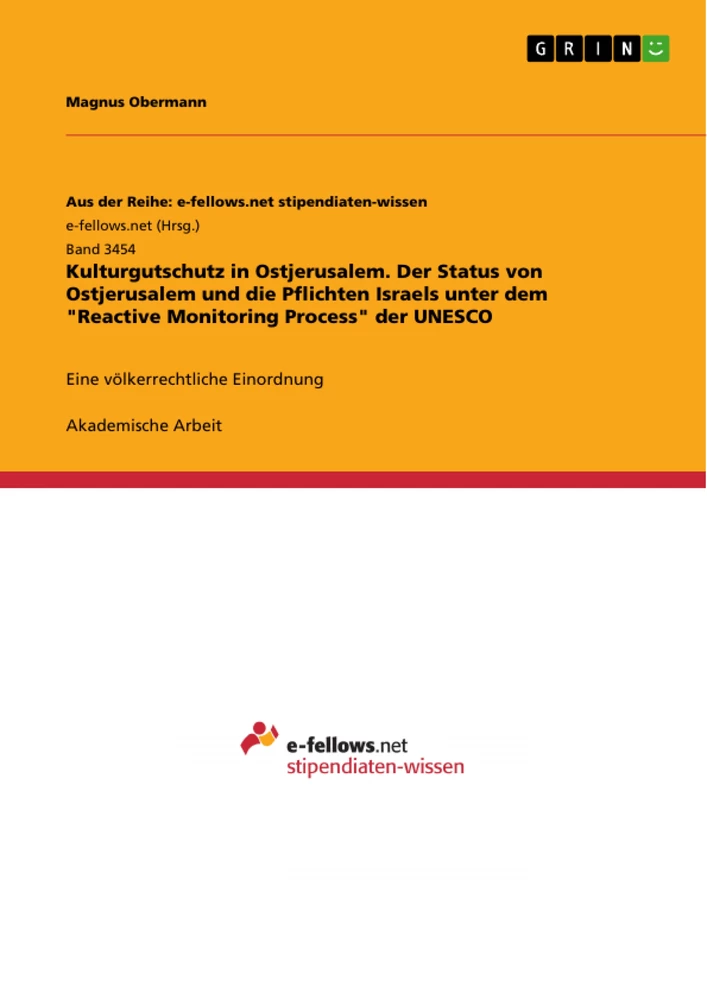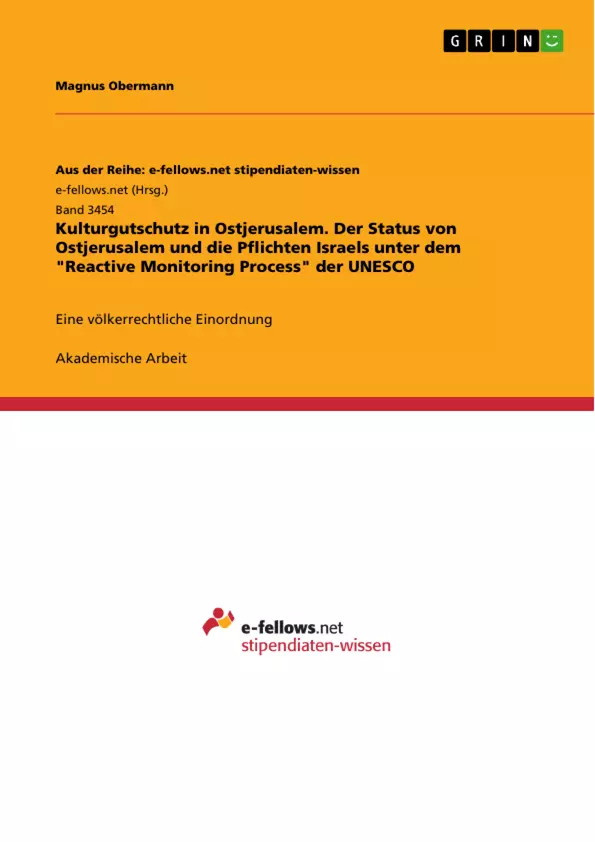In der Arbeit geht es um die völkerrechtliche Einordnung des Status von Ostjerusalem und die Pflichten Israels unter dem "Reactive Monitoring Process" der UNESCO. Die Arbeit möchte bestehende Probleme beleuchten und die rechtlichen Grundlagen und Möglichkeiten des Kulturgutschutzes aufzeigen. Dabei wird die These untersucht, dass der Kulturgüterschutz in Jerusalem als friedenssichernder Anker der Region möglich ist, es dafür aber neuer Herangehensweisen bedarf. Durch eine Analyse der Tätigkeiten des Welterbekomitees in der Jerusalemer Altstadt soll zudem ein Beitrag zur Versachlichung der Debatte geleistet werden.
So steht am Anfang eine Betrachtung des anwendbaren Rechts für die vorliegende Situation in Ostjerusalem. Alsdann wird zwischen Ostjerusalem und der Altstadt zu differenzieren sein, die eine Welterbestätte ist. Hier stellt sich insbesondere die bislang kaum beantwortete Frage der Rechtsverbindlichkeit der UNESCO-Beschlüsse zur Jerusalemer Altstadt. Ausgehend davon werden die Entscheidungen des Welterbekomitees unter dem Reactive Monitoring Process einer Bestandsaufnahme unterzogen und die in ihnen formulierten völkerrechtlichen Verpflichtungen identifiziert. Zum Abschluss soll all dies in Zusammenhang gebracht werden mit den drängenden Anliegen des Kulturgutschutzes in Ostjerusalem insgesamt, wobei auf dessen gesellschafts- und sicherheitspolitische Relevanz im Zuge der jüngsten völkerrechtlichen Tendenzen im Kulturgüterschutz abzustellen sein wird.
Die UNESCO hat in der Vergangenheit viele Versuche unternommen, ihrer Verantwortung zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens in Jerusalem gerecht zu werden. Aufgrund umstrittener Resolutionen und vermeintlicher Parteilichkeit wird sie jedoch von einigen Stellen für die seit langem schwierige Lage mitverantwortlich gemacht. Im Spannungsfeld geschichtlicher, religiöser und politischer Ansprüche wirft dies für UNESCO und Weltgemeinschaft neue Fragen bezüglich des Kulturgüterschutzes in besetzten Gebieten auf. Dessen Handhabung berührt im konkreten Fall das Fundament des Friedens in der gesamten Region.
Inhaltsverzeichnis
- I) Einleitung
- II) Rechtsgrundlagen für den Kulturgutschutz in Ostjerusalem
- 1) Haager Landkriegsordnung
- 2) Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten
- 3) 1. Protokoll zur Haager Konvention
- 4) Zwischenergebnis
- III) Die Altstadt von Jerusalem als Welterbestätte
- 1) Schutzbestimmungen der WEK
- 2) Der Reactive Monitoring Process in der Altstadt Jerusalems
- 3) Verbindlichkeit der Entscheidungen des WHC zu Jerusalem
- 4) Zwischenergebnis
- IV) Die Pflichten Israels unter dem RMP
- 1) Kooperationsgebot
- 2) Zugang von Arbeitern, Experten und Material
- 3) Austausch und Weitergabe von Informationen
- 4) Bewahrung der Authentizität und Integrität
- 5) Zwischenergebnis
- V) Probleme der Umsetzung des RMP in der Altstadt von Jerusalem
- 1) Politisierung des Kulturgüterschutzes
- 2) Mangelnde Kontroll- und Durchsetzungsmechanismen zur Wahrung des status-quo
- 3) Zwischenergebnis
- VI) Kritische Würdigung des RMP: Kulturerbe in Ostjerusalem
- VII) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die völkerrechtliche Einordnung des Status von Ostjerusalem und die Pflichten Israels unter dem „Reactive Monitoring Process“ der UNESCO. Sie untersucht die rechtlichen Grundlagen für den Kulturgutschutz in Ostjerusalem, insbesondere die Haager Konventionen und die Welterbekonvention. Im Fokus steht die Altstadt von Jerusalem als Welterbestätte und die Verpflichtungen Israels im Rahmen des Reactive Monitoring Process (RMP). Die Arbeit analysiert die konkreten Pflichten Israels unter dem RMP, beleuchtet die Probleme der Umsetzung und diskutiert die kritische Würdigung des RMP im Hinblick auf den Schutz des Kulturerbes in Ostjerusalem.
- Völkerrechtliche Einordnung des Status von Ostjerusalem
- Pflichten Israels unter dem "Reactive Monitoring Process" der UNESCO
- Rechtsgrundlagen für den Kulturgutschutz in Ostjerusalem
- Die Altstadt von Jerusalem als Welterbestätte
- Probleme der Umsetzung des RMP in der Altstadt von Jerusalem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die völkerrechtlichen und historischen Rahmenbedingungen für den Kulturgutschutz in Ostjerusalem dar. Das zweite Kapitel analysiert die rechtlichen Grundlagen für den Kulturgutschutz in Ostjerusalem, insbesondere die Haager Konventionen und die Welterbekonvention. Im dritten Kapitel wird die Altstadt von Jerusalem als Welterbestätte behandelt, wobei die Schutzbestimmungen der Welterbekonvention und die Bedeutung des Reactive Monitoring Process (RMP) hervorgehoben werden. Das vierte Kapitel widmet sich den Pflichten Israels unter dem RMP, einschließlich des Kooperationsgebots, des Zugangs für Experten und Materialien, des Informationsaustauschs und der Bewahrung der Authentizität und Integrität des Kulturerbes. Im fünften Kapitel werden die Probleme der Umsetzung des RMP in der Altstadt von Jerusalem untersucht, insbesondere die Politisierung des Kulturgüterschutzes und die mangelnden Kontroll- und Durchsetzungsmechanismen. Das sechste Kapitel bietet eine kritische Würdigung des RMP und seiner Auswirkungen auf den Schutz des Kulturerbes in Ostjerusalem.
Schlüsselwörter
Ostjerusalem, Kulturgutschutz, Völkerrecht, Haager Konventionen, Welterbekonvention, Altstadt von Jerusalem, Welterbestätte, Reactive Monitoring Process (RMP), UNESCO, Pflichten Israels, Probleme der Umsetzung, Politisierung, Kontroll- und Durchsetzungsmechanismen, Kulturerbe.
- Quote paper
- Magnus Obermann (Author), 2018, Kulturgutschutz in Ostjerusalem. Der Status von Ostjerusalem und die Pflichten Israels unter dem "Reactive Monitoring Process" der UNESCO, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/899566