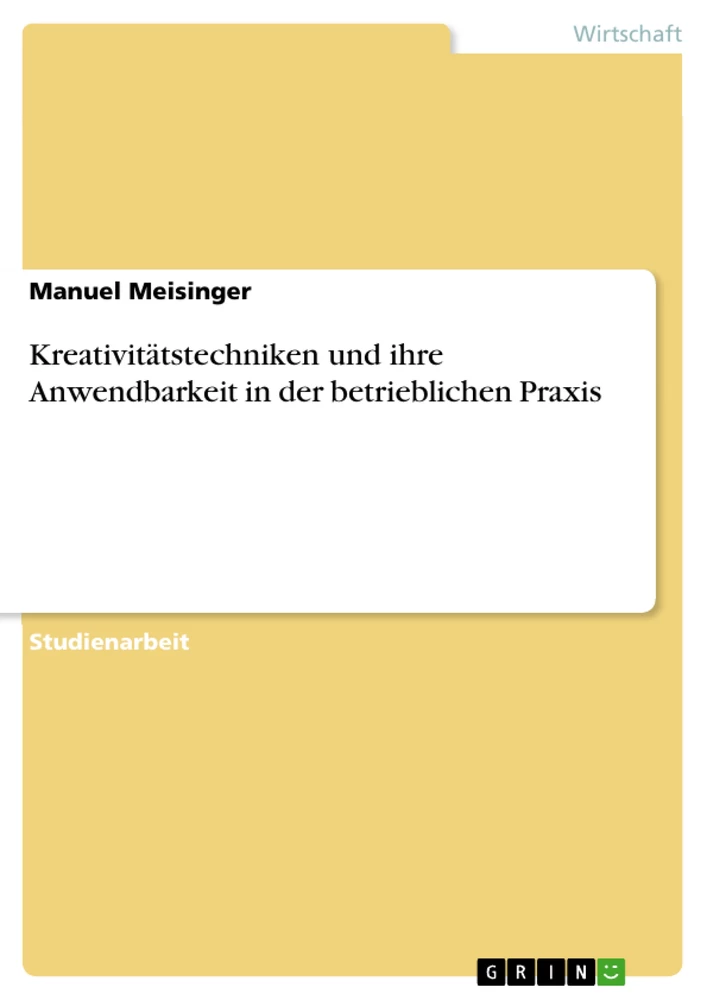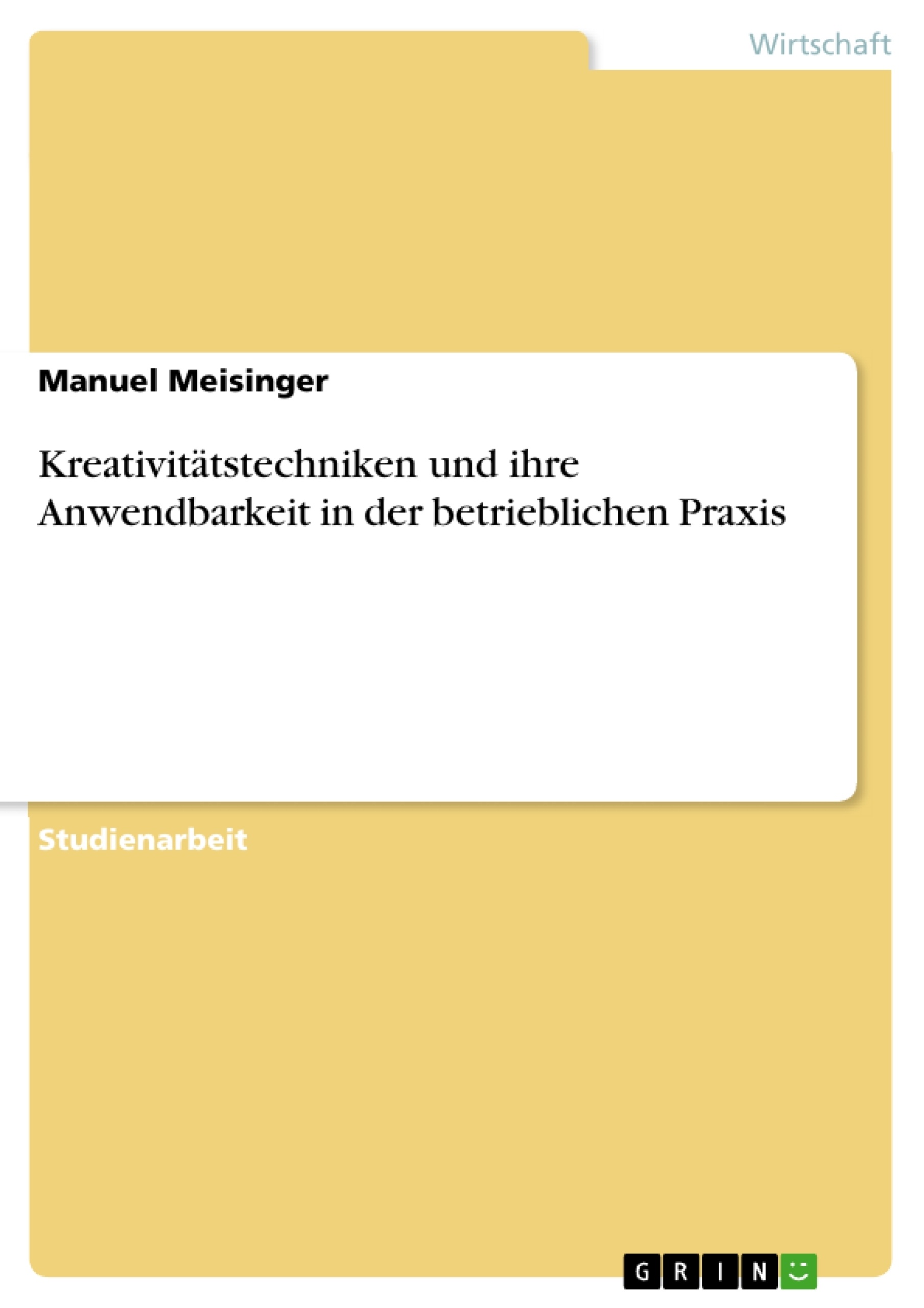In jedem Betrieb steckt Kreativität für neue Geschäftsprozesse, Produkte oder Dienstleistungen. Nur wer dies erkennt und dieses Potenzial zu nutzen weiß, wird sich auf dem Markt der Zukunft behaupten können, denn kreative Ideen sind nicht nur zur Entwicklung von Neuem oder zur Verbesserung von Bestehendem geeignet, sondern können auch dazu verwendet werden, sich von der Konkurrenz abzuheben und an die sich verändernden Umweltbedingungen anzupassen. In diesem Sinne: entfalten und nutzen sie ihre Kreativität!
Ziel dieser Arbeit ist es, ausgewählte Kreativitätstechniken vorzustellen und deren Anwendbarkeit in der betrieblichen Praxis zu untersuchen und zu bewerten. Die Basis für eine wissenschaftliche Diskussion bilden dabei theoretische Grundlagen zur Kreativität, wie die Erläuterung des Begriffs und ihrer Einflussfaktoren. Anschließend soll ein Überblick über ausgewählte Kreativitätstechniken gewährt werden, welche in weiterer Folge auf ihre Anwendbarkeit untersucht und bewertet werden.
Aus diesen Bewertungen lässt sich abschließend feststellen, in wie weit sich die ausgewählten Kreativitätstechniken für die betriebliche Praxis eignen und welche Vor- und Nachteile sich daraus ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ziele und Aufbau der Arbeit
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Der Begriff der Kreativität
- 2.2 Einflussfaktoren der Kreativität
- 3 Methoden der Leistungsbeurteilung
- 3.1 Intuitive Methoden
- 3.1.1 Assoziations-Technik
- 3.1.2 Mapping-Technik
- 3.1.3 Analogie-Technik
- 3.2 Systematisch-analytische Methoden
- 3.1 Intuitive Methoden
- 4 Anwendbarkeit in der Praxis
- 4.1 Betriebliche Situation
- 4.2 Analyse der intuitiven Methoden
- 4.2.1 Assoziations-Technik
- 4.2.2 Mapping-Technik
- 4.2.3 Analogie-Technik
- 4.3 Analyse der systematisch-analytischen Methoden
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Kreativität und deren Anwendung in der betrieblichen Praxis. Ziel der Arbeit ist es, verschiedene Kreativitätstechniken zu analysieren und deren Anwendbarkeit in konkreten betrieblichen Situationen zu bewerten.
- Definition und Dimensionen von Kreativität
- Einflussfaktoren auf Kreativität
- Verschiedene Kreativitätstechniken, insbesondere intuitive und systematisch-analytische Methoden
- Analyse der Anwendbarkeit von Kreativitätstechniken in der betrieblichen Praxis
- Bewertung der Wirksamkeit von Kreativitätstechniken in Bezug auf die Lösung betrieblicher Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel legt den Fokus auf die Ziele und den Aufbau der Arbeit, während das zweite Kapitel theoretische Grundlagen der Kreativität beleuchtet, einschließlich Definitionen und Einflussfaktoren. Kapitel drei präsentiert verschiedene Kreativitätstechniken, unterteilt in intuitive und systematisch-analytische Methoden. Kapitel vier widmet sich der Analyse der Anwendbarkeit dieser Techniken in der betrieblichen Praxis, indem es sowohl die Vorteile als auch die Herausforderungen ihrer Anwendung in konkreten Situationen untersucht.
Schlüsselwörter
Kreativität, Kreativitätstechniken, Betriebliche Praxis, Intuitive Methoden, Systematisch-analytische Methoden, Problem lösen, Ideenfindung, Innovationsmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Kreativität für Unternehmen heute so wichtig?
Kreative Ideen ermöglichen die Entwicklung neuer Produkte, die Verbesserung von Prozessen und die Anpassung an sich ständig verändernde Marktbedingungen.
Welche Arten von Kreativitätstechniken werden unterschieden?
Es wird zwischen intuitiven Methoden (wie Assoziation, Mapping und Analogie) und systematisch-analytischen Methoden unterschieden.
Was sind Beispiele für intuitive Techniken?
Dazu zählen die Assoziations-Technik, Mapping-Techniken (wie Mindmapping) und die Analogie-Technik zur Lösungsfindung durch Vergleiche.
Wie wird die Anwendbarkeit dieser Techniken in der Praxis bewertet?
Die Arbeit untersucht anhand betrieblicher Situationen die Vor- und Nachteile sowie die Eignung der jeweiligen Methoden für den Arbeitsalltag.
Können systematisch-analytische Methoden kreative Prozesse behindern?
Die Arbeit diskutiert die Wirksamkeit dieser Methoden und wägt ab, ob sie eher Struktur geben oder die freie Entfaltung von Ideen einschränken.
- Quote paper
- Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Manuel Meisinger (Author), 2010, Kreativitätstechniken und ihre Anwendbarkeit in der betrieblichen Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/899450