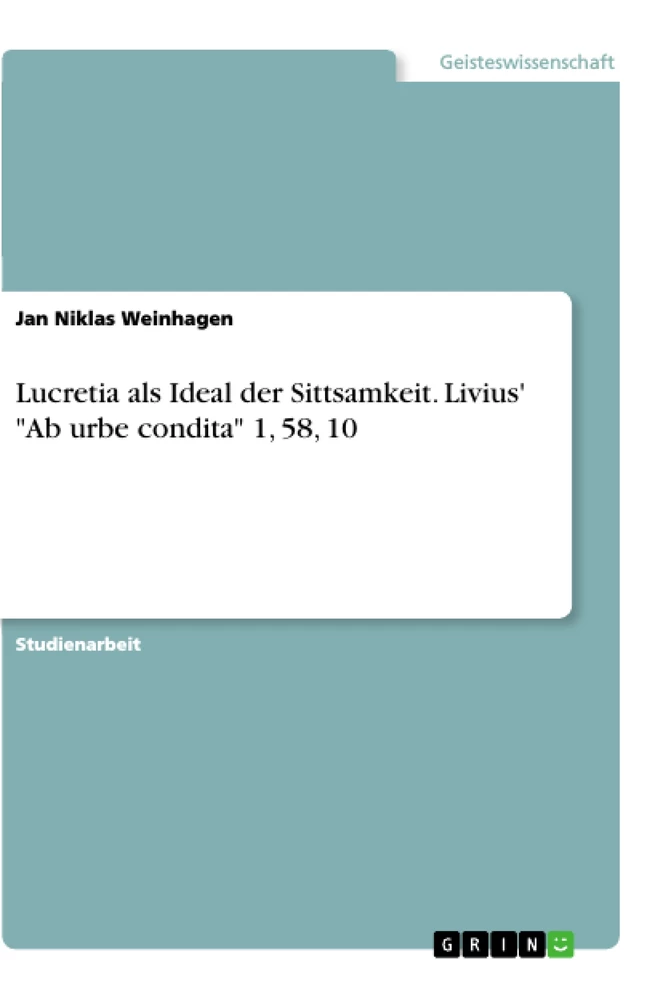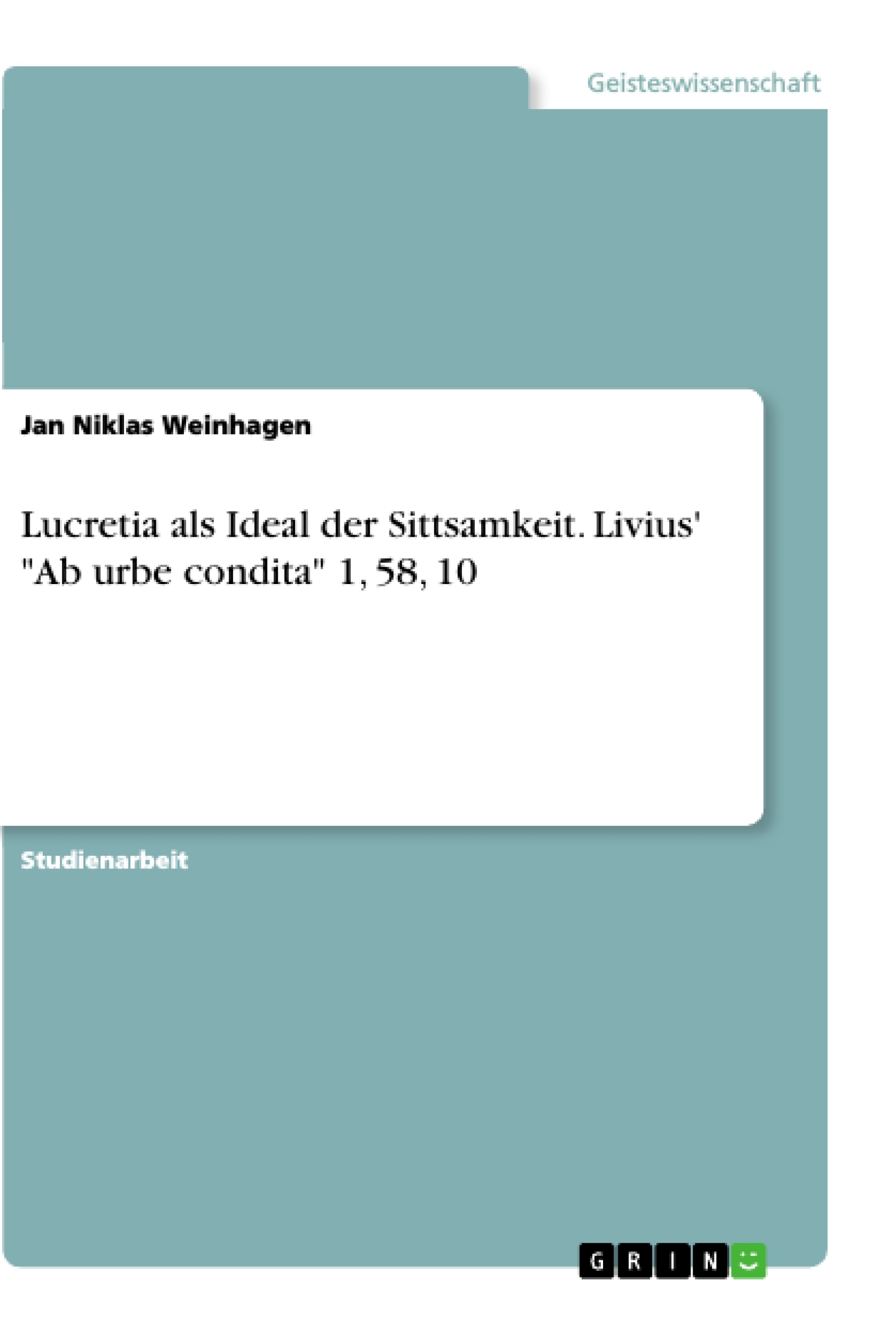Diese Arbeit untersucht den antiken Wertekanone der römischen Ehefrau anhand Livius' "Ab urbe condita". Der Fokus liegt auf dem Textabschnitt Liv. 1, 58, 10 Dieser demonstriert, welchen – aus heutiger Sicht und für unseren westlichen Kulturkreis – extremen Stellenwert die pudicitia für eine Frau haben sollte und welche Konsequenzen mit dem Verlust dieser einhergingen.
"nec ulla deinde impudica Lucretiae exemplo vivet" Mit diesem Satz lässt Livius das Leben der Lucretia, einer der berühmtesten Frauen der römischen Frühgeschichte, enden. Nachdem der Königssohn Tarquinius Superbus sie vergewaltigt hatte, ließ sie in Gegenwart ihres Gatten, ihres Vaters und dessen Begleiter Rache an dem Täter schwören, bevor sie sich selbst ob ihrer verletzten Schamhaftigkeit ein Messer in die Brust rammte.
Livius stellt somit Lucretia, wie später Verginia, als Opfer ihrer verletzten oder bedrohten Sittsamkeit (pudicitia) dar. Das ethische Ideal der pudicitia wurde als Kardinaltugend der Frau der virtus des Mannes gegenübergestellt und sie in einem eigenen Kult verehrt. Die Frauen spielen in dem Werk des Livius – lässt man die Darstellungen von den Vestalinnen außer Acht - eine nur untergeordnete Rolle. Sie treten meist in tragischen Einzelsequenzen als Opfer aggressiver männlicher Handlungen auf, wobei sie fast alle ein moralisches Verhaltensmuster beweisen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Fachwissenschaftlicher Teil
- 1. Analyse von Liv. 1,58,10
- a) Überlieferungsgeschichte
- b) Verortung der Textstelle innerhalb des Werkes
- c) Text und Übersetzung von Liv. ab urbe condita 1, 58, 10
- d) Sprachliche Analyse und Interpretation von Liv. ab urbe condita 1,58, 10
- III. Fazit: Lucretia als Ideal der Sittsamkeit
- IV. Fachdidaktischer Teil
- 1. Vorbemerkungen
- 2. Kompetenzbereiche
- a) Sprachkompetenz
- b) Textkompetenz
- c) Kulturkompetenz
- V. Fachdidaktisches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Livius' Darstellung Lucretias in Ab urbe condita 1, 58, 10, mit dem Ziel, sowohl fachwissenschaftlich als auch fachdidaktisch Aspekte der Textstelle zu beleuchten. Es wird untersucht, wie Lucretia als Ideal der Sittsamkeit (pudicitia) präsentiert wird und welche didaktischen Möglichkeiten sich daraus für den Lateinunterricht ergeben.
- Lucretias Rolle als exemplarische Figur der römischen Moral
- Die Bedeutung von pudicitia im antiken Rom und ihre Darstellung bei Livius
- Die Überlieferungsgeschichte und Interpretation von Livius' Text
- Didaktische Ansätze zur Vermittlung des antiken Wertekanons im Lateinunterricht
- Der Vergleich antiker und moderner Wertvorstellungen im Kontext von Frauenrollen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie Livius' Darstellung Lucretias als Opfer ihrer verletzten Sittsamkeit (pudicitia) vorstellt. Der Fokus liegt auf Lucretias Selbstmord als Konsequenz der Vergewaltigung durch Sextus Tarquinius und ihrer Bedeutung als ethisches Idealbild. Die Arbeit kündigt eine fachwissenschaftliche und fachdidaktische Analyse des Textabschnitts Liv. 1, 58, 10 an, mit dem Ziel, den antiken Wertekanon römischer Ehefrauen und die Bedeutung von pudicitia zu beleuchten sowie didaktische Implikationen für den Unterricht zu erörtern.
II. Fachwissenschaftlicher Teil: Dieser Teil widmet sich der detaillierten Analyse von Livius 1, 58, 10. Die Überlieferungsgeschichte des Werkes wird erörtert, die Textstelle innerhalb des Gesamtkontexts von Livius' Ab urbe condita verortet und der Text selbst übersetzt und sprachlich analysiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Interpretation von Lucretias Rolle als ehrbare domina, der Analyse ihrer pudicitia und den Motiven für ihren Suizid. Die Analyse zielt darauf ab, den inhaltlichen Kern des Textabschnitts herauszuarbeiten und den Stellenwert der pudicitia für römische Frauen zu verstehen.
IV. Fachdidaktischer Teil: Dieser Abschnitt befasst sich mit der didaktischen Umsetzung der fachwissenschaftlichen Ergebnisse. Es werden verschiedene Kompetenzbereiche des Lateinunterrichts (Sprach-, Text- und Kulturkompetenz) betrachtet und erläutert, wie der Textabschnitt zur Vermittlung des antiken Wertekanons und des Idealbilds der römischen Frau genutzt werden kann. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Reflexion der Werte und Verhaltensweisen Lucretias im Vergleich zu modernen Wertvorstellungen und Kulturen, um Empathie, Sensibilität und kritisches Bewusstsein zu fördern.
Schlüsselwörter
Livius, Ab urbe condita, Lucretia, pudicitia, Sittsamkeit, antiker Wertekanon, römische Frau, fachdidaktische Analyse, Lateinunterricht, Kompetenzbereiche, historische Kommunikation, moralisierende Geschichtsschreibung.
Livius' Darstellung Lucretias: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Livius' Darstellung Lucretias in Ab urbe condita 1, 58, 10. Der Fokus liegt sowohl auf der fachwissenschaftlichen Analyse der Textstelle als auch auf deren didaktischen Implikationen für den Lateinunterricht. Es wird untersucht, wie Lucretia als Ideal der Sittsamkeit (pudicitia) präsentiert wird und welche didaktischen Möglichkeiten sich daraus ergeben.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Lucretias Rolle als exemplarische Figur der römischen Moral, die Bedeutung von pudicitia im antiken Rom und ihre Darstellung bei Livius, die Überlieferungsgeschichte und Interpretation von Livius' Text, didaktische Ansätze zur Vermittlung des antiken Wertekanons im Lateinunterricht und der Vergleich antiker und moderner Wertvorstellungen im Kontext von Frauenrollen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen fachwissenschaftlichen und einen fachdidaktischen Teil. Der fachwissenschaftliche Teil analysiert Livius' Text (Liv. 1, 58, 10) detailliert, inklusive Überlieferungsgeschichte, Kontextualisierung, Übersetzung und sprachlicher Analyse. Der fachdidaktische Teil beschäftigt sich mit der didaktischen Umsetzung der Ergebnisse, betrachtet relevante Kompetenzbereiche des Lateinunterrichts und erörtert die Vermittlung des antiken Wertekanons im Unterricht. Die Arbeit enthält außerdem eine Einleitung, ein Fazit, eine Zusammenfassung der Kapitel und ein Schlüsselwortverzeichnis.
Was ist der Inhalt des fachwissenschaftlichen Teils?
Der fachwissenschaftliche Teil analysiert Livius 1, 58, 10 umfassend. Es wird die Überlieferungsgeschichte des Werkes erörtert, die Textstelle im Kontext von Livius' Ab urbe condita verortet, der Text übersetzt und sprachlich analysiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Interpretation von Lucretias Rolle als ehrbare domina, der Analyse ihrer pudicitia und den Motiven für ihren Suizid. Ziel ist es, den inhaltlichen Kern des Textabschnitts und den Stellenwert der pudicitia für römische Frauen zu verstehen.
Was wird im fachdidaktischen Teil behandelt?
Der fachdidaktische Teil befasst sich mit der didaktischen Umsetzung der fachwissenschaftlichen Ergebnisse. Es werden Kompetenzbereiche des Lateinunterrichts (Sprach-, Text- und Kulturkompetenz) betrachtet und erläutert, wie der Textabschnitt zur Vermittlung des antiken Wertekanons und des Idealbilds der römischen Frau genutzt werden kann. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich der Werte und Verhaltensweisen Lucretias mit modernen Wertvorstellungen, um Empathie, Sensibilität und kritisches Bewusstsein zu fördern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Livius, Ab urbe condita, Lucretia, pudicitia, Sittsamkeit, antiker Wertekanon, römische Frau, fachdidaktische Analyse, Lateinunterricht, Kompetenzbereiche, historische Kommunikation, moralisierende Geschichtsschreibung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Livius' Darstellung Lucretias sowohl fachwissenschaftlich als auch fachdidaktisch zu beleuchten. Es soll untersucht werden, wie Lucretia als Ideal der Sittsamkeit präsentiert wird und welche didaktischen Möglichkeiten sich daraus für den Lateinunterricht ergeben.
- Quote paper
- Jan Niklas Weinhagen (Author), 2017, Lucretia als Ideal der Sittsamkeit. Livius' "Ab urbe condita" 1, 58, 10, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/899391