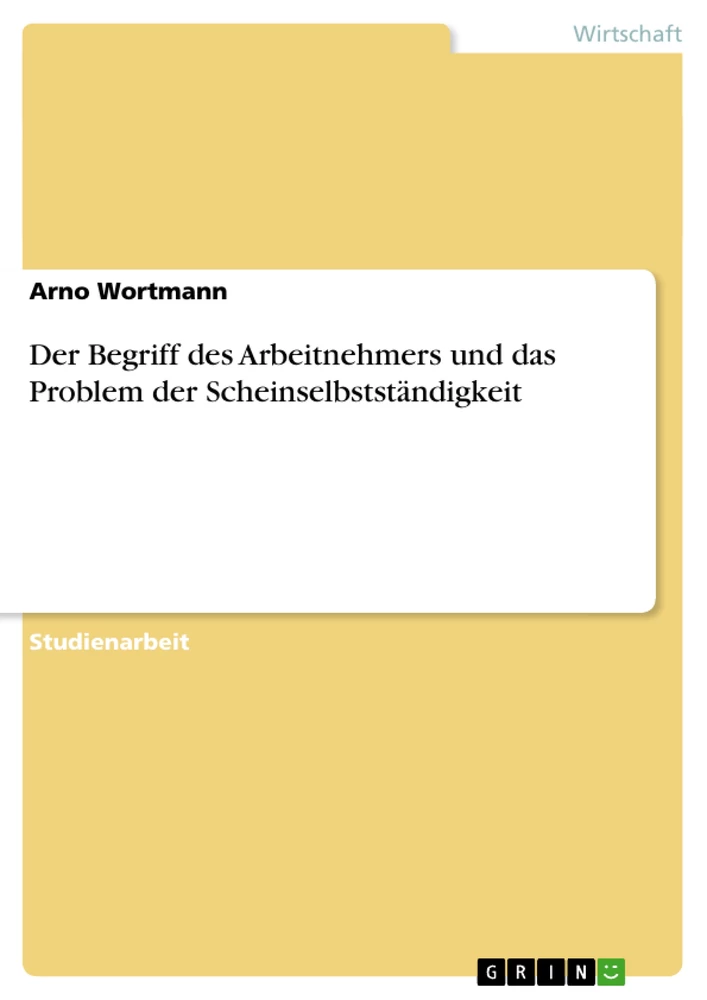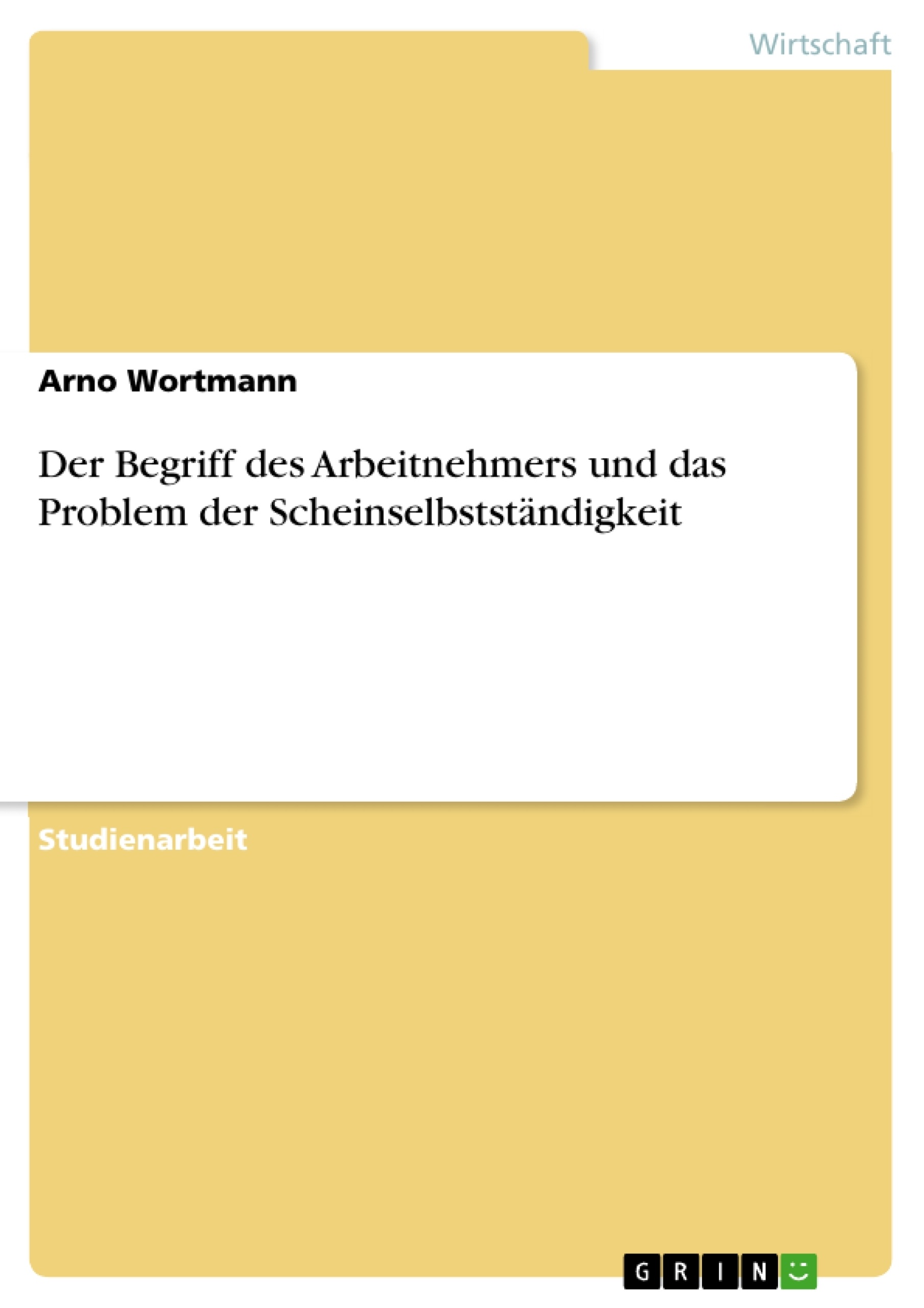Es gibt keinen allgemein anerkannten Begriff des Arbeitnehmers. Nach Hueck ist Arbeitnehmer, wer auf Grund privatrechtlichen Vertrags oder eines ihm gleichgestellten Rechtsverhältnisses im Dienst eines anderen zur Arbeit verpflichtet ist. Nikisch definiert Arbeitnehmer als eine Person, die im Dienst eines anderen beschäftigt wird, die in einem Betrieb eingegliedert ist. Einigkeit besteht darüber, dass der Arbeitnehmer abhängige, fremdbestimmte Arbeit, hingegen der Selbständige eine selbstbestimmte Tätigkeit leistet.
In der Rechtsprechung wird vor allem von der Definition Huecks ausgegangen. Nach ihr sind für den Begriff des Arbeitnehmers drei Voraussetzungen zu erfüllen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Begriff des Arbeitnehmers
- 1.1 § 5 ArbGG
- 1.2 § 5 BetrVG
- 2. Arbeitnehmer
- 2.1 Allgemeines
- 2.2 Voraussetzungen des Arbeitnehmerbegriffs
- 3. Arbeitnehmerähnliche Personen
- 3.1 Begriff
- 3.2 Rechtsfolgen
- 4. Heimarbeiter, Hausgewerbetreibende und Zwischenmeister
- 4.1 Begriff
- 4.2 Rechtsbeziehungen der Heimarbeiter
- 5. Freie Mitarbeiter
- 5.1 Begriff
- 5.2 Freie Mitarbeiter als Arbeitnehmer
- 5.3 Freie Mitarbeiter als arbeitnehmerähnliche Personen
- 6. Handelsvertreter
- 6.1 Begriff
- 6.2 Anwendung des Arbeitsrechts
- 7. Berufliche Gliederung der Arbeitnehmer
- 8. Arbeiter und Angestellte
- 8.1 Allgemeines
- 8.2 Unterscheidung von Arbeitern und Angestellten
- 8.3 Einzelfälle
- 9. Leitende Angestellte
- 10. Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes
- 11. Sonstige Arbeitnehmergruppen
- 11.1 Allgemeines
- 11.2 Auszubildender
- 11.3 Volontär
- 11.4 Praktikant
- 11.5 Werkstudent, Schüler
- 12. Definition und Verbreitung von Scheinselbstständigkeit
- 13. Scheinselbstständigkeit in der Rechtssprechung
- 13.1 Das Gesetz gegen Scheinselbstständigkeit
- 13.2 Korrektur durch das Gesetz zur „Förderung der Selbständigkeit“
- 13.3 Rechtsfolgen bei fehlerhafter Qualifizierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff des Arbeitnehmers im deutschen Recht und das damit verbundene Problem der Scheinselbstständigkeit. Ziel ist es, die verschiedenen Kategorien von Arbeitnehmern zu beleuchten und die Abgrenzung zu selbstständigen Tätigkeiten zu verdeutlichen.
- Definition und Abgrenzung des Arbeitnehmerbegriffs
- Voraussetzungen für das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses
- Unterscheidung zwischen Arbeitnehmern und arbeitnehmerähnlichen Personen
- Analyse verschiedener Berufsgruppen und ihrer rechtlichen Einordnung
- Das Phänomen der Scheinselbstständigkeit und seine rechtlichen Konsequenzen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Begriff des Arbeitnehmers: Dieses Kapitel legt den Grundstein für die gesamte Arbeit, indem es verschiedene juristische Definitionen des Arbeitnehmerbegriffs aus § 5 ArbGG und § 5 BetrVG vorstellt und die Schwierigkeiten bei der einheitlichen Begriffsbestimmung aufzeigt. Es werden unterschiedliche Ansätze von Juristen wie Hueck und Nikisch beleuchtet und die Herausforderungen bei der Abgrenzung zu anderen Beschäftigungsformen skizziert.
2. Arbeitnehmer: Dieser Abschnitt vertieft die allgemeine Definition des Arbeitnehmers. Er analysiert detailliert die drei zentralen Voraussetzungen für ein Arbeitsverhältnis: die Verpflichtung zur Arbeitsleistung, das Bestehen eines privatrechtlichen Vertrags oder gleichgestellten Verhältnisses und die Leistung der Arbeit im Dienst eines anderen. Dabei werden verschiedene Beispiele angeführt, um die Abgrenzung zu Personen zu verdeutlichen, die keine Arbeitnehmer sind, wie z.B. Teilnehmer an einem Freiwilligen Sozialen Jahr oder Beamte. Das Kapitel hebt die Bedeutung der Abhängigkeit und Fremdbestimmung im Arbeitsverhältnis hervor und differenziert es von selbstständigen Tätigkeiten.
3. Arbeitnehmerähnliche Personen: Hier werden Personen beschrieben, die aufgrund fehlender persönlicher Abhängigkeit keine Arbeitnehmer sind, aber aufgrund wirtschaftlicher Abhängigkeit keine Unternehmer. Das Kapitel erläutert den Begriff und die rechtlichen Konsequenzen dieser ambivalenten Position. Der Fokus liegt auf der persönlichen Tätigkeit ohne fremde Hilfe, der fehlenden Einbindung in fremde Betriebsorganisationen und der Leistungserbringung gegenüber bestimmten Unternehmen.
4. Heimarbeiter, Hausgewerbetreibende und Zwischenmeister: Dieses Kapitel befasst sich mit den spezifischen rechtlichen Positionen von Heimarbeitern, Hausgewerbetreibenden und Zwischenmeistern. Es definiert die jeweiligen Begriffe und analysiert die besonderen Rechtsbeziehungen, die mit diesen Beschäftigungsformen verbunden sind. Der Schwerpunkt liegt auf der Abgrenzung dieser Gruppen zu klassischen Arbeitnehmern und auf der Erläuterung der jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen.
5. Freie Mitarbeiter: Das Kapitel widmet sich der Definition und Abgrenzung freier Mitarbeiter. Es untersucht die Frage, unter welchen Umständen freie Mitarbeiter als Arbeitnehmer oder als arbeitnehmerähnliche Personen qualifiziert werden können. Die Analyse konzentriert sich auf die Kriterien, die für die rechtliche Einordnung entscheidend sind und die möglichen Konsequenzen für die Anwendung des Arbeitsrechts.
6. Handelsvertreter: Hier wird der Begriff des Handelsvertreters erläutert und die Anwendbarkeit des Arbeitsrechts auf diese Berufsgruppe untersucht. Das Kapitel befasst sich mit den spezifischen Merkmalen des Handelsvertreterverhältnisses und den daraus resultierenden rechtlichen Implikationen. Die Analyse beleuchtet die Unterschiede zu anderen Beschäftigungsformen und die besonderen rechtlichen Herausforderungen.
7. Berufliche Gliederung der Arbeitnehmer: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die verschiedenen beruflichen Kategorien von Arbeitnehmern. Es dient als Grundlage für die detailliertere Betrachtung spezifischer Gruppen in den folgenden Kapiteln. Die Übersicht ermöglicht ein besseres Verständnis der Vielfalt an Arbeitnehmerpositionen und ihrer jeweiligen rechtlichen Einordnung.
8. Arbeiter und Angestellte: In diesem Kapitel werden Arbeiter und Angestellte definiert und die Unterschiede zwischen diesen beiden Kategorien von Arbeitnehmern herausgearbeitet. Es werden typische Merkmale der jeweiligen Positionen vorgestellt und anhand von Einzelfällen die Anwendung der Unterscheidungskriterien illustriert. Die Analyse berücksichtigt die vielfältigen Facetten dieser Unterscheidung und verdeutlicht ihre Bedeutung im Arbeitsrecht.
9. Leitende Angestellte: Dieses Kapitel widmet sich der spezifischen Rechtslage leitender Angestellter. Es beschreibt die Merkmale, die eine Person zu einem leitenden Angestellten machen, und erklärt die rechtlichen Konsequenzen dieser Einstufung. Das Kapitel analysiert die Besonderheiten der Position und die Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis.
10. Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes: Das Kapitel beleuchtet die Besonderheiten von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst und ihre rechtliche Einordnung. Es beschreibt die Unterschiede zum privaten Sektor und die spezifischen arbeitsrechtlichen Regelungen, die für diese Gruppe gelten. Die Analyse konzentriert sich auf die Besonderheiten des Arbeitsverhältnisses im öffentlichen Sektor und die relevanten rechtlichen Aspekte.
11. Sonstige Arbeitnehmergruppen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene weitere Arbeitnehmergruppen wie Auszubildende, Volontäre, Praktikanten, Werkstudenten und Schüler. Es beschreibt die spezifischen Merkmale der jeweiligen Positionen und ihre rechtliche Einordnung. Die Analyse konzentriert sich auf die Besonderheiten der jeweiligen Arbeitsverhältnisse und die rechtlichen Implikationen.
12. Definition und Verbreitung von Scheinselbstständigkeit: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Scheinselbstständigkeit und analysiert die Verbreitung dieses Phänomens. Es beleuchtet die Ursachen und die wirtschaftlichen sowie sozialen Folgen der Scheinselbstständigkeit. Die Analyse gibt einen Überblick über das Ausmaß des Problems und seine Bedeutung.
13. Scheinselbstständigkeit in der Rechtssprechung: Dieses Kapitel untersucht die juristische Auseinandersetzung mit Scheinselbstständigkeit. Es analysiert das Gesetz gegen Scheinselbstständigkeit und die Korrektur durch das Gesetz zur „Förderung der Selbständigkeit“. Weiterhin werden die rechtlichen Folgen bei fehlerhafter Qualifizierung eines Arbeitsverhältnisses als selbstständig erläutert. Die Analyse konzentriert sich auf die Entwicklung der Rechtsprechung und die damit verbundenen Konsequenzen.
Schlüsselwörter
Arbeitnehmer, Scheinselbstständigkeit, Arbeitsrecht, Abhängigkeitsverhältnis, Selbstständigkeit, § 5 ArbGG, § 5 BetrVG, Arbeitsverhältnis, Rechtsprechung, Berufsgruppen, rechtliche Einordnung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Arbeitnehmerbegriff und Scheinselbstständigkeit im deutschen Recht
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Arbeitnehmerbegriff im deutschen Recht und die damit verbundene Problematik der Scheinselbstständigkeit. Es analysiert verschiedene Kategorien von Arbeitnehmern, unterscheidet sie von selbstständigen Tätigkeiten und beleuchtet die rechtlichen Konsequenzen. Das Dokument beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Wie wird der Arbeitnehmerbegriff definiert?
Der Arbeitnehmerbegriff wird anhand der gesetzlichen Definitionen in § 5 ArbGG und § 5 BetrVG erläutert. Das Dokument zeigt die Schwierigkeiten bei der einheitlichen Begriffsbestimmung auf und diskutiert unterschiedliche juristische Ansätze. Die drei zentralen Voraussetzungen eines Arbeitsverhältnisses – Verpflichtung zur Arbeitsleistung, privatrechtlicher Vertrag und Leistung der Arbeit im Dienst eines anderen – werden detailliert analysiert.
Was sind die Voraussetzungen für ein Arbeitsverhältnis?
Ein Arbeitsverhältnis setzt sich aus drei zentralen Voraussetzungen zusammen: die Verpflichtung zur Arbeitsleistung, das Bestehen eines privatrechtlichen Vertrags oder eines gleichgestellten Verhältnisses und die Leistung der Arbeit im Dienst eines anderen. Das Dokument betont die Bedeutung der Abhängigkeit und Fremdbestimmung im Arbeitsverhältnis.
Was sind arbeitnehmerähnliche Personen?
Arbeitnehmerähnliche Personen sind Personen, die zwar aufgrund fehlender persönlicher Abhängigkeit keine Arbeitnehmer sind, aber aufgrund wirtschaftlicher Abhängigkeit keine Unternehmer. Das Dokument erläutert den Begriff und die rechtlichen Konsequenzen dieser ambivalenten Position.
Wer wird im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt verschiedene Berufsgruppen, darunter Heimarbeiter, Hausgewerbetreibende, Zwischenmeister, freie Mitarbeiter, Handelsvertreter, Arbeiter, Angestellte, leitende Angestellte, Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes sowie weitere Gruppen wie Auszubildende, Volontäre, Praktikanten, Werkstudenten und Schüler. Es analysiert die spezifischen rechtlichen Positionen jeder Gruppe.
Was ist Scheinselbstständigkeit?
Scheinselbstständigkeit beschreibt die Situation, in der ein Arbeitsverhältnis fälschlicherweise als selbstständige Tätigkeit qualifiziert wird. Das Dokument definiert den Begriff, analysiert seine Verbreitung, die Ursachen und Folgen sowie die rechtliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen.
Welche Gesetze sind relevant für Scheinselbstständigkeit?
Das Dokument analysiert das Gesetz gegen Scheinselbstständigkeit und die Korrektur durch das Gesetz zur „Förderung der Selbständigkeit“. Es erläutert die rechtlichen Folgen bei fehlerhafter Qualifizierung eines Arbeitsverhältnisses als selbstständig.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Thema?
Schlüsselwörter sind: Arbeitnehmer, Scheinselbstständigkeit, Arbeitsrecht, Abhängigkeitsverhältnis, Selbstständigkeit, § 5 ArbGG, § 5 BetrVG, Arbeitsverhältnis, Rechtsprechung, Berufsgruppen, rechtliche Einordnung.
Wie sind die Kapitel aufgebaut?
Jedes Kapitel widmet sich einer spezifischen Kategorie von Beschäftigungsverhältnissen oder einem Aspekt des Arbeitnehmerbegriffs. Die Kapitel beginnen mit einer Definition und gehen dann auf die relevanten rechtlichen Aspekte, Besonderheiten und Abgrenzungen zu anderen Beschäftigungsformen ein. Kapitelzusammenfassungen liefern einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, den Arbeitnehmerbegriff im deutschen Recht zu untersuchen und das Problem der Scheinselbstständigkeit zu beleuchten. Es soll die verschiedenen Kategorien von Arbeitnehmern verdeutlichen und die Abgrenzung zu selbstständigen Tätigkeiten klar darstellen.
- Quote paper
- Arno Wortmann (Author), 2002, Der Begriff des Arbeitnehmers und das Problem der Scheinselbstständigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/8851