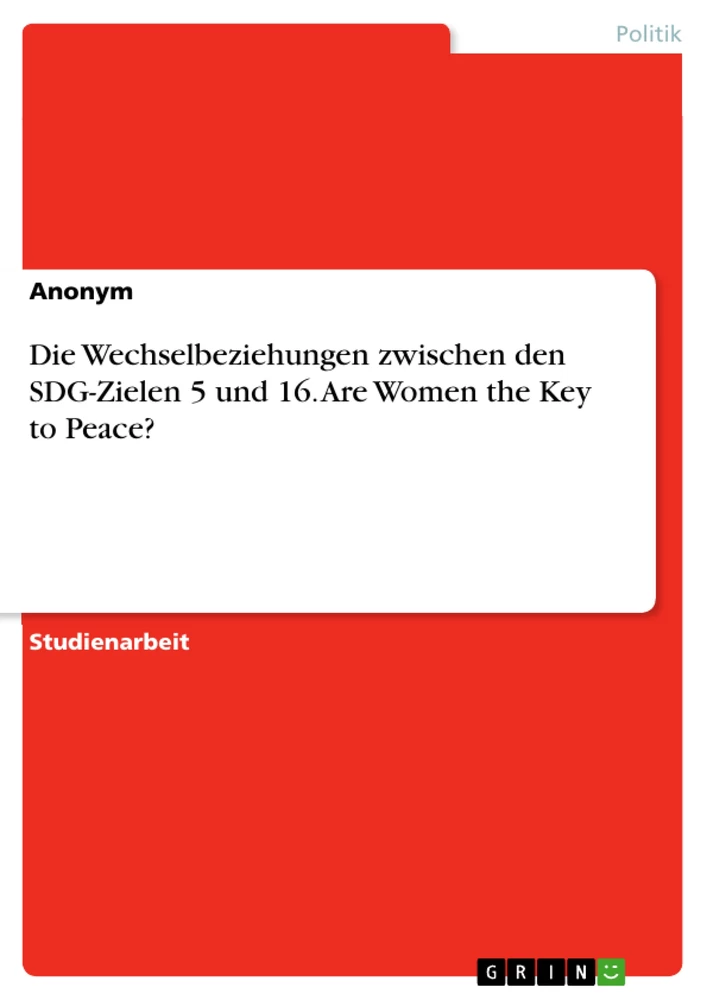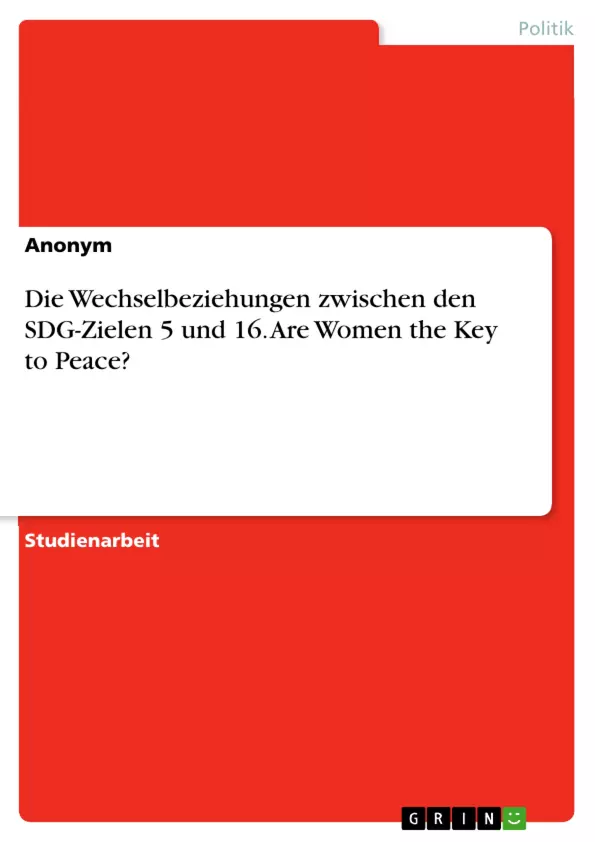Die SDGs bieten einen thematisch breiten normativen Rahmen für die Transformation hin zu einer nachhaltigen Entwicklung. Aufgrund ihrer Eigenschaft als integriertes, unteilbares Set von Zielen und Maßnahmen kommt der Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Zielen und Unterzielen eine besondere Bedeutung zu. Bei Kenntnis dieser Wirkungen können Synergien genutzt werden und Zielkonflikte verhindert, vermindert oder zumindest eingeplant werden.
Für die in der vorliegenden Arbeit durchgeführte Untersuchen wurde ein von Nilsson et al. (2016) entwickeltes Analyseraster angewandt, um die Wechselwirkungen zwischen den SDGs 5 und 16 sowie deren Unterzielen zu identifizieren. Dabei zeigte sich, dass zwischen diesen beiden Zielen zahlreiche kausale und/oder funktionale Zusammenhänge bestehen. Die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und das Ende von Gewalt gegen Frauen hängen dabei unmittelbar mit einer Verringerung aller Formen von Gewalt im Allgemeinen ab. Zudem wirken sich starke, nicht von Korruption geprägte öffentliche Institutionen positiv auf die Gleichberechtigung und die Chancengleichheit von Frauen bei der Übernahme von Führungspositionen im politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Leben aus. Diese Resultate der Analyse wurden anschließend diskutiert und zur Formulierung einiger politischer Handlungsoptionen genutzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsdesign
- 2.1. Die Sustainable Development Goals
- 2.2. Wechselwirkungen zwischen den Zielen und Unterzielen
- 2.3. Fallauswahl und Forschungsmethode
- 3. Analyse
- 3.1. Die Nachhaltigkeitsziele 5 und 16 und ihre Unterziele
- 3.2. Die Wechselbeziehungen auf der Goal-Ebene
- 3.3. Die Wechselbeziehungen auf der Target-Ebene
- 3.3.1. Wechselbeziehungen zwischen den Unterzielen 5.1 und 16.1
- 3.3.2. Wechselbeziehungen zwischen den Unterzielen 5.2 und 16.1
- 3.3.3. Wechselbeziehungen zwischen den Unterzielen 5.5 und 16.3, 16.5, 16.6
- 3.3.4. Wechselbeziehungen zwischen den Unterzielen 5.1 und 16.3, 16.5, 16.6
- 3.3.5. Wechselbeziehungen zwischen den Unterzielen 5.5 und 16.7
- 4. Diskussion der Ergebnisse
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Wechselwirkungen zwischen SDG 5 (Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung von Frauen) und SDG 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen). Ziel ist es, Synergien zu identifizieren, die die Implementierung beider Ziele erleichtern, sowie Divergenzen aufzuzeigen.
- Analyse der Wechselwirkungen zwischen SDG 5 und SDG 16
- Identifizierung von Synergien und Zielkonflikten
- Entwicklung politischer Handlungsoptionen
- Diskussion der Grenzen der Untersuchung
- Forschungsausblick
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Arbeit stellt die Sustainable Development Goals (SDGs) als internationales Zielsystem für nachhaltige Entwicklung vor und erläutert die Bedeutung der Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Zielen.
- Kapitel 2: Forschungsdesign: Dieses Kapitel definiert den Analyserahmen für die Untersuchung von SDG-Interaktionen, stellt die Fallauswahl sowie die Forschungsmethode vor und erläutert die Bedeutung der Agenda 2030 für die globale Entwicklung.
- Kapitel 3: Analyse: Dieses Kapitel analysiert die Wechselwirkungen zwischen SDG 5 und SDG 16 auf der Ebene der Ziele und der Unterziele, um Synergien und Divergenzen aufzudecken.
- Kapitel 4: Diskussion der Ergebnisse: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Analyse und entwickelt daraus politische Handlungsoptionen für die Implementierung der SDGs.
Schlüsselwörter
Sustainable Development Goals (SDGs), Agenda 2030, Geschlechtergerechtigkeit, Frieden, Gerechtigkeit, starke Institutionen, Zielkonflikte, Synergien, politische Handlungsoptionen, Interdependenzen.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen SDG 5 und SDG 16 zusammen?
Zwischen Geschlechtergerechtigkeit (SDG 5) und Frieden (SDG 16) bestehen starke Synergien: Ein Ende der Gewalt gegen Frauen trägt unmittelbar zur allgemeinen Gewaltreduzierung in der Gesellschaft bei.
Welche Rolle spielen starke Institutionen für Frauen?
Korruptionsfreie öffentliche Institutionen (SDG 16) fördern die Chancengleichheit und den Zugang von Frauen zu Führungspositionen in Politik und Wirtschaft.
Was ist das Nilsson-Analyseraster?
Es ist ein wissenschaftliches Werkzeug zur Identifizierung von Wechselwirkungen zwischen den Nachhaltigkeitszielen, um Synergien zu nutzen und Zielkonflikte zu vermeiden.
Warum sind Frauen der "Schlüssel zum Frieden"?
Die Analyse zeigt, dass Gesellschaften mit höherer Gleichberechtigung stabiler sind und dass Frauen in Entscheidungsprozessen oft nachhaltigere Friedensstrategien fördern.
Was bedeutet die "Unteilbarkeit" der SDGs?
Die Agenda 2030 betont, dass die Ziele integriert sind. Fortschritte in einem Bereich (z. B. Frieden) sind oft nur möglich, wenn gleichzeitig Fortschritte in anderen Bereichen (z. B. Gleichstellung) erzielt werden.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Die Wechselbeziehungen zwischen den SDG-Zielen 5 und 16. Are Women the Key to Peace?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/882672