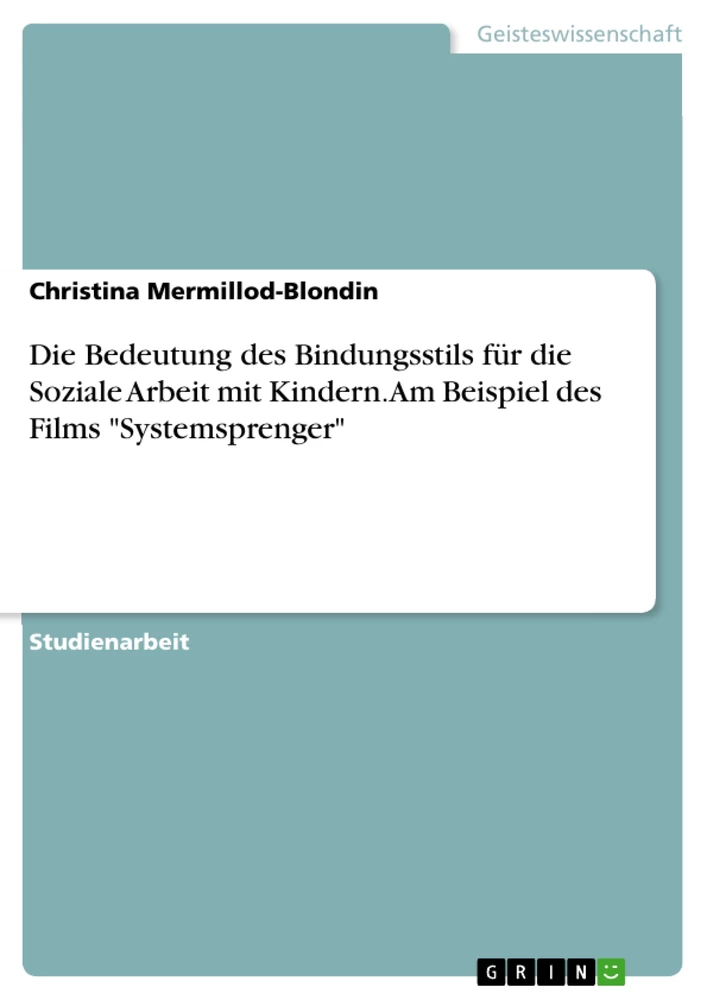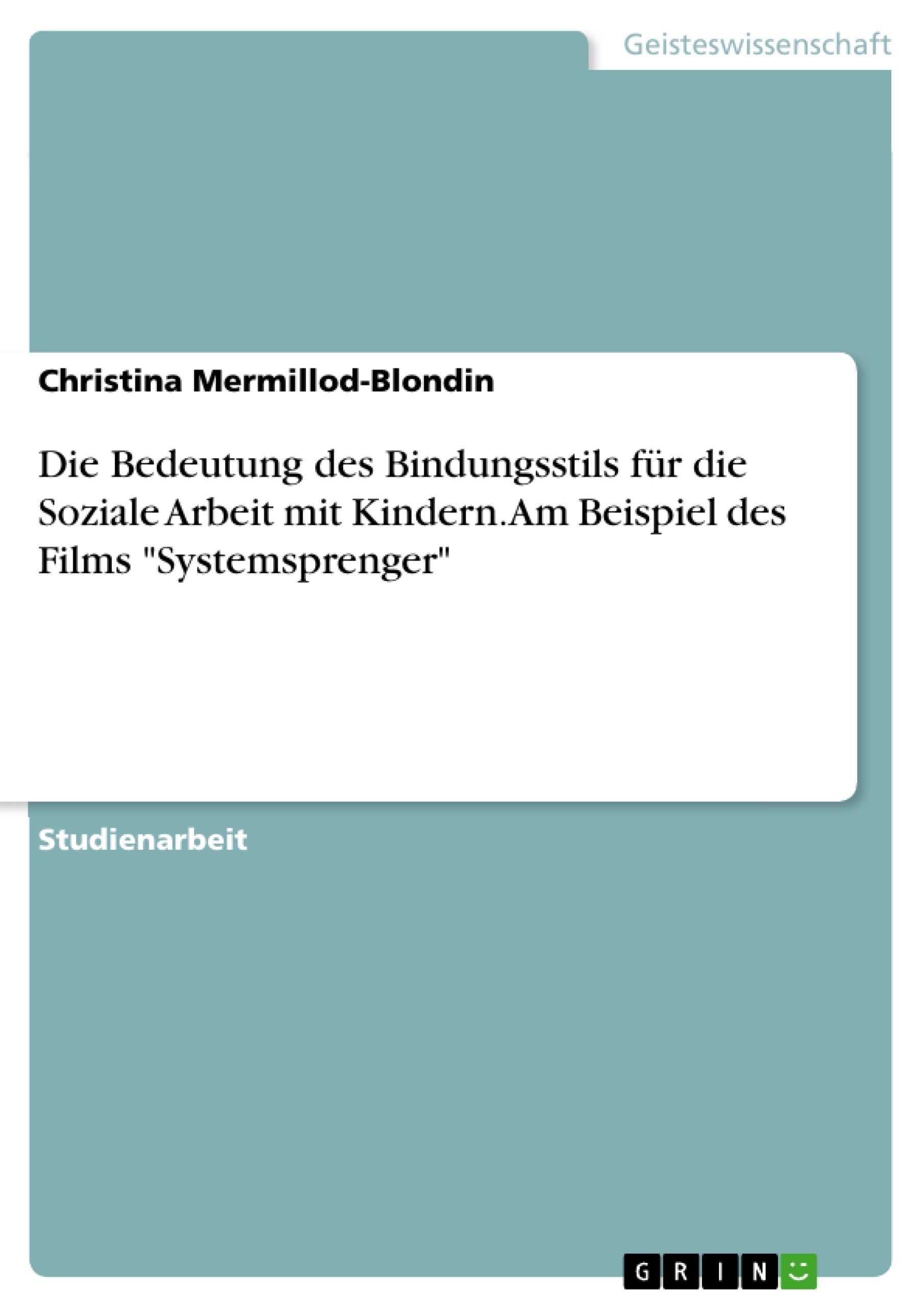Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung des Bindungsstils für die Soziale Arbeit mit Kindern. Der englische Kinderpsychiater John Bowlby ist Gründer der modernen Bindungstheorie. Bowlby arbeitete im klinischen Kontext mit Kindern, die bei und nach Trennungen von ihren Eltern wegen bevorstehender Operationen auffällige Reaktionen zeigten. In Zusammenarbeit mit der Sozialarbeit entwickelte er 1944 "The 44 Juvenile Thieves Study". Diese erste bindungsthematische Studie belegte einen Zusammenhang zwischen Delinquenz und frühen Verlusterfahrungen. Als Leiter der "Abteilung für Eltern und Kind" einer Kinderklinik implementierte er eine Forschungsgruppe, zu der auch der Sozialarbeiter James Robertson und die Psychologin Margret Ainsworth gehörten, die vor allem experimentell arbeiteten.
James Robertsons Hausbesuch-Dokumentationen beschrieben die Bedeutung der Mutter-Kind-Aktion für die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung des Kindes. Sie inspirierten Ainsworth im Jahr 1969 zu ihrem berühmten Versuchsaufbau Fremde Situation ("Strange Situation"). Das Experiment belegte, dass bereits Babys Bindungsmuster verinnerlicht haben, die sich messen und in sichere und unsichere bzw. desorganisierte unterscheiden lassen. Der Versuchsaufbau fand seinen Weg in die Praxis zum Erfassen der Bindungsqualität zwischen einem Kind und seiner Hauptbezugsperson. Bis heute folgt die Psychologie der Einteilung in vier Bindungsstile, welche im 2. Kapitel mit Gewichtung auf den desorganisierten Bindungsstil vorgestellt werden. Die Soziale Arbeit ist mit diesem Bindungsstil häufig konfrontiert und er macht im Umkehrschluss deutlich, was für die kindliche Entwicklung aus welchen Gründen unentbehrlich ist.
Ausgehend von der Fremden Situation entwickelte die Entwicklungspsychologie Erhebungsverfahren zur Erfassung von Bindungsstilen älterer Kindern und auch Erwachsener. Zwei Verfahren, das "Geschichtenergänzungsverfahren zur Bindung (GEV-B)" sowie den "Bochumer Bindungstest (BoBiTe)" werden in Kapitel 3 präsentiert, darauf aufbauend, diskutiert, inwiefern sich Bindungsstil-Kenntnisse und Tests in der Sozialen Arbeit wie nutzen lassen. Zusammenführen werden die Erkenntnisse in einer bindungstheoretischen Analyse des preisgekrönten Films „Systemsprenger“ (Fingscheidt, 2019) erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bindungsstile nach John Bowlby
- 2.1 Sichere Bindung
- 2.2 Unsichere Bindung
- 3. Bindungsstil und Soziale Arbeit
- 4. Fazit: Bindungsstil-Arbeit in „Systemsprenger“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bedeutung des Bindungsstils für die Soziale Arbeit mit Kindern. Die Arbeit beleuchtet die Bindungstheorie nach Bowlby, verschiedene Bindungsstile und deren Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Anwendung von Bindungsstil-Kenntnissen in der Sozialen Arbeit.
- Die Bindungstheorie nach John Bowlby und deren Entwicklung
- Die verschiedenen Bindungsstile (sicher, unsicher, desorganisiert)
- Die Bedeutung von Bindung für die soziale und emotionale Entwicklung von Kindern
- Die Anwendung von Bindungswissen in der Sozialen Arbeit
- Die Darstellung des Bindungsstils im Film "Systemsprenger"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bindungstheorie ein und beschreibt den historischen Kontext ihrer Entstehung durch John Bowlby. Sie hebt die Bedeutung der frühen Forschung, insbesondere "The 44 Juvenile Thieves Study", hervor und skizziert die Rolle der Sozialarbeit in der Entwicklung und Anwendung der Bindungstheorie. Die Einleitung stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor und gibt einen Überblick über die folgenden Kapitel, die sich mit den Bindungsstilen, ihrer Erfassung und ihrer Relevanz für die Soziale Arbeit befassen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem desorganisierten Bindungsstil und dessen Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung sowie dessen Darstellung im Film "Systemsprenger".
2. Bindungsstile nach John Bowlby: Dieses Kapitel erläutert den Unterschied zwischen Bindung und Beziehung und definiert Bindungsverhalten nach Bowlby. Es beschreibt die Bedeutung einer feinfühligen Hauptbezugsperson für die kindliche Entwicklung und die Auswirkungen von unzureichendem Bindungsverhalten. Das Kapitel stellt die "Fremde Situation" als Messinstrument zur Erfassung von Bindungsstilen vor und beschreibt detailliert die Merkmale sicherer und unsicherer Bindungsstile bei Kindern im Alter von 11-20 Monaten. Der Fokus liegt auf der Erklärung der Entstehung der Bindungsstile durch die Interaktion zwischen Kind und Hauptbezugsperson. Die Bedeutung des Explorationsverhaltens und dessen Zusammenhang mit dem Bindungsverhalten wird ebenfalls erörtert.
3. Bindungsstil und Soziale Arbeit: Dieses Kapitel präsentiert und diskutiert Erhebungsverfahren zur Erfassung von Bindungsstilen bei älteren Kindern und Erwachsenen, wie das "Geschichtenergänzungsverfahren zur Bindung (GEV-B)" und den "Bochumer Bindungstest (BoBiTe)". Es analysiert den praktischen Nutzen von Bindungsstil-Kenntnissen und -Tests in der Sozialen Arbeit, mit dem Ziel, die Interaktion zwischen Sozialarbeiter und Kind zu verbessern und neue Bindungserfahrungen zu ermöglichen. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie die Erkenntnisse über Bindungsstile in der Praxis der Sozialen Arbeit effektiv eingesetzt werden können.
Schlüsselwörter
Bindungstheorie, John Bowlby, Bindungsstile, sichere Bindung, unsichere Bindung, desorganisierte Bindung, Hauptbezugsperson, Fremde Situation, Soziale Arbeit, Kinderschutz, Entwicklungspsychologie, "Systemsprenger".
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Bindungsstile und Soziale Arbeit
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung von Bindungsstilen für die Soziale Arbeit mit Kindern. Sie untersucht die Bindungstheorie nach Bowlby, verschiedene Bindungsstile (sicher, unsicher, desorganisiert) und deren Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Anwendung von Bindungsstil-Kenntnissen in der Sozialen Arbeit und der Darstellung dieser im Film "Systemsprenger". Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Bowlby's Bindungstheorie und -stilen, die Anwendung in der Sozialen Arbeit und ein Fazit. Zusätzlich werden Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter bereitgestellt.
Welche Bindungsstile werden behandelt?
Die Hausarbeit beschreibt detailliert sichere und unsichere Bindungsstile nach Bowlby, inklusive des desorganisierten Bindungsstils. Es wird erläutert, wie diese Stile durch die Interaktion zwischen Kind und Hauptbezugsperson entstehen und welche Auswirkungen sie auf die kindliche Entwicklung haben.
Wie wird die Bindungstheorie nach Bowlby dargestellt?
Die Arbeit erläutert die Grundlagen der Bindungstheorie nach John Bowlby, inklusive der Bedeutung einer feinfühligen Hauptbezugsperson und der Auswirkungen unzureichenden Bindungsverhaltens. Sie beschreibt die "Fremde Situation" als Messinstrument und den Unterschied zwischen Bindung und Beziehung.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit in dieser Hausarbeit?
Ein zentraler Aspekt der Arbeit ist die Anwendung von Bindungswissen in der Sozialen Arbeit. Es werden Erhebungsverfahren zur Erfassung von Bindungsstilen bei älteren Kindern und Erwachsenen (z.B. GEV-B und BoBiTe) vorgestellt und der praktische Nutzen von Bindungsstil-Kenntnissen in der Praxis der Sozialen Arbeit diskutiert, mit dem Ziel, die Interaktion zwischen Sozialarbeiter und Kind zu verbessern und neue Bindungserfahrungen zu ermöglichen.
Wie wird der Film "Systemsprenger" in die Arbeit integriert?
Die Hausarbeit bezieht den Film "Systemsprenger" mit ein, indem sie die Darstellung des Bindungsstils im Film analysiert und diesen im Kontext der Bindungstheorie und der Sozialen Arbeit diskutiert. Der desorganisierte Bindungsstil und dessen Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung spielen dabei eine besondere Rolle.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Bindungstheorie, John Bowlby, Bindungsstile, sichere Bindung, unsichere Bindung, desorganisierte Bindung, Hauptbezugsperson, Fremde Situation, Soziale Arbeit, Kinderschutz, Entwicklungspsychologie und "Systemsprenger".
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu den Bindungsstilen nach John Bowlby, ein Kapitel zum Thema Bindungsstil und Soziale Arbeit und ein Fazit, das den Bindungsstil im Film "Systemsprenger" beleuchtet. Jedes Kapitel bietet detaillierte Informationen zu den jeweiligen Themen.
Welche Methoden zur Erfassung von Bindungsstilen werden erwähnt?
Die Hausarbeit erwähnt das "Geschichtenergänzungsverfahren zur Bindung (GEV-B)" und den "Bochumer Bindungstest (BoBiTe)" als Erhebungsverfahren zur Erfassung von Bindungsstilen bei älteren Kindern und Erwachsenen.
Was ist die Zielsetzung der Hausarbeit?
Die Zielsetzung der Hausarbeit ist die Untersuchung der Bedeutung des Bindungsstils für die Soziale Arbeit mit Kindern. Sie möchte die Bindungstheorie nach Bowlby, verschiedene Bindungsstile und deren Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung beleuchten und den Schwerpunkt auf die Anwendung von Bindungsstil-Kenntnissen in der Sozialen Arbeit legen.
- Quote paper
- Christina Mermillod-Blondin (Author), 2020, Die Bedeutung des Bindungsstils für die Soziale Arbeit mit Kindern. Am Beispiel des Films "Systemsprenger", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/882482