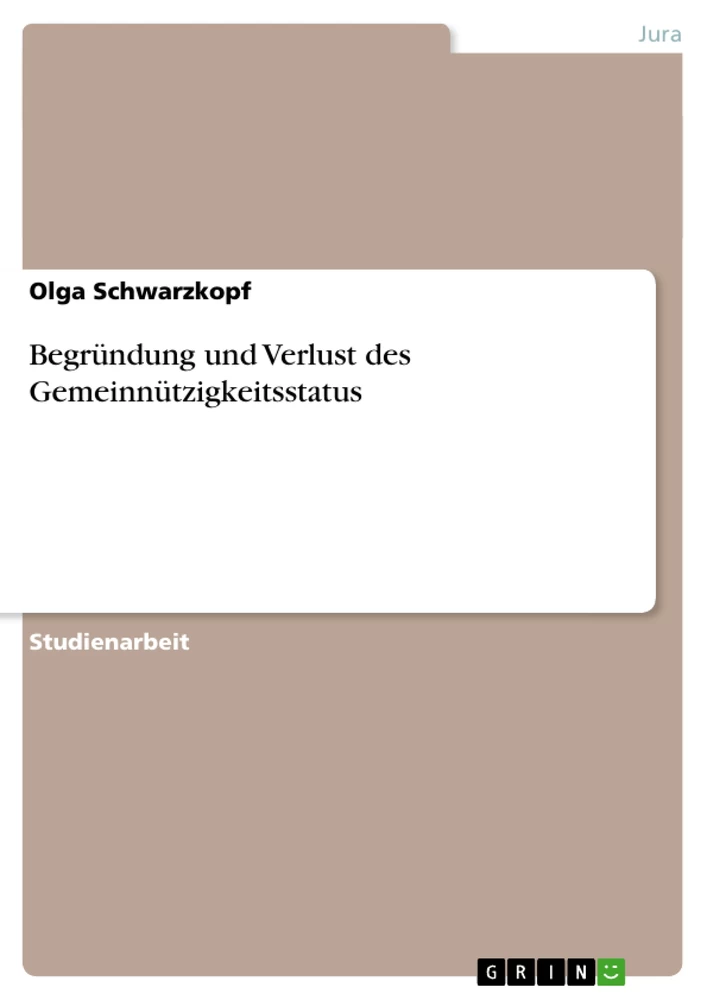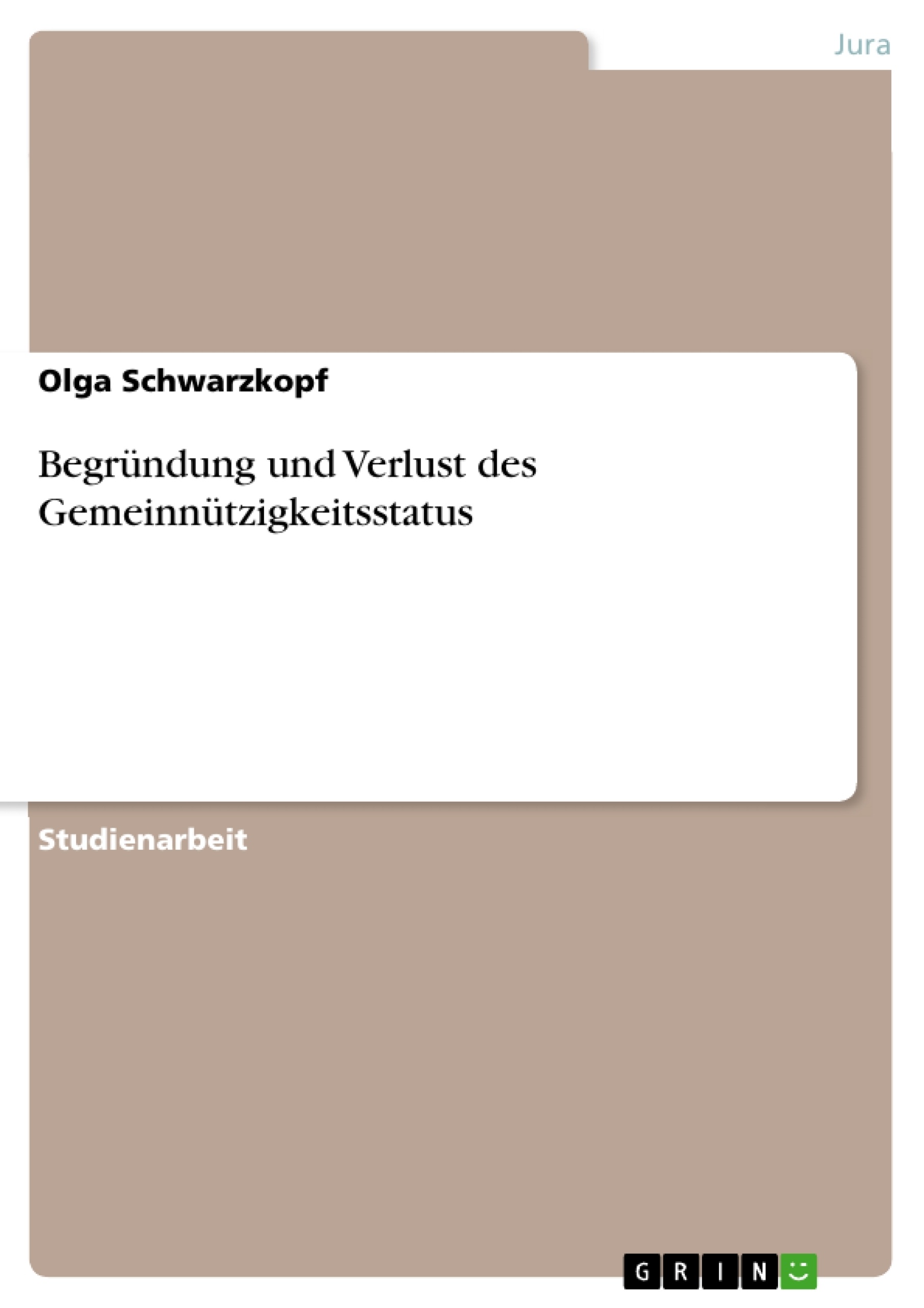In mehreren einzelnen Steuergesetzen sind für das gemeinnützige, also dem Wohle der Allgemeinheit dienende Wirken steuerliche Erleichterungen und Vergünstigungen vorgesehen. Hier sind zu nennen die Steuerbefreiung von der Körperschaft-, Gewerbe- und Vermögenssteuer , die Besteuerung von steuerpflichtigen Umsätzen mit dem ermäßigten Steuersatz , die Steuerfreiheit bei der Erbschaft-/Schenkungssteuer und die Steuerfreiheit bei der Grundsteuer . Hinzu kommen Aufwandsentschädigungen für nebenberufliche Tätigkeiten im allgemeinen gemeinnützigen Bereich sowie Steuerbegünstigungen von Ausgaben in Form von Spenden. Außer den steuerlichen Vergünstigungen kommen noch z.B. die Zuschüsse der öffentlichen Hand und unter anderem die Befreiung von staatlichen Gebühren und Kosten.
Der wesentliche Hintergrund für die Gewährung solcher Vergünstigungen ist die Entlastung des Staates von eigenen Aufgaben, die von den gemeinnützigen Einrichtungen übernommen werden. Die gemeinnützigen Körperschaften verwenden ihre Mittel für Zwecke, für die sonst Staat oder Kommunen Steuermittel einsetzen würden. Das Tätigwerden dieser Einrichtungen im Sinne des Staates im gleichen Umfang zu versteuern, wie die eigennützige Gewinnerzielung wäre nicht sinnvoll, da die Belastung die Bereitschaft und die Mittel zum selbstlosen Handeln schmälern würden. Zudem würde der Handlungsspielraum der Körperschaften dadurch beschnitten.
Die Steuerbegünstigungen in den einzelnen Steuergesetzen beziehen sich häufig auf die Gemeinnützigkeit. Im folgenden werden zunächst die Voraussetzungen für die Anerkennung als gemeinnützige Körperschaft erörtert, wonach auf das praktische Anerkennungsverfahren und dessen Besonderheiten näher eingegangen wird.
Die Komplexität und Verwobenheit der einzelnen steuerlichen Regelungen macht es für Einrichtungen schwer, die häufig eng gesetzten Grenzen einer Steuerbefreiung nicht zu überschreiten. Die Überschreitung dieser Grenzen kann unter anderem zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit führen, was bei den gemeinnützigen Einrichtungen den Entzug ihrer Lebensgrundlage bedeuten kann.
Im zweiten Teil werden die einzelnen Rechtsfolgen und Auswirkungen des Verlustes des Gemeinnützigkeitsstatus aufgeführt. Daraufhin werden die einzelnen Gefahrenquellen und Fehlverhalten der Körperschaften und ihrer Vertreter unter rechtlicher und verfassungsmäßiger Würdigung dargestellt, die zu diesem Verlust führen können.
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1. Begründung des Gemeinnützigkeitsstatus.
- A. Die ,,steuerbegünstigten Zwecke“ der Abgabenordnung
- I. Subjekt und Voraussetzungen der §§ 51 ff AO.
- II. Anforderungen an die Satzung
- 1) Formelle Satzungsmäßigkeit
- 2) Grundsatz der Vermögensbindung
- 3) Verbotener Satzungsinhalt
- B. Praktisches Anerkennungsverfahren
- I. Die Entscheidung über die Gemeinnützigkeit im Rahmen des Körperschaftssteuerveranlagungsverfahrens
- II. Vorläufige Bescheinigung
- III. ,,Verzicht\" auf den Gemeinnützigkeitsstatus
- C. Zusammenfassung
- Teil 2. Verlust des Gemeinnützigkeitsstatus
- D. Rechtsfolgen bei Verlust des Gemeinnützigkeitsstatus
- I. Fristsetzung nach § 63 IV AO
- II. Änderung und Erlass von Steuerbescheiden
- III. Nachversteuerung der letzten 10 Jahre
- IV. Spendenhaftung
- E. Gefahrenquellen und Gründe für die Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus
- I. Anforderungen an die tatsächliche Geschäftsführung
- II. Zurechnung von Handlungen
- III. Zeitnahe Mittelverwendung
- IV. Mittelfehlverwendung
- V. Verstöße gegen die allgemeine Rechtsordnung
- 1) Die Behandlung der Verstöße in der Praxis
- a) Frühere Rechtsprechung
- b) Ähnliche Haltung der Literatur und Verwaltungspraxis
- c) Die jüngere Rechtsprechung und Verwaltungspraxis
- d) Stellungnahme
- 2) Zusammenfassung/Ergebnis
- VI. Zusammenfassung
- F. Schlusssatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Begründung und dem Verlust des Gemeinnützigkeitsstatus. Sie beleuchtet die rechtlichen Voraussetzungen für die Anerkennung als gemeinnützige Körperschaft sowie die rechtlichen Folgen, die mit dem Verlust des Gemeinnützigkeitsstatus verbunden sind.
- Rechtliche Voraussetzungen für die Begründung des Gemeinnützigkeitsstatus
- Anforderungen an die Satzung einer gemeinnützigen Körperschaft
- Praktisches Anerkennungsverfahren für die Gemeinnützigkeit
- Rechtliche Folgen des Verlustes des Gemeinnützigkeitsstatus
- Gefahrenquellen und Gründe für die Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit der Begründung des Gemeinnützigkeitsstatus. Hier werden die rechtlichen Voraussetzungen für die Anerkennung als gemeinnützige Körperschaft erläutert, insbesondere die Anforderungen an die Satzung und das praktische Anerkennungsverfahren. Der zweite Teil der Arbeit widmet sich dem Verlust des Gemeinnützigkeitsstatus. Er beleuchtet die Rechtsfolgen, die mit dem Verlust des Status verbunden sind, und analysiert verschiedene Gefahrenquellen und Gründe für die Aberkennung des Status.
Schlüsselwörter
Gemeinnützigkeit, Steuerrecht, Abgabenordnung, Körperschaftssteuer, Satzung, Anerkennungsverfahren, Verlust des Gemeinnützigkeitsstatus, Rechtsfolgen, Gefahrenquellen, Rechtsprechung, Verwaltungspraxis.
- Arbeit zitieren
- Olga Schwarzkopf (Autor:in), 2002, Begründung und Verlust des Gemeinnützigkeitsstatus, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/8745