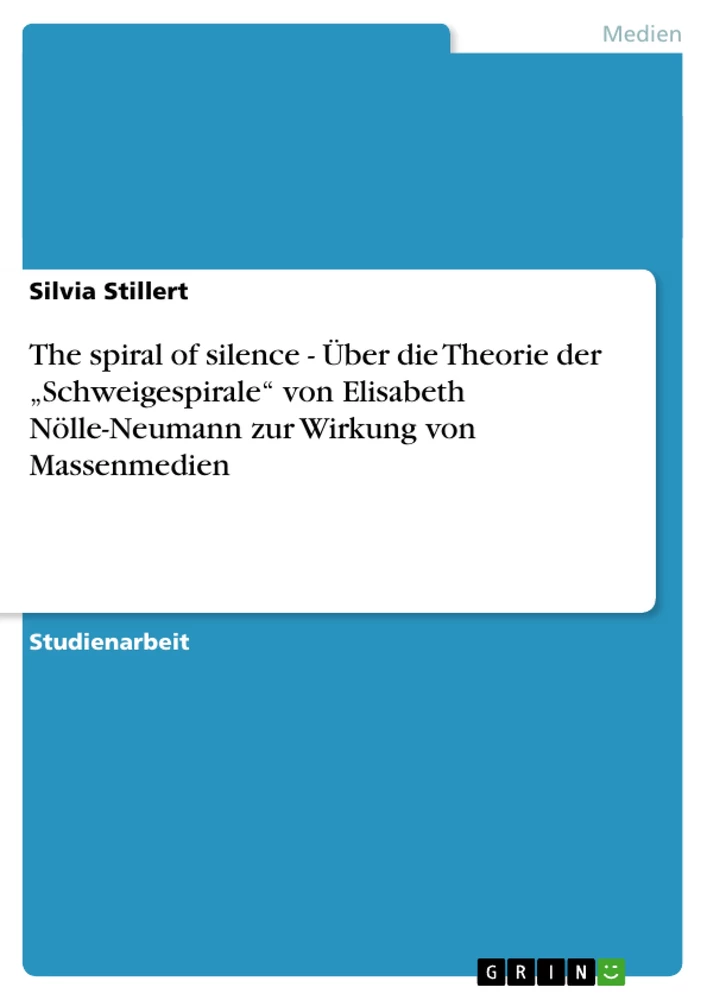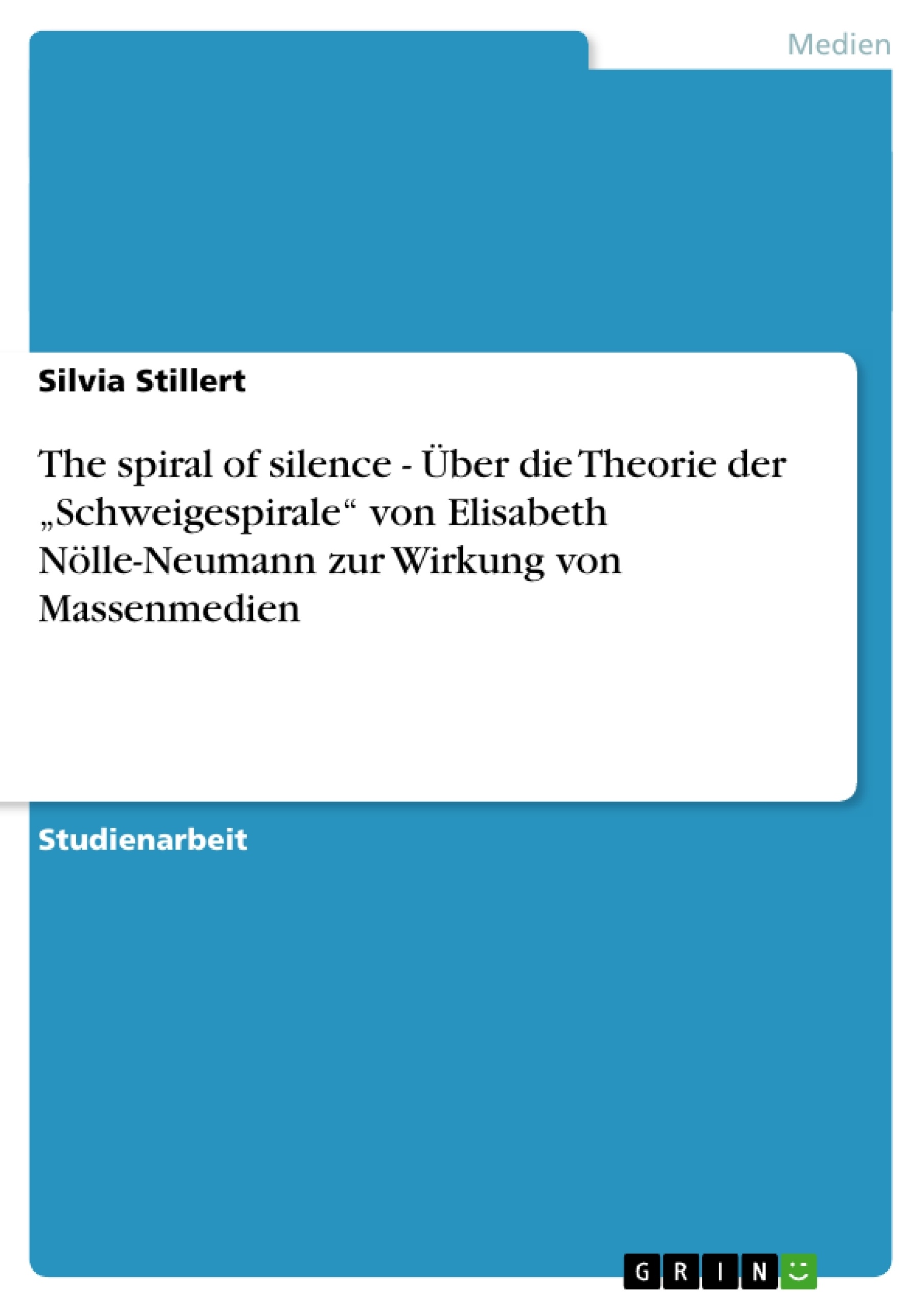Es ist ein Forschungsfeld mit jahrzehntelanger Tradition, in dem es bisher zu vielen empirischen Befunden, aber wenig abgesicherten Erkenntnissen gekommen ist und wohl auch nie kommen wird, da eine globale wissenschaftliche Antwort nicht möglich sein kann. Die Rede ist von der Frage nach der Wirkung der Massenmedien.
Wieso existiert keine allgemein gültige Standardtheorie? Der Untersuchungsgegenstand der Medienwirkungsforschung ist komplex: Zum einen sind Wirkungen vielschichtig differenzierbar. Da gibt es individuelle oder gesellschaftliche, kurz- oder langfristige, Wirkungen vor, während oder nach Empfang der Aussage usw. Zum anderen unterliegen sowohl inhaltliches Angebot der Massenmedien als auch die Rezeptionsgewohnheiten und die Infrastruktur der Medien und viele Komponenten mehr einer ständigen Veränderung. Neue Medien entwickeln sich, die Nutzungsgewohnheiten verschieben sich. Die mediale Entwicklung des Fernsehens liefert ein Beispiel: Vor Jahrzehnten noch dem breiten Publikum unbekannt ist es heute in einem deutschen Haushalt kaum noch wegzudenken. Die Infrastruktur sowie das Nutzungsmuster haben sich verändert. In Folge dieses beobachtbaren Wandels verändern sich auch laufend die Bedingungen, unter denen Massenmedien wirken können.
Aus diesen Gründen gibt es in der Medienwirkungsforschung keine allgemeingültige Theorie, sondern eine Vielzahl an verschiedenen theoretischen Ansätzen, die sich in der Regel nur zeitlich oder räumlich beschränkt verallgemeinern lassen. Einer dieser theoretischen Ansätze ist die „Schweigespirale“ von Elisabeth Nölle-Neumann. Diese Studie befasst sich mit dem Prozess der Bildung „öffentlicher Meinung“. Reden und Schweigen führen wie eine Spirale zu dem Ergebnis, dass eine Meinung schließlich die Öffentlichkeit beherrscht und die Gegenmeinung fast verschwindet. Das Medium des Fernsehens nimmt in diesem Prozess eine wesentliche Wirkungskomponente ein.
Die nachstehende Arbeit wird sich diesem Ansatz widmen und im 2.Kapitel die Theorie zunächst in den Forschungskontext einbetten. In Kapitel 3 wird die Studie vorgestellt. Die Ergebnisse aus der Studie werden an dieser Stelle herausgestellt werden. Im 4.Kapitel findet eine Einordnung der „Schweigespirale“ in den Gesamtkontext der Forschung statt. Die Zusammenfassung wird ein kurzes Resümee beinhalten.
Inhaltsverzeichnis
- EINFÜHRUNG
- THEORETISCH-WISSENSCHAFTLICHER KONTEXT BEI ERSCHEINEN DER STUDIE
- DIE STUDIE
- Fragestellungen
- Hypothesen
- Methoden
- Ergebnisse
- EINORDNUNG DER STUDIE IN DEN GESAMTKONTEXT DER FORSCHUNG
- ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit widmet sich der Theorie der "Schweigespirale" von Elisabeth Nölle-Neumann und analysiert ihren Einfluss auf die Medienwirkungsforschung. Ziel ist es, die Theorie im Kontext der Forschung einzubetten und vor dem Hintergrund des gesamten Forschungskontexts zu bewerten.
- Die Entwicklung der Medienwirkungsforschung von der "Stimulus-orientierten" über die "Rezipienten-orientierte" Phase hin zur "Medien-orientierten" Perspektive.
- Die Theorie der "Schweigespirale" als Teil der "Medien-orientierten" Perspektive, die den Prozess der Bildung "öffentlicher Meinung" in den Mittelpunkt stellt.
- Die Bedeutung des Fernsehens als Medium in der "Schweigespirale" und seine Rolle bei der Meinungsbildung.
- Die Rezeption und weitere Untersuchungen der Theorie der "Schweigespirale" in der Medienwirkungsforschung.
- Die Bewertung der Theorie vor dem Hintergrund des gesamten Forschungskontexts.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Medienwirkungsforschung ein und stellt die Theorie der "Schweigespirale" von Elisabeth Nölle-Neumann vor. Kapitel zwei beleuchtet den theoretischen Kontext, in dem die Studie entstand, und zeichnet die Entwicklung der Medienwirkungsforschung in drei Phasen nach: der "Stimulus-orientierten", der "Rezipienten-orientierten" und der "Medien-orientierten" Phase.
Das dritte Kapitel präsentiert die Studie selbst, indem es auf die Fragestellungen, Hypothesen und Methoden eingeht, die Nölle-Neumann bei ihrer Untersuchung der "Schweigespirale" angewendet hat. Es stellt außerdem die wichtigsten Ergebnisse der Studie vor. Kapitel vier ordnet die "Schweigespirale" in den Gesamtkontext der Forschung ein und betrachtet ihre Rezeption sowie weitere Untersuchungen, die sich mit der Theorie auseinandersetzen.
Schlüsselwörter
Die "Schweigespirale", Medienwirkungsforschung, öffentliche Meinung, Massenmedien, Fernsehen, Meinungsführer, "opinion leader", Agenda-Setting, Stimulus-Response-Modell, "Uses-and-Gratifications-Approach", "Return to the Concept of Powerful Mass Media".
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Silvia Stillert (Autor:in), 2006, The spiral of silence - Über die Theorie der „Schweigespirale“ von Elisabeth Nölle-Neumann zur Wirkung von Massenmedien, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/87215