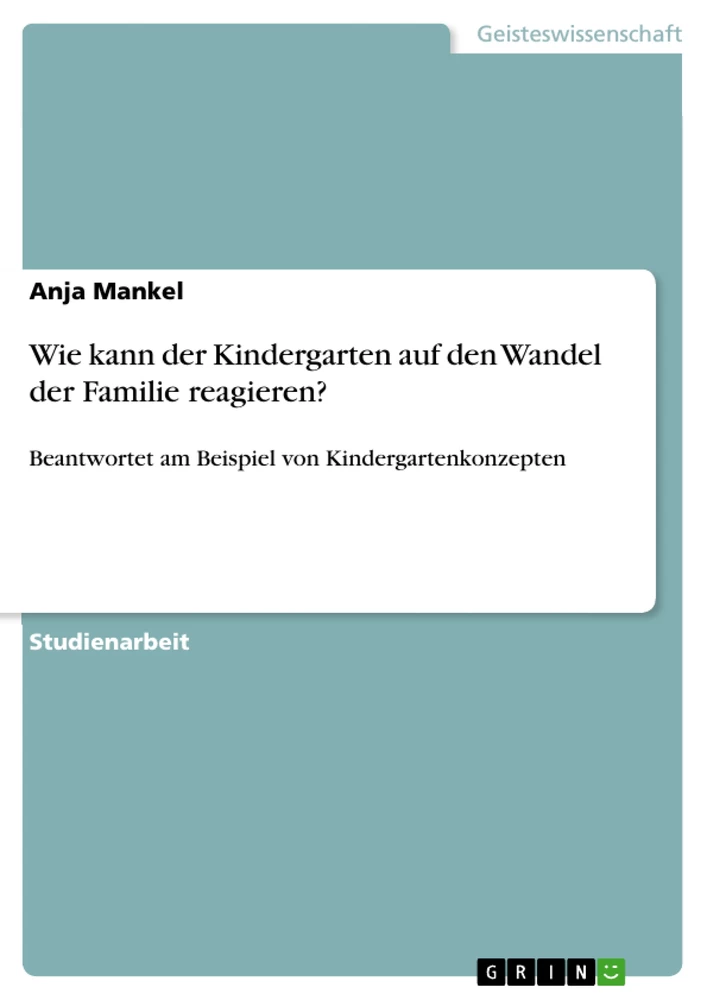Der Kindergarten und auch die anderen Betreuungsformen müssen sich stärker an die Entwicklung der Familie und an die gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen, wenn sie zeitgemäße Hilfe bei der Betreuung der Kinder leisten wollen. Die Familienstruktur und die Rollenverteilung in der Familie haben sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Es gibt im realen Leben nicht mehr häufig die bürgerliche Idealfamilie, die den Vater als Alleinverdiener, und die Mutter als Hausfrau und Betreuungsperson für die Kinder vorsieht, da es die Wirtschaftliche Lage der Familien oft notwendig macht, dass beide Elternteile der Erwerbsarbeit nachgehen müssen. Frauen gehen vermehrt arbeiten, und oft wurde es den Männern erschwert, in Erziehungsurlaub zu gehen, was sich durch die neue Gesetzgebung zumindest auf dem Papier geändert hat. Doch „von seiten der Kollegen wird teilzeitarbeitenden Männern meist nur dann Verständnis entgegengebracht, wenn sie ihre Stundenreduzierung arbeitsmarktpolitisch oder gesundheitlich begründen“, was deutlich die in der Gesellschaft fest geprägte Vorstellung vom „idealen und traditionellen Familienleben“ widerspiegelt. Gerade auch wenn es in unserer modernen und offenen Gesellschaft immer noch so ist, dass „Kinder nach der Scheidung“ zumeist bei den Müttern bleiben, da „es in der traditionellen Kleinfamilie ja auch die Mütter sind, die sich um die Kleinkindererziehung kümmern.“
Durch diese in der Gesellschaft herrschenden Vorurteile und den Mangel an Ganztagesbetreuung werden jedoch immer noch viele Frauen vor die Entscheidung gestellt: Kind oder Karriere, eine Vereinbarkeitsfrage zu der es in einer kinder- und familien-freundlichen Kultur nicht kommen müssen sollte. Kinder sind wichtig. Sie sind die Zukunft diesen und jeden Landes und in sie muss investiert werden.
Diese Arbeit soll auf die Frage nach einem Wandel in der Familienstruktur eingehen, und aufarbeiten inwieweit sich Kindergartenkonzepte daran angepasst haben, und noch anpassen müssen. Hierzu werden die Verschiedenen Familienformen aufgezeigt, wie sie in Industrieller Zeit und in der Moderne vorherrschend waren, bzw. sind. Die Anfänge des Kindergartens als Aufbewahrungsmöglichkeit für den Nachwuchs werden beschrieben, verschiedene neuere Betreuungskonzepte werden vorgestellt, und speziell die Rolle der Sozialpolitik in der Verbesserung der Kindertagesbetreuung soll dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist eine Familie?
- Altes und neues Verständnis
- Familienformen heute
- Ehepaare mit Kindern / Kernfamilien
- Alleinerziehende / Ein-Elternfamilien
- Lebensgemeinschaften, Stieffamilien und Wohngemeinschaften
- Inwieweit hat ein Wandel stattgefunden?
- Wie haben sich Kindergartenkonzepte verändert?
- Die Anfänge des Kindergartens
- Wie ist Kindergarten heute?
- Fröbel
- Montessori
- Waldorfpädagogik
- Curriculare Ansätze
- Der Wandel des Kindergartens im Laufe der Zeit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Familienstruktur und beleuchtet, inwiefern sich Kindergartenkonzepte daran angepasst haben und weiterhin anpassen müssen. Sie analysiert die Entwicklung von Familienformen in der industriellen Zeit und der Moderne, beleuchtet die Anfänge des Kindergartens als Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinder und präsentiert verschiedene moderne Betreuungskonzepte. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle der Sozialpolitik bei der Verbesserung der Kindertagesbetreuung.
- Wandel der Familienstruktur
- Anpassung von Kindergartenkonzepten
- Entwicklung von Familienformen
- Anfänge des Kindergartens
- Moderne Betreuungskonzepte
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet die aktuelle Situation der Kinderbetreuung in Deutschland. Es thematisiert die wachsende Nachfrage nach frühkindlicher Betreuung und die Herausforderungen, denen Betreuungseinrichtungen ausgesetzt sind.
Kapitel 2 definiert den Begriff „Familie“ und untersucht die Entwicklung des Familienverständnisses im Laufe der Zeit. Es analysiert verschiedene Familienformen und die Veränderungen in der Familienstruktur, die durch den demografischen Wandel und die Individualisierung der Lebensformen entstanden sind.
Kapitel 3 befasst sich mit der Entwicklung von Kindergartenkonzepten. Es geht auf die Anfänge des Kindergartens ein und stellt verschiedene moderne Konzepte wie Fröbel, Montessori und Waldorfpädagogik vor. Zudem beleuchtet es die Bedeutung curricularer Ansätze im Kindergarten.
Schlüsselwörter
Familienstruktur, Kindergartenkonzepte, Kinderbetreuung, Betreuungseinrichtungen, Familienformen, Wandel, Sozialpolitik, frühkindliche Bildung, PISA-Studie, Ganztagesbetreuung, Tagespflege, Familienpädagogik, Elementarpädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Wie reagiert der Kindergarten auf den Wandel der Familienstrukturen?
Kindergärten passen sich durch flexiblere Öffnungszeiten, Ganztagesbetreuung und Konzepte an, die die Erwerbstätigkeit beider Elternteile unterstützen.
Welche Rolle spielt die Sozialpolitik bei der Kinderbetreuung?
Die Sozialpolitik schafft gesetzliche Rahmenbedingungen, wie den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.
Welche pädagogischen Konzepte werden im Kindergarten genutzt?
Vorgestellt werden klassische Ansätze nach Fröbel und Montessori sowie die Waldorfpädagogik und moderne curriculare Ansätze.
Was sind die häufigsten Familienformen in der heutigen Zeit?
Neben der Kernfamilie gibt es immer mehr Alleinerziehende, Stieffamilien, Wohngemeinschaften und unverheiratete Lebensgemeinschaften.
Warum ist Ganztagesbetreuung für moderne Familien essenziell?
Da oft beide Elternteile arbeiten müssen oder wollen, verhindert eine verlässliche Ganztagesbetreuung, dass Frauen zwischen „Kind oder Karriere“ wählen müssen.
- Arbeit zitieren
- Anja Mankel (Autor:in), 2007, Wie kann der Kindergarten auf den Wandel der Familie reagieren?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/87051