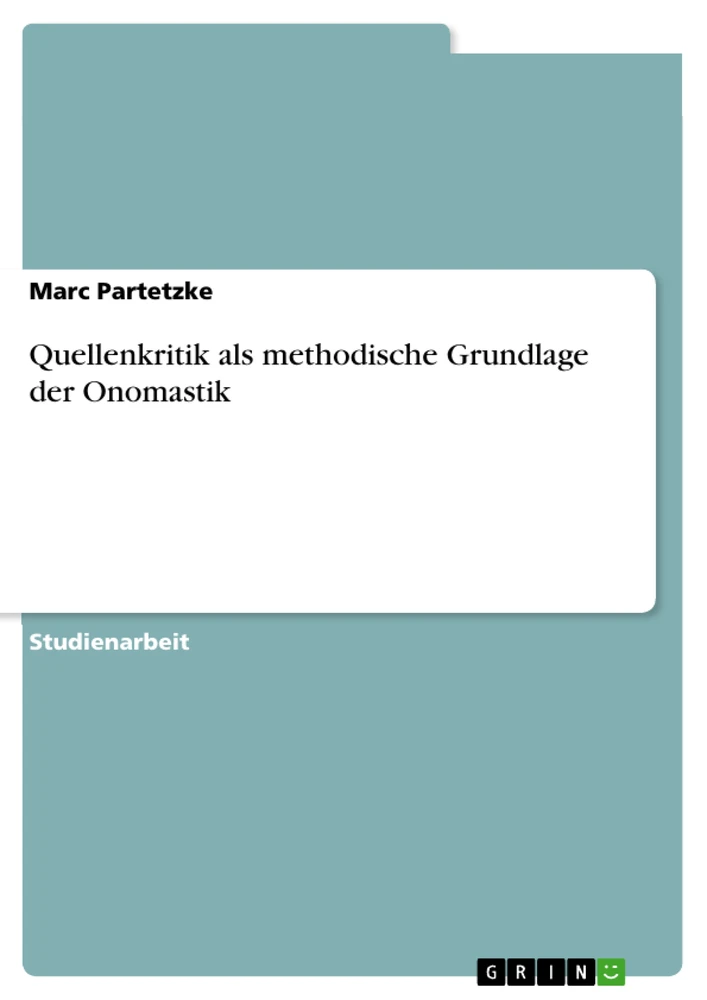Ach, wie gut, daß niemand weiß, daß ich Rumpelstielzchen heiß. – So trivial dieser Ausspruch eines fiktiven Wesens Grimmscher Märchen zunächst anmuten mag, so evident wird sein Inhalt im Zusammenhang mit onomastischen Fragestellungen. Denn wer einen Namen kennt, hat im Umkreis magischen Denkens auch Macht über das damit Benannte. Doch auch jenseits eines fiktionalen Bewusstseins erfüllten und erfüllen nomina propria schon immer auch gesellschaftliche und damit nicht-fiktionale Funktionen, beispielsweise solche der Identifikation und/ oder solche der Regulation sozialer Interaktionen.
Vor diesem Hintergrund erscheint es deshalb wenig zweifelhaft, dass sich die Onomastik auch in einer diachronen Zugangsweise den Namen unserer Vorfahren mit dem Anspruch nähert, möglichst valide Aussagen bezüglich Wortbildung, Laut- und Formenlehre, Motivation, Entstehung, ge-schichtlicher Entwicklung, landschaftlicher Staffellung und/ oder sprachsoziologischer Schichtung usw. zu treffen.
Grundlage dieses Anspruchs ist jedoch zunächst die methodische und je nach Forschungsziel determinierte Akkumulation von Untersuchungsgegenständen, also von zu untersuchenden Namen. Dabei bedient sich die Onomastik verschiedener Verfahren, die in einem Abschnitt dieser Arbeit differenzierter dargestellt werden sollen.
Um aber jene weiter oben bereits angesprochenen validen Aussagen hinsichtlich der Untersuchungsgegenstände treffen zu können, bedarf es in erster Linie einer kritischen Überprüfung der vorliegenden Namen und damit der zu analysierenden Quellen. Schließlich ist u.a. von Belang, welche Art der Textquelle (z.B. Original, Vorakte, Kopie, Skizze usw.) vorliegt, welcher Provenienz und Pertinenz selbige ist, was über die Qualität und Herkunft der Schreiber ausgesagt und schließlich, welche Datierung der Quelle vorgenommen werden kann. Diese Überprüfung kann und muss die Quellenkritik – ursprünglich eine Hilfswissenschaft der Geschichtswissen-schaft – leisten, deren Verfahren hier ganz im Zentrum steht. Dabei wird sich insbesondere auf die Positionen RUDOLF SCHÜTZEICHELs, INGO REIFFENSTEINs und HARRY BRESSLAUs bezogen.
Anzumerken ist an dieser Stelle, dass auch die Kapitel vor dem entsprechend explizit ausgewiesenem zur Quellenkritik bereits implizit den hier zu Debatte stehenden Inhalt behandeln. Im vierten Kapitel der vorliegenden Ausarbeitung sollen daher einige ausgewählte Beispiele dazu dienen, die quellenkritische Arbeit am konkreten Fall zu verdeutlichen...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Stellung der Onomastik innerhalb der universitären Disziplinen und ihre Bezugswissenschaften
- Namensammlung (als Grundlage quellenkritischer Arbeit)
- Die Urkunde - Fundus für die Onomastik
- Probleme beim Umgang mit Archivalien (als Teil quellenkritischer Arbeit)
- Quellenkritik und Namenforschung
- Quellenkritik im weiteren Sinn
- Quellenkritik im engeren Sinn
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Quellenkritik für die Onomastik. Ziel ist es, die methodischen Grundlagen der Namenforschung im Hinblick auf die kritische Auseinandersetzung mit den Quellen zu beleuchten und aufzuzeigen, wie valide Aussagen über die Entstehung, Entwicklung und Bedeutung von Personennamen getroffen werden können. Die Arbeit bezieht sich dabei auf relevante Positionen führender Onomastiker.
- Stellung der Onomastik innerhalb der universitären Disziplinen und ihre Bezugswissenschaften
- Methoden der Namensammlung und die Herausforderungen im Umgang mit Archivalien
- Quellenkritik als methodische Grundlage der Onomastik (im weiteren und engeren Sinn)
- Interdisziplinarität der Onomastik
- Bedeutung von Quellenkritik für valide Aussagen in der Onomastik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Quellenkritik in der Onomastik ein und verdeutlicht die Bedeutung von Namen über den rein beschreibenden Aspekt hinaus, indem sie deren gesellschaftliche und magische Funktionen beleuchtet. Sie führt das methodische Vorgehen der Arbeit an und hebt die zentrale Rolle der Quellenkritik für valide onomastische Aussagen hervor. Die Arbeit fokussiert sich auf die Positionen von Rudolf Schützeichel, Ingo Reiffenstein und Harry Bresslau.
Zur Stellung der Onomastik innerhalb der universitären Disziplinen und ihre Bezugswissenschaften: Dieses Kapitel skizziert die Entwicklung der Onomastik als relativ junge wissenschaftliche Disziplin in Deutschland, beginnend mit Ernst Förstemann und Adolf Bach. Es betont die Interdisziplinarität der Namenforschung, die Verbindungen zu verschiedenen Wissenschaftsbereichen wie Geschichtswissenschaften, Geowissenschaften, Rechtswissenschaft und Sprachwissenschaft aufzeigt. Die zunehmende Bedeutung onomastischer Erkenntnisse für die Lösung linguistischer Probleme wird hervorgehoben, sowie die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Onomastik in der sprachwissenschaftlichen Ausbildung.
Namensammlung (als Grundlage quellenkritischer Arbeit): Dieser Abschnitt befasst sich mit der praktischen Sammlung von Namen als Grundlage der onomastischen Forschung. Die Urkunde wird als wichtiger Fundus für die Onomastik vorgestellt, gleichzeitig werden die Probleme im Umgang mit Archivalien und die damit verbundenen Herausforderungen der Quellenkritik im Detail erläutert. Die Komplexität der Arbeit mit historischen Quellen, die verschiedenen Quellenarten und deren jeweilige Zuverlässigkeit, werden thematisiert.
Quellenkritik und Namenforschung: Dieses Kapitel widmet sich der Quellenkritik als zentrale Methode der Onomastik. Es unterscheidet zwischen Quellenkritik im weiteren und engeren Sinn, wobei der Schwerpunkt auf der kritischen Überprüfung der Quellen hinsichtlich ihrer Art, Herkunft, Qualität und Datierung liegt. Es analysiert, wie die Erkenntnisse der Quellenkritik angewendet werden können, um genaue und valide Aussagen über die untersuchten Namen treffen zu können. Konkrete Beispiele verdeutlichen die quellenkritische Arbeit am konkreten Fall.
Schlüsselwörter
Quellenkritik, Onomastik, Namenforschung, Personennamen, Toponyme, Anthroponyme, Namensammlung, Archivalien, Urkunden, Linguistik, Interdisziplinarität, Methodologie, Wortbildung, Lautlehre, Formenlehre, Geschichte der deutschen Sprache.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Quellenkritik in der Onomastik
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments?
Das Dokument behandelt die Bedeutung der Quellenkritik für die Onomastik (Namenforschung). Es beleuchtet die methodischen Grundlagen der Namenforschung im Hinblick auf den kritischen Umgang mit Quellen und zeigt, wie valide Aussagen über Entstehung, Entwicklung und Bedeutung von Personennamen getroffen werden können.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument umfasst die Stellung der Onomastik innerhalb der universitären Disziplinen und ihrer Bezugswissenschaften, Methoden der Namensammlung und Herausforderungen beim Umgang mit Archivalien, Quellenkritik als methodische Grundlage (im weiteren und engeren Sinn), die Interdisziplinarität der Onomastik und die Bedeutung von Quellenkritik für valide onomastische Aussagen. Es werden dabei die Positionen führender Onomastiker wie Rudolf Schützeichel, Ingo Reiffenstein und Harry Bresslau berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument enthält eine Einleitung, ein Kapitel zur Stellung der Onomastik, ein Kapitel zur Namensammlung als Grundlage quellenkritischer Arbeit, ein Kapitel zur Quellenkritik und Namenforschung und ein Fazit (Zusammenfassung der Kapitel).
Wie wird die Namensammlung beschrieben?
Die Namensammlung wird als Grundlage der onomastischen Forschung dargestellt. Die Urkunde wird als wichtiger Fundus vorgestellt, gleichzeitig werden die Probleme im Umgang mit Archivalien und die damit verbundenen Herausforderungen der Quellenkritik detailliert erläutert. Die Komplexität der Arbeit mit historischen Quellen, verschiedene Quellenarten und deren Zuverlässigkeit werden thematisiert.
Was versteht das Dokument unter Quellenkritik?
Das Dokument unterscheidet zwischen Quellenkritik im weiteren und engeren Sinn. Der Schwerpunkt liegt auf der kritischen Überprüfung der Quellen hinsichtlich ihrer Art, Herkunft, Qualität und Datierung. Es wird analysiert, wie die Erkenntnisse der Quellenkritik angewendet werden können, um genaue und valide Aussagen über die untersuchten Namen zu treffen.
Welche Bezugswissenschaften werden genannt?
Das Dokument nennt Verbindungen der Onomastik zu Geschichtswissenschaften, Geowissenschaften, Rechtswissenschaft und Sprachwissenschaft. Die zunehmende Bedeutung onomastischer Erkenntnisse für die Lösung linguistischer Probleme und die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Onomastik in der sprachwissenschaftlichen Ausbildung werden hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Quellenkritik, Onomastik, Namenforschung, Personennamen, Toponyme, Anthroponyme, Namensammlung, Archivalien, Urkunden, Linguistik, Interdisziplinarität, Methodologie, Wortbildung, Lautlehre, Formenlehre, Geschichte der deutschen Sprache.
Wer sind die wichtigsten zitierten Onomastiker?
Die Arbeit bezieht sich auf die Positionen von Rudolf Schützeichel, Ingo Reiffenstein und Harry Bresslau.
Welche Methode wird im Dokument besonders hervorgehoben?
Die Quellenkritik wird als zentrale Methode der Onomastik hervorgehoben.
Was ist das Ziel des Dokuments?
Ziel ist es, die methodischen Grundlagen der Namenforschung im Hinblick auf die kritische Auseinandersetzung mit den Quellen zu beleuchten und aufzuzeigen, wie valide Aussagen über die Entstehung, Entwicklung und Bedeutung von Personennamen getroffen werden können.
- Quote paper
- Marc Partetzke (Author), 2008, Quellenkritik als methodische Grundlage der Onomastik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/86543