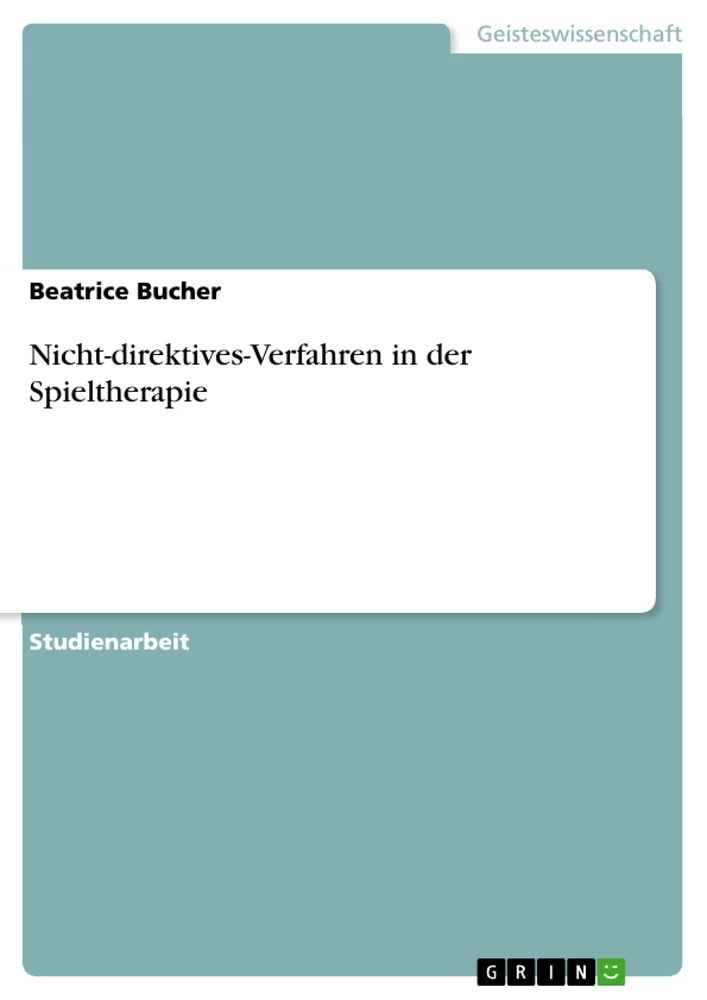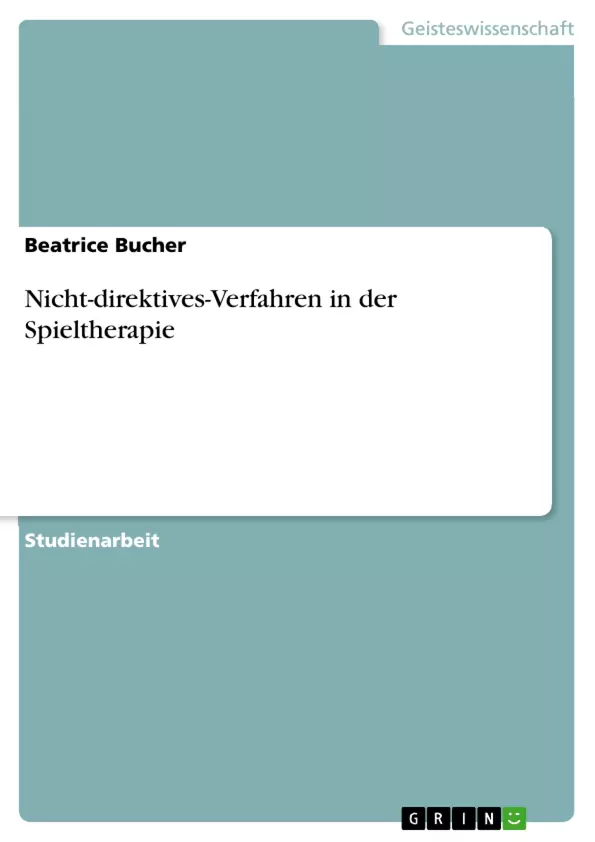Der nicht-direktiven Spieltherapie liegen die Grundgedanken von Rogers über das Individuum und die sich daraus entwickelte Persönlichkeitsstruktur zugrunde.
Nach Rogers liegt jedem Organismus die Tendenz einer konstruktiven Erfüllung seiner innerlichen Möglichkeiten zugrunde. Der Mensch hat ein natürliches Verlangen nach Entfaltung, die sogenannte Selbstverwirklichungstendenz. Virginia Axeline geht bei ihrem auf Rogers aufbauenden Persönlichkeitsstruktur davon aus, dass alle Erfahrungen, jede Haltung und unsere Gedanken das Individuum ständig verändern. Das angewandte nicht-direktive Verfahren in der Spieltherapie kann eine Gelegenheit für das Kind darstellen, Wachstums- und Reifungshilfe unter günstigeren Bedingungen zu erfahren. Dabei wird das Spiel als das natürliche Medium der Selbstdarstellung des Kindes genutzt, Frustration, Unsicherheit, Angst, Aggression oder Verwirrung „auszuspielen“. Wichtige Punkte dabei für ein wachstumsförderndes Klima liegen in der Person des Therapeuten, der mit seiner eigenen Person und seiner bedingungslosen Zuwendung und Akzeptanz, eine therapeutische Beziehung herstellt.
Gerade diese Beziehung spielt im Verlauf der Therapie eine zentrale Rolle. Sie ist nicht nur Beiwerk spezifischer Interventionsmethoden sondern bildet den Nährboden für die angestrebten Zielprozesse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gedanken zum Individuum Carl Rogers
- Wachstumsförderndes Klima
- Echtheit - Unverfälschtheit – Kongruenz
- Akzeptanz- bedingungslose positive Zuwendung
- Einfühlsames Verstehen
- Die nichtdirektive Spieltherapie
- Zugrundeliegende Persönlichkeitsstruktur
- Die nicht-direktive Therapie
- Angewandte nicht-direktives Verfahren in der Spieltherapie
- Die acht Grundprinzipien die Therapeuten im Nicht-direktiven Verfahren anwenden sollte
- Der Fall Dibs
- Begegnung in der ersten Stunde
- Weiterentwicklung von Dibs im Laufe der Therapie
- Anspruch an den Therapeuten
- Ziel personenzentrierter Kinderpsychotherapie
- Therapeutische Beziehung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet das Konzept der nichtdirektiven Spieltherapie und ihre Grundlagen im personenzentrierten Ansatz von Carl Rogers. Die Arbeit analysiert die Entstehung und Entwicklung dieses Verfahrens, insbesondere in Bezug auf die Spieltherapie, und untersucht die wichtigsten Grundprinzipien und Anforderungen an den Therapeuten.
- Das Konzept der nichtdirektiven Spieltherapie
- Die Grundprinzipien des personenzentrierten Ansatzes von Carl Rogers
- Die Bedeutung des Wachstumsfördernden Klimas in der therapeutischen Beziehung
- Die Rolle des Spiels als therapeutisches Instrument
- Die Anforderungen an den Therapeuten in der nichtdirektiven Spieltherapie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der nichtdirektiven Spieltherapie ein und erläutert die Unterschiede zu anderen therapeutischen Ansätzen. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Carl Rogers' Gedanken zum Individuum und seiner Selbstverwirklichungstendenz. Im dritten Kapitel werden die drei Elemente eines wachstumsfördernden Klimas beschrieben: Echtheit, Akzeptanz und Einfühlsames Verstehen. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den grundlegenden Prinzipien der nichtdirektiven Spieltherapie und deren Anwendung.
Der Fall Dibs im sechsten Kapitel zeigt die Anwendung der nichtdirektiven Spieltherapie anhand eines konkreten Beispiels. Das siebte Kapitel behandelt die Anforderungen an den Therapeuten in der personenzentrierten Kinderpsychotherapie, insbesondere die Bedeutung der therapeutischen Beziehung.
Schlüsselwörter
Nichtdirektive Spieltherapie, Carl Rogers, Personenzentrierter Ansatz, Wachstumsförderndes Klima, Echtheit, Akzeptanz, Einfühlsames Verstehen, Spieltherapie, Therapeutenrolle, Therapeutische Beziehung.
- Quote paper
- Beatrice Bucher (Author), 2005, Nicht-direktives-Verfahren in der Spieltherapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/85754