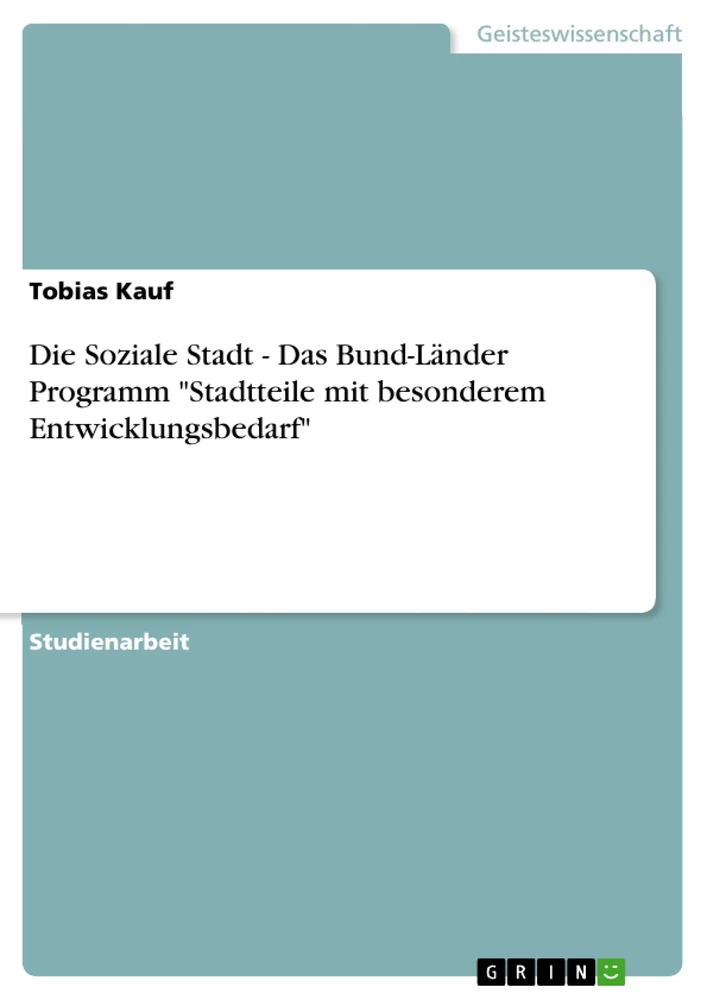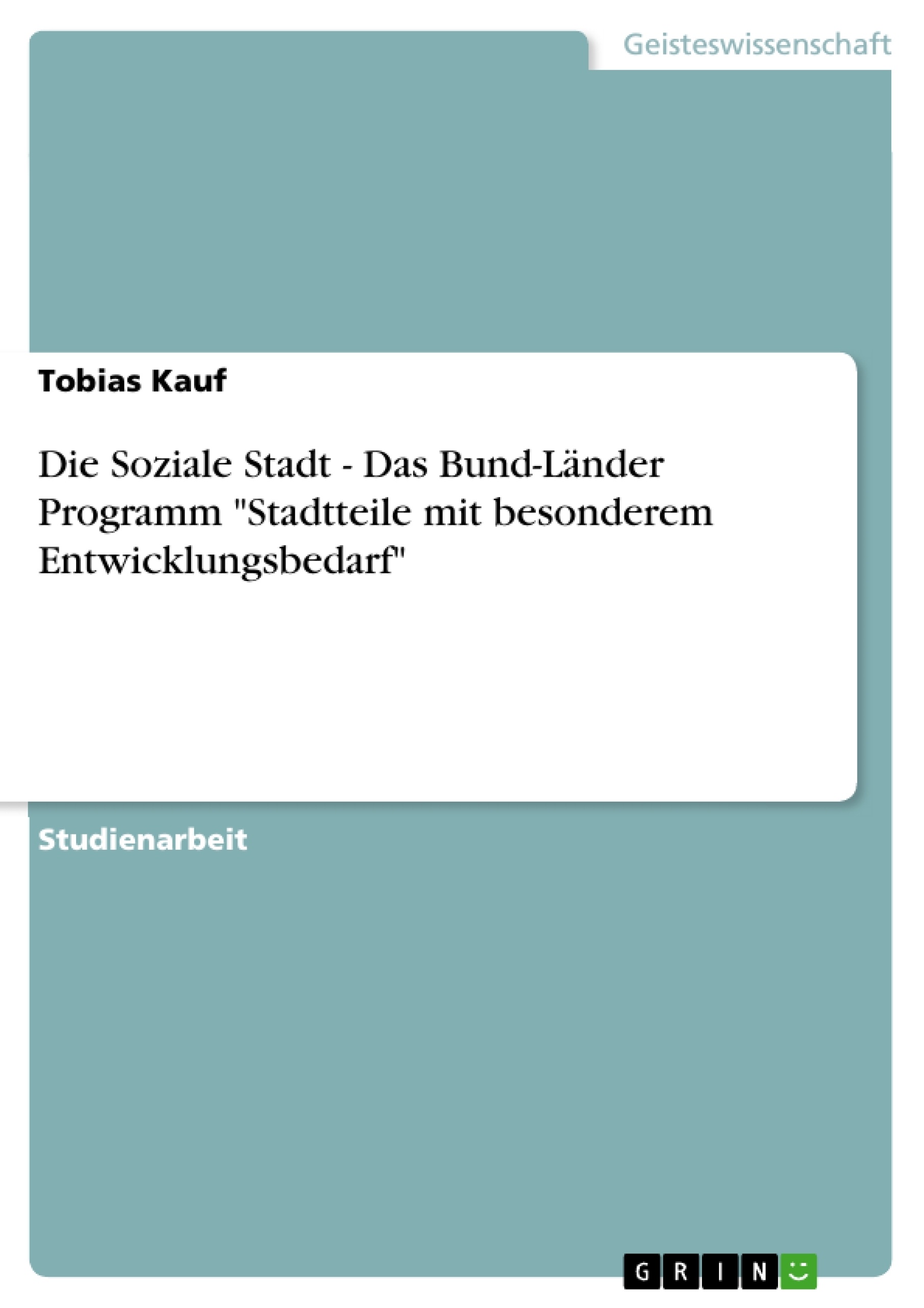In Deutschland zeichnet sich seit den 1980er und 1990er Jahren eine zunehmende Polarisierung der sozialen Schichten ab, welche sich auch räumlich manifestiert. Gegenwärtige Fragen der Stadtentwicklung beschäftigen sich insbesondere mit Arbeitsmarktproblemen, Zuwanderung und „neuer Armut“. Durch Segregation entstehen Stadtteile mit homogenen Bevölkerungsgruppen, sei es auf sozialer oder ethnischer Ebene. Dieses Phänomen ist zwar seit der Existenz städtischer Siedlungsformen vorhanden, jedoch können in Deutschland immer größere Tendenzen der eben genannten „neuen Armut“ und der sozialen Exklusion beobachtet werden. Neu an dieser Situation ist, dass diese soziale und räumliche Isolation inmitten eines bisher unbekannten gesellschaftlichen Wohlstandes stattfindet. War den armen Bevölkerungsteilen während der Industrialisierung der gesellschaftliche Aufstieg möglich, scheint die heutige Armutsbevölkerung vom gesellschaftlichen Wohlstand abgekoppelt und gegenseitige – seien es familiäre oder nachbarschaftliche – Hilfeleistungen den Gefühlen von Misstrauen und gegenseitiger Schuldzuweisung gewichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erscheinungsformen und Ursachen des Umbruchs in der Großstadtentwicklung
- Umbruch der Ökonomie und Polarisierung der Arbeitsmärkte
- Soziodemographischer Wandel und wachsende soziale Polarisierung
- Wohnungsmarkt, Wohnungspolitikentwicklung und die „Stadtentwicklung für die Starken“
- Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf
- Innerstädtische oder innenstadtnahe Quartiere mit nicht modernisierter Bausubstanz und unterdurchschnittlicher Umweltqualität
- Trabantensiedlungen in städtischen Randlagen und Wohnsiedlungen der abgezogenen Streitkräfte
- Das Bund-Länder Programm „Die Soziale Stadt“
- Allgemeine Ziele und Zielumsetzung
- Zwischenbilanz des Programms
- Die Mainzer Neustadt
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ und dessen Zielsetzung, soziale Spannungen in benachteiligten Stadtvierteln zu reduzieren.
- Ursachen der Segregation in Großstädten und die Entstehung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf
- Der Wandel der Ökonomie und die Polarisierung der Arbeitsmärkte als Treiber der sozialen Ausgrenzung
- Das Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“ als Instrument zur Stadtentwicklung und Bekämpfung sozialer Ungleichheit
- Die Analyse der Zielsetzung, der Akteure und der Zwischenbilanz des Programms
- Die Mainzer Neustadt als Beispiel für einen Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der zunehmenden sozialen Polarisierung und Segregation in deutschen Städten dar, die sich auch räumlich manifestiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf und den Ursachen für diese Entwicklung.
Das zweite Kapitel beleuchtet den Wandel der Großstadtentwicklung, insbesondere den Umbruch der Ökonomie und die Polarisierung der Arbeitsmärkte. Hier werden auch die Auswirkungen des soziodemographischen Wandels auf die soziale Polarisierung betrachtet.
Kapitel drei fokussiert auf die Charakteristika von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf, indem es zwei exemplarische Typen von Stadtvierteln beleuchtet: innerstädtische Quartiere mit nicht modernisierter Bausubstanz und Trabantensiedlungen in städtischen Randlagen.
Kapitel vier befasst sich mit dem Bund-Länder-Programm „Die Soziale Stadt“. Hier werden die allgemeinen Ziele und die Zielumsetzung des Programms sowie die Zwischenbilanz auf Bundesebene erläutert.
Schlüsselwörter
Soziale Stadt, Segregation, Stadtentwicklung, soziale Polarisierung, Armut, Arbeitsmarkt, Wohnungspolitik, Stadtentwicklungsprogramm, Bund-Länder-Programm, Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf, Mainzer Neustadt.
- Arbeit zitieren
- Tobias Kauf (Autor:in), 2007, Die Soziale Stadt - Das Bund-Länder Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/85191