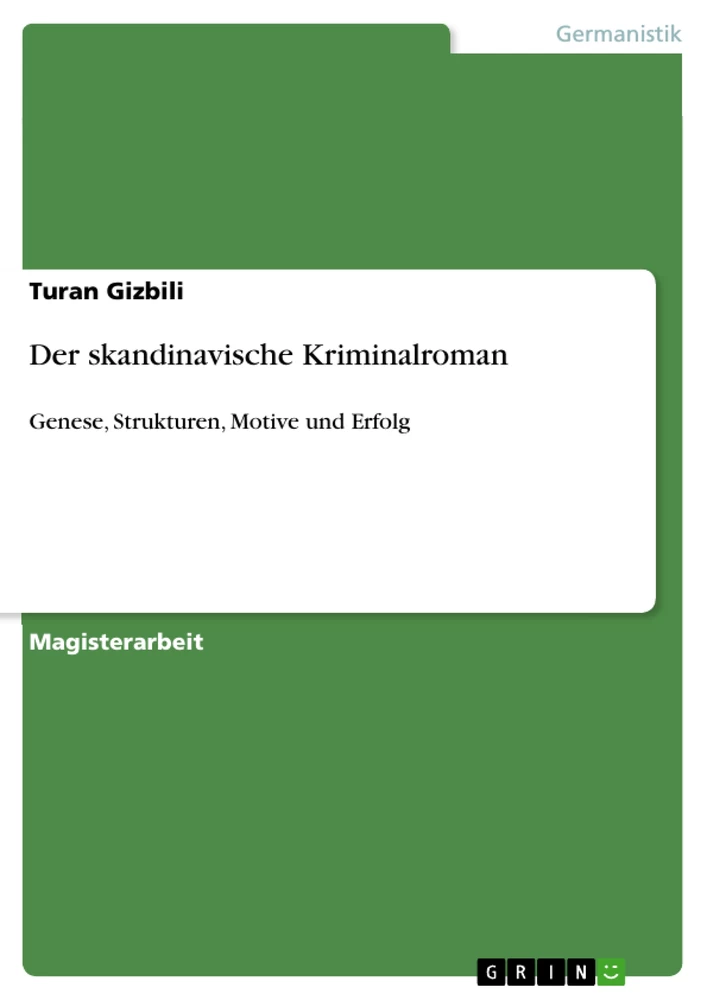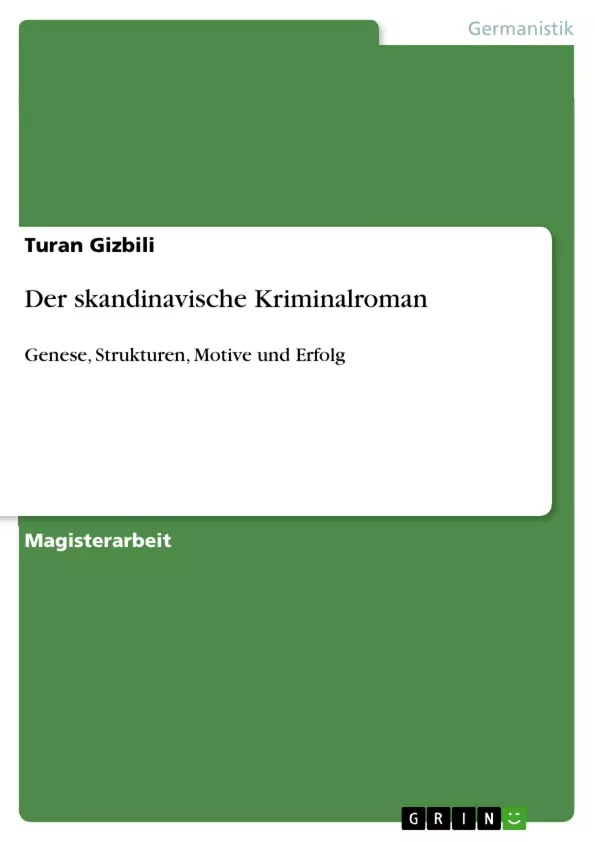Diese Arbeit hier nimmt sich mehrerer Fragestellungen hinsichtlich des Phänomens des skandinavischen Kriminalromans an. So wird untersucht, in wie weit der skandinavische Krimi sich sozialkritischer Themen annimmt und wie diese Motive literarisch verarbeitet werden. Struktur- und Handlungsmuster werden zuerst dargelegt, dann werden diese Motive anschließend mittels meist sozialanthropologischer/ethnographischer Studien auf ihren „Wahrheitsgehalt“ geprüft. Denn wenn der skandinavische Krimi ein sozialkritischer Krimi ist, müssen seine Motive mit gesellschaftlichen Problemen in der ‚Realität’ korrelieren und korrespondieren. Die sozialanthropologischen Ansätze haben den großen Vorteil, dass sie individuelle Verhaltensweisen in sozialen und kulturell spezifischen Rahmen aufzeigen und deuten, ohne in ein ‚Psychologisieren’ oder ins Fahrwasser gefährlich- pauschalisierender Mentalitätsschemata zu geraten. Und gegenüber rein soziologischen Studien haben sie den Vorteil, dass sie weder zu statisch, noch zu abgehoben vom Individuellen, vom Menschen sind.
Doch zuerst wird eine kleine Geschichte des skandinavischen Krimis zeigen, wie sehr sich diese Literatur aus angelsächsischer Tradition gelöst hatte, um dann ihr heutiges Gesicht zu erlangen, wofür maßgeblich die wahren ‚Eltern’ dieser Literatur, Maj Sjöwall und Per Wahlöö, verantwortlich sind. Kurz werden deshalb auch zwei ihrer Romane, „Der Mann, der sich in Luft auflöste“ und „Das Ekel aus Säffle“ vorgestellt und analysiert.
Der beeindruckende Erfolg der Mordgeschichten aus dem Norden hat sicherlich mehrere Gründe. Zum einen gibt es in Norwegen und Schweden eine hervorragende staatliche Autorenförderung, denn darf man trotz aller Rahmenbedingungen eines nicht aus dem Blick verlieren: das Buch, bzw. seine Qualität, die Fähigkeit des Autors, seine Leser zu begeistern, schließlich und abschließend für die Arbeit aber auch die positive Reputation, über die Skandinavien in Deutschland generell verfügt. Zu guter Letzt wird der „Nordland-Mythos“ beschrieben, die lange Tradition, die Verklärung des Nordens, sein positives Image über Ideologie- und Altersgrenzen hinweg in den deutschen Köpfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Wurzeln der skandinavischen Kriminalliteratur
- 2.1. Sjöwall/Wahlöö: Der Mann, der sich in Luft auflöste
- 2.2. Sjöwall/Wahlöö: Das Ekel aus Säffle
- 2.3. Sjöwall/Wahlöö: Schöpfer des Schwedenkrimis
- 3. Karin Fossum, Stumme Schreie
- 3.1. Kurze Inhaltsangabe
- 3.2. Inhalts- und Strukturanalyse
- 3.2.1. Figuren und Milieu
- 3.2.1.1. Konrad Sejer
- 3.2.1.2. Jacob Skarre
- 3.2.1.3. Gunder Jomann
- 3.2.1.4. Poona Bai
- 3.2.1.5. Gøran Seter
- 3.2.1.6. Das Dorf Elvestad und seine Bewohner
- 3.2.1. Figuren und Milieu
- 3.3. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Norwegen. Realer Hintergrund und literarisches Motiv in „Stumme Schreie“
- 3.4. Das Selbstbild Norwegens – Über die Konstruktion von Wirklichkeit
- 4. Åke Edwardson, Die Schattenfrau
- 4.1. Kurze Inhaltsangabe
- 4.2. Inhalts- und Strukturanalyse
- 4.2.1. Figuren und Milieu
- 4.2.1.1. Eric Winter
- 4.2.1.2. Fredrik Halders
- 4.2.1.3. Helene und Jenny Andersen
- 4.2.1.4. Göteborg
- 4.2.1. Figuren und Milieu
- 4.3. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Schweden. Realer Hintergrund und literarisches Motiv in „Die Schattenfrau“
- 4.4. Das schwedische Selbstbild
- 5. Gunnar Staalesen, Im Dunkeln sind alle Wölfe grau
- 5.1. Kurze Inhaltsangabe
- 5.2. Inhalts- und Strukturanalyse
- 5.2.1. Privatdetektiv und Milieu
- 5.2.1.1. Varg Veum
- 5.2.1.2. Bergen
- 5.2.1. Privatdetektiv und Milieu
- 5.3. Der Wohlfahrtsstaat in der Krise
- 5.4. Das norwegische Gesundheitssystem
- 5.5. Vergangenheitsbewältigung im Krimi: Norwegen unter dem Hakenkreuz
- 6. Der skandinavische Kriminalroman in der Tradition des sozialen Realismus
- 7. Der „Nordland-Mythos“
- 8. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den skandinavischen Kriminalroman, seine Genese, Strukturen, Motive und seinen Erfolg. Es wird analysiert, inwieweit sozialkritische Themen behandelt werden und wie diese literarisch verarbeitet sind. Die Untersuchung basiert auf einer vergleichenden Analyse ausgewählter Romane und der Überprüfung der dargestellten Motive anhand sozialanthropologischer Studien.
- Entwicklung und Geschichte des skandinavischen Kriminalromans
- Analyse der sozialkritischen Motive in ausgewählten Romanen
- Vergleich der Struktur und des Stils verschiedener skandinavischer Krimis
- Beziehung zwischen literarischen Motiven und gesellschaftlichen Realitäten
- Der "Nordland-Mythos" und sein Einfluss auf die Darstellung Skandinaviens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den enormen Erfolg skandinavischer Kriminalromane im deutschsprachigen Raum und benennt einige der bekanntesten Autoren. Sie hebt die Popularität der Protagonisten hervor und erwähnt verschiedene Erklärungsansätze für den Erfolg dieser Literatur, wobei der Konsens auf dem sozialkritischen Aspekt liegt. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der sozialkritischen Themen und ihrer literarischen Verarbeitung an, sowie den Vergleich von Struktur- und Handlungsmustern mit gesellschaftlichen Realitäten mithilfe sozialanthropologischer Studien.
2. Die Wurzeln der skandinavischen Kriminalliteratur: Dieses Kapitel untersucht die Ursprünge des skandinavischen Kriminalromans und hebt die besondere Bedeutung von Maj Sjöwall und Per Wahlöö hervor, die als Wegbereiter des modernen Genres gelten. Es werden zwei ihrer Romane, "Der Mann, der sich in Luft auflöste" und "Das Ekel aus Säffle", kurz vorgestellt und analysiert, um die Entwicklung und die charakteristischen Merkmale der frühen skandinavischen Kriminalliteratur zu verdeutlichen. Die Analyse fokussiert auf die Herausbildung der spezifischen stilistischen und thematischen Elemente, die die nachfolgenden Autoren prägen sollten.
3. Karin Fossum, Stumme Schreie: Dieses Kapitel analysiert Karin Fossums Roman "Stumme Schreie". Die Zusammenfassung beinhaltet eine detaillierte Inhaltsanalyse, die Figuren und ihr soziales Umfeld, die Darstellung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Norwegen und die Konstruktion des norwegischen Selbstbildes im Roman. Die Analyse untersucht, wie Fossum gesellschaftliche Probleme in ihre narrative Struktur integriert und welche Rolle die atmosphärische Dichte spielt. Es wird eingegangen auf die spezifische Darstellung von Norwegen und seiner sozialen Gegebenheiten und wie diese in den Kriminalfall eingebunden sind. Die verschiedenen Handlungsstränge werden zu einem Gesamtbild zusammengefügt, das den Fokus auf die zentralen Themen des Romans legt.
4. Åke Edwardson, Die Schattenfrau: Ähnlich wie Kapitel 3, wird hier Åke Edwardsons "Die Schattenfrau" analysiert. Die Zusammenfassung umfasst eine detaillierte Inhaltsanalyse, die Figuren und ihr soziales Umfeld, die Darstellung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Schweden und die Konstruktion des schwedischen Selbstbildes im Roman. Es wird untersucht, wie Edwardson soziale und gesellschaftliche Probleme in seine narrative Struktur integriert und welche Rolle die atmosphärische Dichte spielt. Die Analyse beleuchtet die spezifischen Charakteristika des schwedischen Settings und wie diese in den Kriminalfall eingebunden sind, um ein umfassendes Bild des Romans zu vermitteln.
5. Gunnar Staalesen, Im Dunkeln sind alle Wölfe grau: Dieses Kapitel widmet sich Gunnar Staalesens Roman "Im Dunkeln sind alle Wölfe grau". Die Zusammenfassung enthält eine detaillierte Inhaltsanalyse, die Darstellung des Privatdetektivs Varg Veum und seines sozialen Umfelds in Bergen, sowie die thematische Auseinandersetzung mit dem Wohlfahrtsstaat in der Krise, dem norwegischen Gesundheitssystem und der Vergangenheitsbewältigung im Kontext der norwegischen Geschichte unter dem Naziregime. Es wird untersucht, wie Staalesen diese Themen in seine Geschichte integriert und welche Rolle sie für die Handlung spielen. Der Fokus liegt auf der Synthese der verschiedenen Handlungsebenen zu einem kohärenten Gesamtbild des Romans.
6. Der skandinavische Kriminalroman in der Tradition des sozialen Realismus: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Analyse, die den skandinavischen Kriminalroman im Kontext des sozialen Realismus betrachtet. Es werden die gemeinsamen sozialkritischen Themen, die in den vorher analysierten Romanen behandelt wurden, zusammenfassend dargestellt und in den größeren Kontext der skandinavischen Literaturtradition eingeordnet. Die Analyse wird die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Umgang mit Sozialkritik bei den verschiedenen Autoren beleuchten.
7. Der „Nordland-Mythos“: Dieses Kapitel befasst sich mit dem „Nordland-Mythos“ und seiner Darstellung in skandinavischen Kriminalromanen. Es untersucht, wie die Wahrnehmung Skandinaviens in diesen Romanen konstruiert und vermittelt wird und welche Rolle Klischees und Stereotypen dabei spielen. Die Analyse konzentriert sich auf die kulturellen und gesellschaftlichen Konnotationen des „Nordland-Mythos“ und seine Bedeutung für die Rezeption der skandinavischen Kriminalromane.
Schlüsselwörter
Skandinavischer Kriminalroman, Sozialkritik, Maj Sjöwall, Per Wahlöö, Karin Fossum, Åke Edwardson, Gunnar Staalesen, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Wohlfahrtsstaat, Norwegen, Schweden, Selbstbild, Identität, Melancholie, Atmosphäre, Sozialer Realismus, Nordland-Mythos, Vergangenheitsbewältigung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse Skandinavischer Kriminalromane
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert skandinavische Kriminalromane, ihre Entstehung, Strukturen, Motive und ihren Erfolg. Im Fokus steht die Untersuchung sozialkritischer Themen und deren literarische Umsetzung in ausgewählten Romanen von Maj Sjöwall/Per Wahlöö, Karin Fossum, Åke Edwardson und Gunnar Staalesen. Die Analyse vergleicht literarische Motive mit gesellschaftlichen Realitäten anhand sozialanthropologischer Studien und beleuchtet den "Nordland-Mythos".
Welche Romane werden analysiert?
Die Arbeit analysiert folgende Romane: "Der Mann, der sich in Luft auflöste" und "Das Ekel aus Säffle" von Maj Sjöwall/Per Wahlöö, "Stumme Schreie" von Karin Fossum, "Die Schattenfrau" von Åke Edwardson und "Im Dunkeln sind alle Wölfe grau" von Gunnar Staalesen.
Welche Themen werden in den Romanen behandelt und analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf sozialkritische Themen wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, die Krise des Wohlfahrtsstaates, das norwegische und schwedische Selbstbild, Vergangenheitsbewältigung (insbesondere im Kontext des Zweiten Weltkriegs) und die Konstruktion von Wirklichkeit. Die Rolle des "Nordland-Mythos" und dessen Einfluss auf die Darstellung Skandinaviens wird ebenfalls untersucht.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse der ausgewählten Romane. Die dargestellten Motive werden anhand sozialanthropologischer Studien überprüft. Die Analyse umfasst Inhalts- und Strukturanalysen, Figuren- und Milieu-Analysen sowie die Untersuchung der narrativen Strukturen und atmosphärischen Dichte.
Welche Autoren werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Autoren Maj Sjöwall und Per Wahlöö als Wegbereiter des Genres, sowie Karin Fossum, Åke Edwardson und Gunnar Staalesen als repräsentative Vertreter des modernen skandinavischen Kriminalromans.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Kapitel zur Genese des skandinavischen Kriminalromans, Einzelanalysen der ausgewählten Romane, ein Kapitel zum sozialen Realismus im skandinavischen Kontext, ein Kapitel zum "Nordland-Mythos" und einen Ausblick. Jedes Kapitel zu den einzelnen Romanen umfasst eine kurze Inhaltsangabe, eine Inhalts- und Strukturanalyse (inkl. Figuren- und Milieu-Analysen) und die Untersuchung relevanter sozialkritischer Motive.
Was ist der "Nordland-Mythos"?
Der "Nordland-Mythos" bezieht sich auf die romantisierte und oft klischeehafte Darstellung Skandinaviens in Literatur und Medien. Die Arbeit untersucht, wie diese Wahrnehmung in den analysierten Kriminalromanen konstruiert und vermittelt wird und welche Rolle Klischees und Stereotype dabei spielen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Skandinavischer Kriminalroman, Sozialkritik, Maj Sjöwall, Per Wahlöö, Karin Fossum, Åke Edwardson, Gunnar Staalesen, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Wohlfahrtsstaat, Norwegen, Schweden, Selbstbild, Identität, Melancholie, Atmosphäre, Sozialer Realismus, Nordland-Mythos, Vergangenheitsbewältigung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht den skandinavischen Kriminalroman, seine Genese, Strukturen, Motive und seinen Erfolg. Es wird analysiert, inwieweit sozialkritische Themen behandelt werden und wie diese literarisch verarbeitet sind. Der Vergleich der Struktur und des Stils verschiedener skandinavischer Krimis und die Beziehung zwischen literarischen Motiven und gesellschaftlichen Realitäten sind weitere Ziele.
- Arbeit zitieren
- M.A. Turan Gizbili (Autor:in), 2005, Der skandinavische Kriminalroman, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/85106