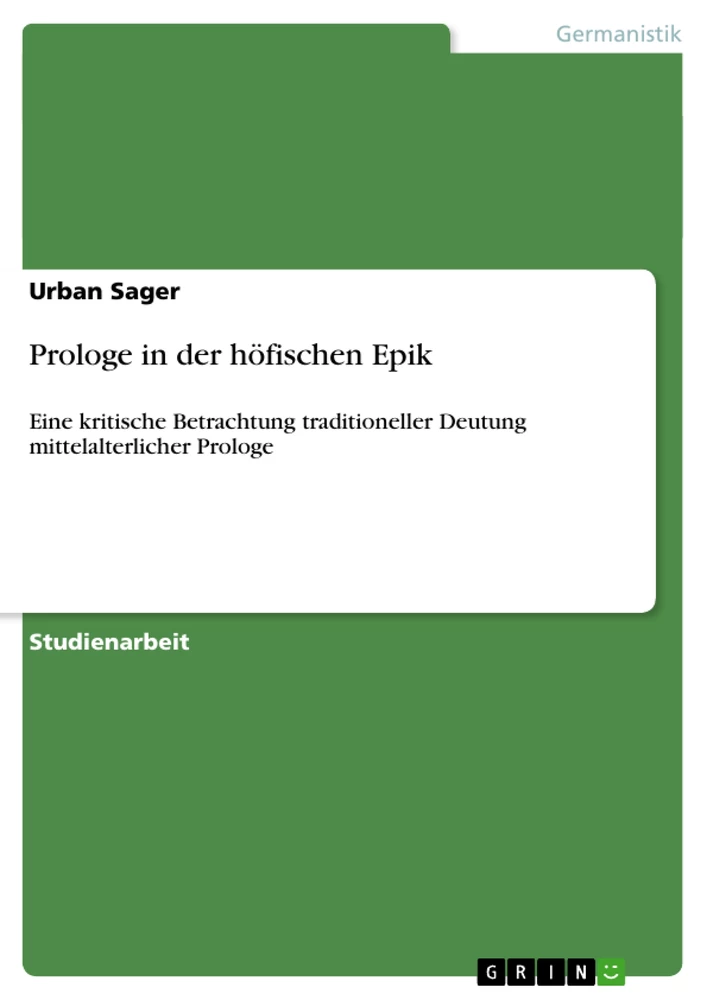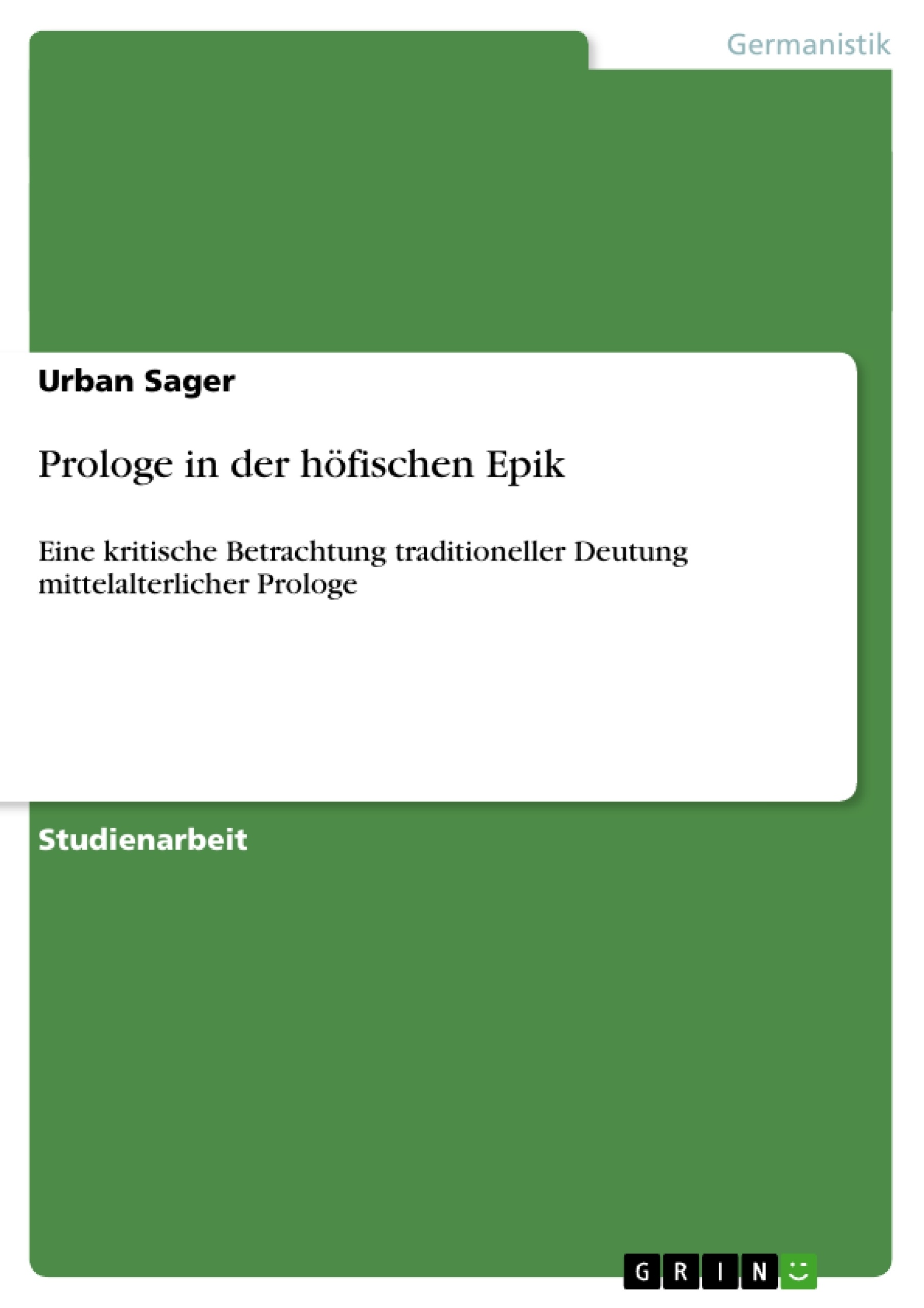Diese Arbeit befasst sich mit letzterer Problematik, dem Einfluss der antiken Rhetorik und der mittelalterlichen Poetiken auf das Verfassen von Prologen. Dabei geht es darum, den grundlegenden Beitrag zur Deutung mittelalterlicher Prologe, den Aufsatz Der Prolog im Mittelalter als literarische Erscheinung von Hennig Brinkmann vorzustellen, und ihn einer mithilfe der beiden Beiträge aus dem angelsächsischen Raum von Jaffe und Schultz , einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. Ziel ist es verschiedene Herangehensweisen an die Deutung mittelalterlicher Prologe aufzuzeigen, und die zur Allgemeingültigkeit erhobene These Brinkmanns in Frage zu stellen.
Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die exemplarische Darstellung des Tristan-Prologs von Gottfried von Strassburg, und zwar aus dem Grund, dass da die Kritik von Jaffe und Schultz ansetzt. In einem ersten Teil wird die These Brinkmanns mit Rückgriff auf die antike Rhetorik dargelegt. Im zweiten Teil werden die Kritikpunkte Jaffes und Schultzes ausgeführt und ihre alternativen Vorschläge zur Deutung des Tristan-Prologs vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Traditionelle Deutung der Prologe der höfischen Epik
- 2.1 Vertretbarkeitsrangstufen
- 2.2 Das exordium
- 2.2.1 attentum parare
- 2.2.2 docilem parare
- 2.2.3 benevolum parare
- 2.3 Bedeutung der antiken Rhetorik für den mittelalterlichen Prolog
- 2.4 Der Prolog in der mittelalterlichen Dichtung
- 2.5 Der Prolog zu Gottfrieds von Strassburg Tristan nach Brinkmann
- 3 Kritik an der traditionellen Deutung mittelalterlicher Prologe
- 3.1 Keine Prologe erwähnt
- 3.2 Keine insinuatio bei Tristan
- 3.3 Die mittelalterlichen Poetiken
- 3.4 Unklare Terminologie und spekulative Interpretationen
- 3.5 Zwei neue Betrachtungsweisen
- 4 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die traditionelle Deutung mittelalterlicher Prologe, insbesondere den Einfluss antiker Rhetorik und mittelalterlicher Poetiken auf deren Gestaltung. Sie präsentiert Hennig Brinkmanns Aufsatz "Der Prolog im Mittelalter als literarische Erscheinung" und analysiert kritisch seine These anhand von Beiträgen von Jaffe und Schultz. Das Ziel ist es, verschiedene Interpretationsansätze aufzuzeigen und die Allgemeingültigkeit von Brinkmanns These zu hinterfragen, wobei der Tristan-Prolog von Gottfried von Strassburg als Beispiel dient.
- Der Einfluss antiker Rhetorik auf mittelalterliche Prologe
- Kritik an Brinkmanns Deutung des Tristan-Prologs als Insinuatio
- Die Rolle mittelalterlicher Poetiken in der Prologgestaltung
- Alternative Interpretationsansätze für mittelalterliche Prologe
- Die Bedeutung der historischen Rhetorik für das Verständnis mittelalterlicher Prologe
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss antiker Rhetorik und mittelalterlicher Poetiken auf die Gestaltung mittelalterlicher Prologe vor. Sie führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung von Prologen als Ort des Dialogs zwischen Autor und Publikum sowie die kontroverse Interpretation ihrer Aussagen. Die Arbeit konzentriert sich auf Brinkmanns Aufsatz und die kritischen Beiträge von Jaffe und Schultz, um verschiedene Herangehensweisen an die Deutung mittelalterlicher Prologe aufzuzeigen und die These Brinkmanns zu hinterfragen, wobei der Tristan-Prolog als Beispiel dient.
2 Traditionelle Deutung der Prologe der höfischen Epik: Dieses Kapitel präsentiert Brinkmanns traditionelle Deutung, die den Einfluss antiker Rhetorik auf die Gestaltung mittelalterlicher Prologe betont. Es beschreibt die Konzepte der Vertretbarkeitsrangstufen, des Exordiums mit seinen Suchformeln (attentum, docilem, benevolum) und der Insinuatio. Es analysiert die Bedeutung der antiken Rhetorik für das Verständnis des mittelalterlichen Prologs als eine Art Exordium in der Kommunikation zwischen Autor und Publikum. Darüber hinaus wird die von Brinkmann postulierte Zweiteiligkeit des Prologs (Prooemium und Prologus) erläutert und am Beispiel des Tristan-Prologs illustriert. Der Fokus liegt auf der Übernahme rhetorischer Strategien zur Gewinnung der Lesersympathie.
3 Kritik an der traditionellen Deutung mittelalterlicher Prologe: Dieses Kapitel präsentiert die Kritik von Jaffe und Schultz an Brinkmanns traditioneller Deutung. Schultz argumentiert, dass die antike und mittelalterliche Rhetoriklehre sich nicht explizit mit dem Prolog schriftlicher Erzählungen befasste, und Brinkmanns Auswahl an Beispielen sei selektiv. Jaffe hinterfragt die Interpretation des Tristan-Prologs als Insinuatio im ciceronischen Sinne und präsentiert alternative Deutungsansätze, die stärker die historische Rhetorik einbeziehen. Das Kapitel beleuchtet die Unschärfen der Terminologie bei der Beschreibung der Prologstruktur und diskutiert alternative Vorschläge für die Klassifizierung und Interpretation von Prologen im Mittelalter.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Prologe, höfische Epik, antike Rhetorik, mittelalterliche Poetik, Brinkmann, Jaffe, Schultz, Tristan-Prolog, Insinuatio, Exordium, Interpretationsansätze, literarische Kommunikation, genus admirabile, artes poetriae.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse mittelalterlicher Prologe
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die traditionelle Deutung mittelalterlicher Prologe, insbesondere im Hinblick auf den Einfluss antiker Rhetorik und mittelalterlicher Poetiken. Sie untersucht kritisch die These von Hennig Brinkmann ("Der Prolog im Mittelalter als literarische Erscheinung") anhand des Tristan-Prologs von Gottfried von Strassburg und der Beiträge von Jaffe und Schultz.
Welche zentralen Fragen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die folgenden Fragen: Wie beeinflusste die antike Rhetorik die Gestaltung mittelalterlicher Prologe? Ist Brinkmanns Deutung des Tristan-Prologs als Insinuatio haltbar? Welche Rolle spielen mittelalterliche Poetiken in der Prologgestaltung? Gibt es alternative Interpretationsansätze für mittelalterliche Prologe? Wie wichtig ist die historische Rhetorik für das Verständnis mittelalterlicher Prologe?
Welche Autoren werden diskutiert?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Werke und Thesen von Hennig Brinkmann, sowie die kritischen Auseinandersetzungen von Jaffe und Schultz mit Brinkmanns Interpretation.
Welches Beispielwerk steht im Mittelpunkt der Analyse?
Der Prolog zu Gottfried von Strassburgs Tristan dient als zentrales Beispiel für die Analyse der verschiedenen Interpretationsansätze.
Welche Konzepte der antiken Rhetorik werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Konzepte wie Vertretbarkeitsrangstufen, das Exordium mit seinen Suchformeln (attentum, docilem, benevolum) und die Insinuatio.
Welche Kritikpunkte an Brinkmanns These werden vorgebracht?
Die Kritikpunkte zielen auf die selektive Auswahl von Beispielen durch Brinkmann, die mangelnde explizite Auseinandersetzung der antiken und mittelalterlichen Rhetoriklehre mit Prologen schriftlicher Erzählungen und die ungenaue Terminologie in der Beschreibung der Prologstruktur ab. Jaffe hinterfragt insbesondere die Interpretation des Tristan-Prologs als Insinuatio.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur traditionellen Deutung mittelalterlicher Prologe nach Brinkmann, ein Kapitel zur Kritik an dieser Deutung durch Jaffe und Schultz, und einen Schluss.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Mittelalterliche Prologe, höfische Epik, antike Rhetorik, mittelalterliche Poetik, Brinkmann, Jaffe, Schultz, Tristan-Prolog, Insinuatio, Exordium, Interpretationsansätze, literarische Kommunikation, genus admirabile, artes poetriae.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, verschiedene Interpretationsansätze für mittelalterliche Prologe aufzuzeigen und die Allgemeingültigkeit von Brinkmanns These zu hinterfragen.
- Arbeit zitieren
- Urban Sager (Autor:in), 2006, Prologe in der höfischen Epik, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/84764