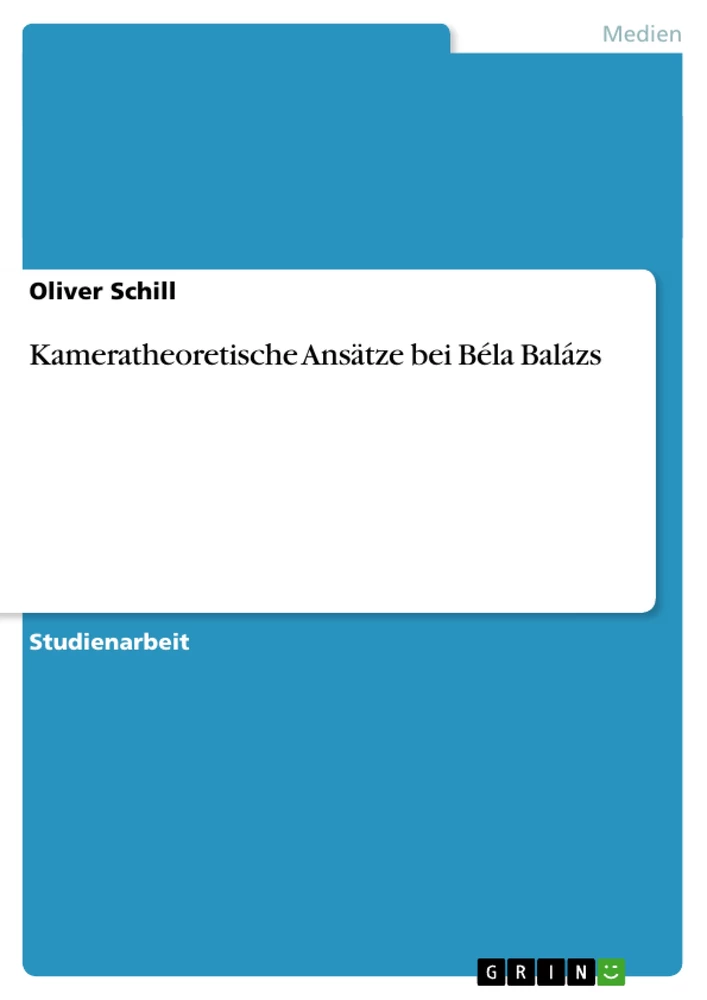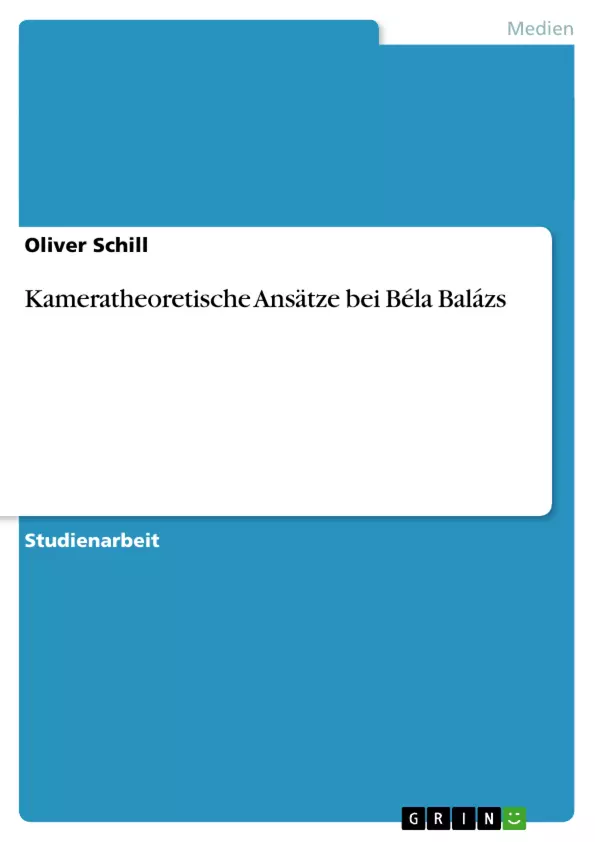Béla Balázs ist vor allem mit seinem Werk ‚Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films’ (1924) in die internationale Filmgeschichte eingegangen. Allerdings haben seine drei weiteren Bücher ‚Der Geist des Films’ (1930), ‚Kunst des Films’ (1938) und ‚Der Film. Werden und Wesen einer neuen Kunst’ (1949) ebenfalls eine wichtige Rolle im filmtheoretischen Diskurs gespielt.
‚Der sichtbare Mensch’ gilt als das Hauptwerk der Schauspieltheorie. Es fasst die teilweise ähnlichen Theorieansätze eines Herbert Tannenbaum, Walter Thielemann oder Urban Gad präzise zusammen und erweitert sie zu einer Schauspieltheorie - so zumindest laut Helmut H. Diederichs. Balázs Werk fand damals regen Absatz und gilt somit als „erste[r] große[r] filmtheoretische[r] Entwurf der Stummfilmzeit in deutscher Sprache“. (Loewy, Hanno: Die Geister Des Films. In Balázs, Béla: ‚Der Geist des Films’, Suhrkamp 2001. S. 172)
In ‚Der sichtbare Mensch’ finden sich nicht nur schauspieltheoretische Ansätze, sondern auch bereits Positionen Balázs zu Bilder- und Kameraführung. In der folgenden Arbeit soll es nun hauptsächlich um Béla Balázs Werk ‚Der Geist des Films’ gehen. Hier führt er seine bereits in ‚Der sichtbare Mensch’ angedeuteten kameraästhetischen Positionen weiter aus und vollzieht somit den Spagat zwischen dem Film als Kunst vor der Kamera hin zum Film als Kunst mit der Kamera.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einordnung von Balázs Werk in den filmtheoretischen Entwicklungsprozess
- Hartmut Bitomsky
- Franz-Josef Albersmeier
- Béla Balázs' Position im klassischen filmtheoretischen Diskurs
- Balázs' kameratheoretischen Ansätze
- Die Bilderführung (1924)
- Stilfilm, Filmstil und Stil überhaupt (1925)
- Produktive und reproduktive Filmkunst (1926)
- Béla vergisst die Schere (1926) - Debatten zwischen Balázs und Eisenstein
- Einstellung zur Einstellung (1929)
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Béla Balázs' Werk "Der Geist des Films" und analysiert dessen Bedeutung im filmtheoretischen Diskurs. Sie untersucht die Entwicklung seiner kameraästhetischen Ansätze, die er in "Der sichtbare Mensch" bereits andeutete, und setzt diese in den Kontext des filmtheoretischen Entwicklungsprozesses.
- Die Rolle von Béla Balázs' Werk im klassischen filmtheoretischen Diskurs
- Balázs' kameratheoretische Ansätze und deren Entwicklung
- Der Einfluss von Balázs' Werk auf die Filmtheorie und die Filmgeschichte
- Die Bedeutung der Großaufnahme in Balázs' Theorie
- Die Verbindung von Film und visueller Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt Béla Balázs und sein Werk "Der Geist des Films" vor, wobei insbesondere die Relevanz seines Hauptwerks "Der sichtbare Mensch" für die Schauspieltheorie hervorgehoben wird. Des Weiteren werden Balázs' Überlegungen zur Physiognomie und zur Großaufnahme im Film diskutiert.
- Einordnung von Balázs Werk in den filmtheoretischen Entwicklungsprozess: Dieser Abschnitt beleuchtet die verschiedenen Ansätze der Filmtheorie, insbesondere die von Hartmut Bitomsky, der die Entwicklung der Filmtheorie in drei Phasen unterteilt.
- Balázs' kameratheoretischen Ansätze: Dieser Abschnitt beleuchtet Balázs' Schriften über Bilderführung, Stilfilm und die produktive und reproduktive Filmkunst sowie die Debatte mit Eisenstein über die Einstellung zur Einstellung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Filmtheorie, Béla Balázs, "Der Geist des Films", Kameraästhetik, Großaufnahme, Physiognomie, Filmgeschichte, Filmsprache, Filmtheorie im Entwicklungsprozess, Stilfilm, Produktive und reproduktive Filmkunst, Einstellung zur Einstellung.
- Quote paper
- Oliver Schill (Author), 2005, Kameratheoretische Ansätze bei Béla Balázs, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/84645