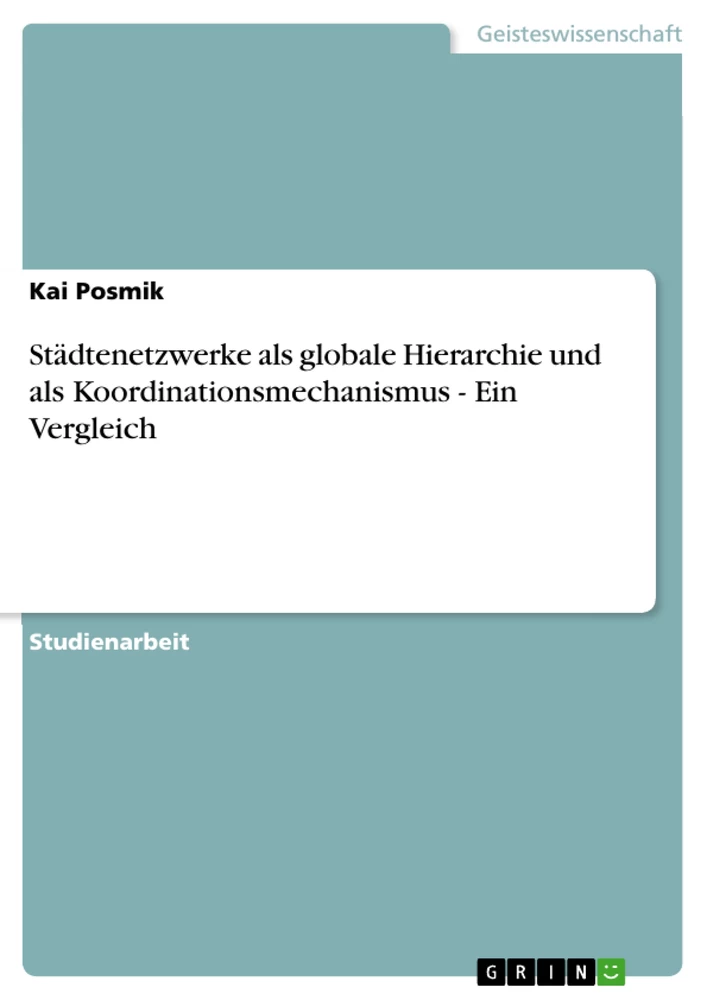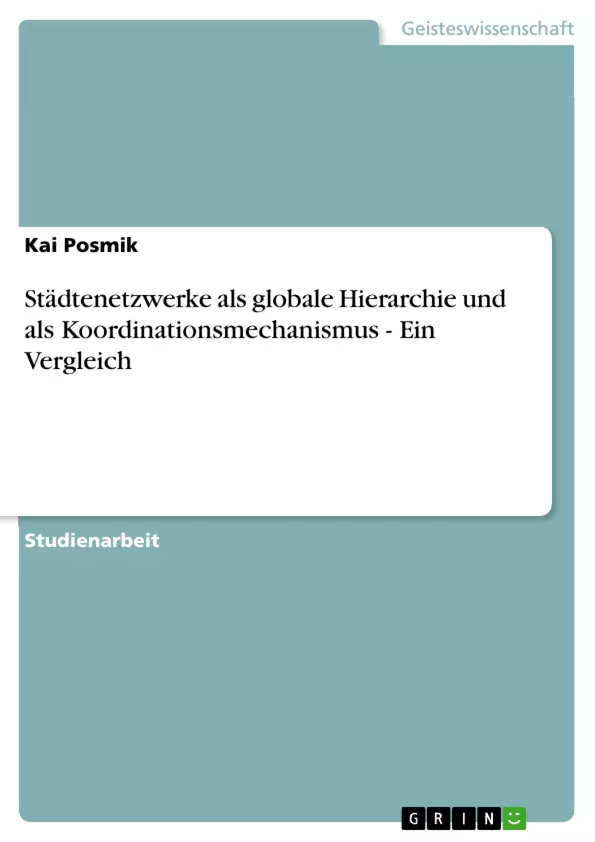Populär, inflationär, alltäglich – drei Worte, die bei der Charakterisierung des Siegeszuges eines Begriffes häufig zu vernehmen sind: Gemeint ist der des Netzwerkes. ‚Netzwerk’ als Begriff ist populär, weil er scheinbar so zutreffend gesellschaftliche Strukturen und Prozesse heutiger Zeit beschreibt. Wegen vielfältiger Einsatzmöglichkeiten kann tatsächlich gelegentlich der Eindruck inflationärer Verwendung entstehen und dies hängt auch mit dem dritten Merkmal zusammen, der inzwischen zu konstatierenden weitgehenden Alltäglichkeit des Begriffs. Vom Computer- bis zum Beziehungsnetzwerk, insbesondere innerhalb jüngerer Generationen ist ‚Netzwerk’ zumindest sprachlich zur Normalität geworden.
Eng verbunden ist die Konjunktur von ‚Netzwerk’ mit einem weiteren Begriff, der inzwischen zahlreiche gesellschaftliche und politische Diskurse prägt (um nicht zu sagen dominiert) – dem der Globalisierung. Allgemein kann Globalisierung als „auf die Ausweitung, auf die Zunahme und Ausdehnung der Verbindungen zwischen verschiedenen Regionen und/oder gesellschaftlichen Kontexten“ gerichtet verstanden werden. Demzufolge beschäftigen sich gerade Soziologie und Politikwissenschaft seit einiger Zeit damit, inwieweit Globalisierung eine Modifikation zentraler sozialwissenschaftlicher Kategorien und Perspektiven erfordert. Wenn in diesem Zusammenhang mögliche Umorientierungen in Bezug auf einen eher an Ökonomie, Politik und Kultur ausgerichteten Gesellschaftsbegriff diskutiert werden, so muss angesichts der im Verständnis von ‚Globalisierung’ inkludierten grenzüberschreitenden Interaktionen auch die Frage nach neuen Raumbezügen gestellt werden. „The concept of globalization represents an important shift in transmuting this temporality into a spatial framework.”
Insofern ist es dem Globalisierungsdiskurs mit zu verdanken, dass sich das bislang anzutreffende, der Geographie entlehnte chorische Denkmuster vom Raum als Objekt und als „Container“ von Gesellschaft auf dem Rückzug befindet. Schwerwiegende Auswirkungen hat diese De- und anschließende Rekonstruktion des bisherigen Raumverständnisses auf die Stadt als Objekt sozialwissenschaftlicher Reflexion.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Netzwerkbegriff in den Sozialwissenschaften
- Raum und Gesellschaft im Denken von Manuel Castells
- Die informationelle Gesellschaft
- Implikationen für die Stadtforschung
- Kritik: Empirische Evidenz und Reichweite der Überlegungen von Castells
- Stadt als transnationaler Akteur - Städtenetzwerke aus der Policy-Perspektive
- Netzwerk als Koordinationsmechanismus
- Chancen und Risiken von Städtenetzwerken
- Berlin als Knoten des Städtenetzwerkes METROPOLIS
- Schlussfolgerungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Rolle von Städtenetzwerken in der heutigen globalisierten Welt. Sie setzt sich zum Ziel, die Konzepte von Manuel Castells über Städtenetzwerke als globale Hierarchie mit einem aus der Policy-Forschung stammenden Verständnis von Netzwerken als Koordinationsmechanismen zu vergleichen.
- Die Bedeutung des Netzwerkbegriffs in den Sozialwissenschaften
- Castells' Theorie der informationellen Gesellschaft und ihre Implikationen für die Stadtforschung
- Kritik an Castells' Konzept von Städtenetzwerken als globale Hierarchie
- Städtenetzwerke als Koordinationsmechanismen und ihre potenziellen Chancen und Risiken
- Das Beispiel von Berlin als Knoten im Städtenetzwerk METROPOLIS
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den aktuellen Siegeszug des Netzwerkbegriffs in den Sozialwissenschaften dar und beleuchtet die enge Verbindung zwischen dem Netzwerkbegriff und dem Globalisierungsprozess. Insbesondere die De- und Rekonstruktion des Raumverständnisses durch den Globalisierungsprozess und die Bedeutung der Stadt als Objekt sozialwissenschaftlicher Reflexion werden hervorgehoben.
Der Netzwerkbegriff in den Sozialwissenschaften
Kapitel B widmet sich der historischen Entwicklung des Netzwerkbegriffs, beginnend mit Jakob Levy Moreno und seiner Soziometrie. Die Entwicklung der Netzwerkanalyse in verschiedenen Disziplinen wird erläutert, wobei insbesondere die Entstehung der "Social Network Analysis" in den 1970er Jahren im Fokus steht.
Raum und Gesellschaft im Denken von Manuel Castells
Kapitel C befasst sich mit den Ideen von Manuel Castells und seiner Theorie der informationellen Gesellschaft. Castells' Diagnosen zur informationellen Gesellschaft und die daraus resultierenden Implikationen für die Stadtforschung werden erörtert. Darüber hinaus wird eine kritische Auseinandersetzung mit Castells' Überlegungen hinsichtlich der empirischen Evidenz und der Reichweite seiner Erkenntnisse angestellt.
Stadt als transnationaler Akteur - Städte- netzwerke aus der Policy-Perspektive
Kapitel D beschäftigt sich mit der Perspektive der Policy-Analyse und den Möglichkeiten, Städte als Akteure in Netzwerken zu betrachten. Es werden die Chancen und Risiken von Städtenetzwerken als Koordinationsmechanismen diskutiert. Zum Abschluss des Kapitels wird die Stadt Berlin als Beispiel für ein Netzwerk von Städten vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Netzwerk, Globalisierung, Stadt, informationelle Gesellschaft, Castells, Policy-Forschung, Koordinationsmechanismus, Städtenetzwerk, Berlin, METROPOLIS.
- Arbeit zitieren
- Kai Posmik (Autor:in), 2007, Städtenetzwerke als globale Hierarchie und als Koordinationsmechanismus - Ein Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/84442