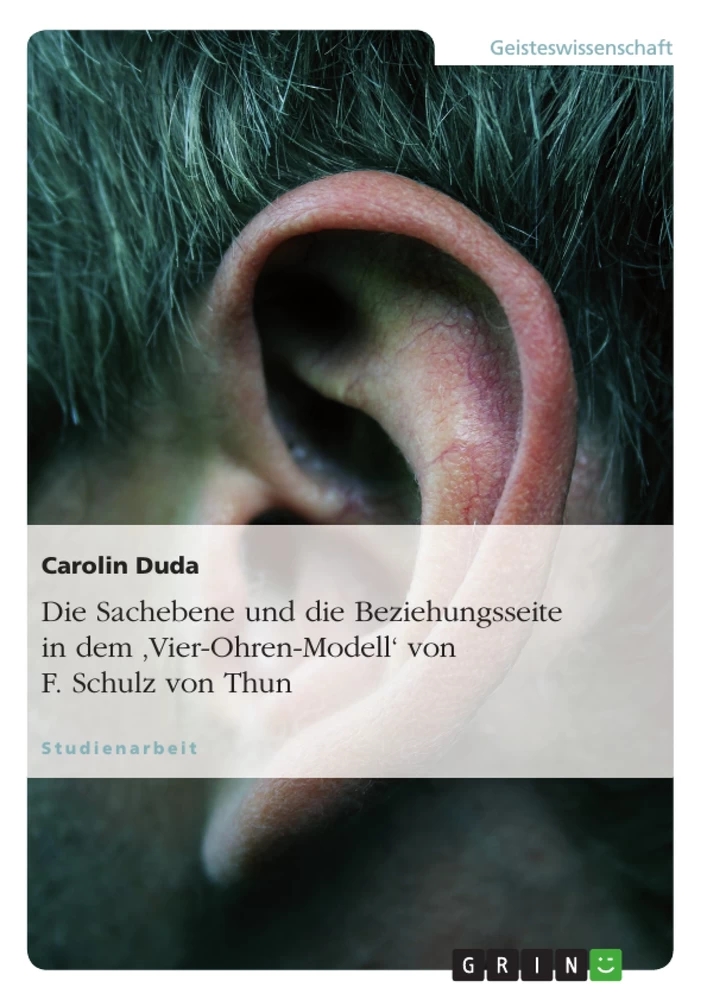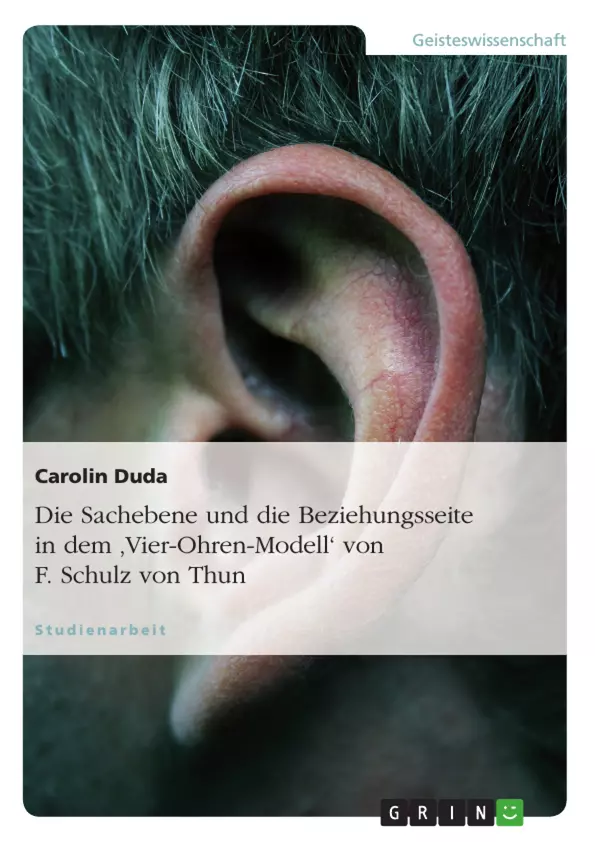Mit seiner Aussage „Man kann nicht nicht kommunizieren“ verdeutlicht P. Watzlawick die Problematik, die mit der zwischenmenschlichen Kommunikation einhergeht. Kommunikation umfasst mehr, als nur das bloße Sprechen. Auch jemand der nichts sagt, zeigt durch sein Verhalten, bewusst oder unbewusst, eine Aussage, z.B. Freude, Desinteresse oder Protest. In diesem Zusammenhang nimmt bei verschiedenen Ausdrucksformen verbaler und nonverbaler Kommunikation neben der Sachebene auch die Beziehungsebene zwischen „Sender“ und „Empfänger“ einer Information eine besondere Bedeutung zu. Liegen „Sender“ und „Empfänger“ nicht auf einer „Wellenlänge“, ist die Kommunikation zwangsläufig gestört. Kommunikation beinhaltet demnach immer auch Interaktion, wie umgekehrt Interaktion normalerweise auch einen sprachlichen Austausch der beteiligten Personen mit sich bringt.
Schule hat u.a. die Aufgabe, ihre Schüler auf die Welt von morgen vorzubereiten (Allokationsfunktion). Hierbei kommt der Kommunikationskompetenz eine zunehmende Bedeutung zu. Dies wird beispielsweise durch das Informations- und Kommunikationsnetz des Internets und die Strukturen einer zunehmenden Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft verdeutlicht. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Schüler mit den „Regeln“ der Kommunikation vertraut zu machen, damit sie sich in einer solchen Welt adäquat verständigen können. Darüber hinaus kam Flanders auf der Grundlage der Auswertung verschiedener Studien zu dem Ergebnis, dass Lehrer im Durchschnitt 68% und Schüler 20% der Unterrichtszeit mit Sprechen verbringen.
Aufgrund der bereits erwähnten hohen Bedeutung des Kommunikationskompetenz und des hohen Sprechanteils des Lehrers im Unterricht soll im Folgenden geklärt werden, inwiefern das „Vier-Ohren-Modell“ von F. Schulz von Thun Relevanz für den Schulalltag hat und Lehrern Hilfestellungen und Anregungen bezüglich des Unterrichtsprozesses geben kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Informationen über das „Vier-Ohren-Modell“ von F. Schulz von Thun
- Die Sachebene („Sachohr“)
- Die Beziehungsseite („Beziehungsohr“)
- Parallelen zwischen dem „Vier-Ohren-Modell“ von F. Schulz von Thun und dem konstruktivistischen Ansatz von P. Watzlawick
- Resümee: Hat das „Vier-Ohren-Modell“ Relevanz für den Schulalltag?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Relevanz des „Vier-Ohren-Modells“ von F. Schulz von Thun für den Schulalltag. Dabei werden die vier Seiten der Kommunikation (Sachinhalt, Beziehung, Appell, Selbstkundgabe) im Kontext des professionellen und menschlichen Miteinanders beleuchtet.
- Das „Vier-Ohren-Modell“ als Kommunikationsmodell im Schulalltag
- Die Bedeutung der Sachebene und der Beziehungsebene in der Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern
- Konflikte im Schulalltag im Kontext des „Vier-Ohren-Modells“
- Möglichkeiten zur Verbesserung der Kommunikation durch die Anwendung des „Vier-Ohren-Modells“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der zwischenmenschlichen Kommunikation und die Bedeutung von Kommunikationskompetenz im Schulalltag dar. Kapitel 2 präsentiert das „Vier-Ohren-Modell“ von F. Schulz von Thun und erläutert seine vier Seiten: Sachinhalt, Beziehung, Appell und Selbstkundgabe. Kapitel 2.1 analysiert die Sachebene, während Kapitel 2.2 die Beziehungsseite des Modells beleuchtet. In Kapitel 2.3 werden Parallelen zum konstruktivistischen Ansatz von P. Watzlawick gezogen. Abschließend wird in Kapitel 3 die Relevanz des „Vier-Ohren-Modells“ für den Schulalltag diskutiert.
Schlüsselwörter
Kommunikation, „Vier-Ohren-Modell“, Schulz von Thun, Sachebene, Beziehungsebene, Schulalltag, Lehrer-Schüler-Kommunikation, Konflikte, Kommunikationskompetenz, konstruktivistischer Ansatz, Watzlawick
- Arbeit zitieren
- Carolin Duda (Autor:in), 2007, Die Sachebene und die Beziehungsseite in dem 'Vier-Ohren-Modell' von F. Schulz von Thun, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/84336