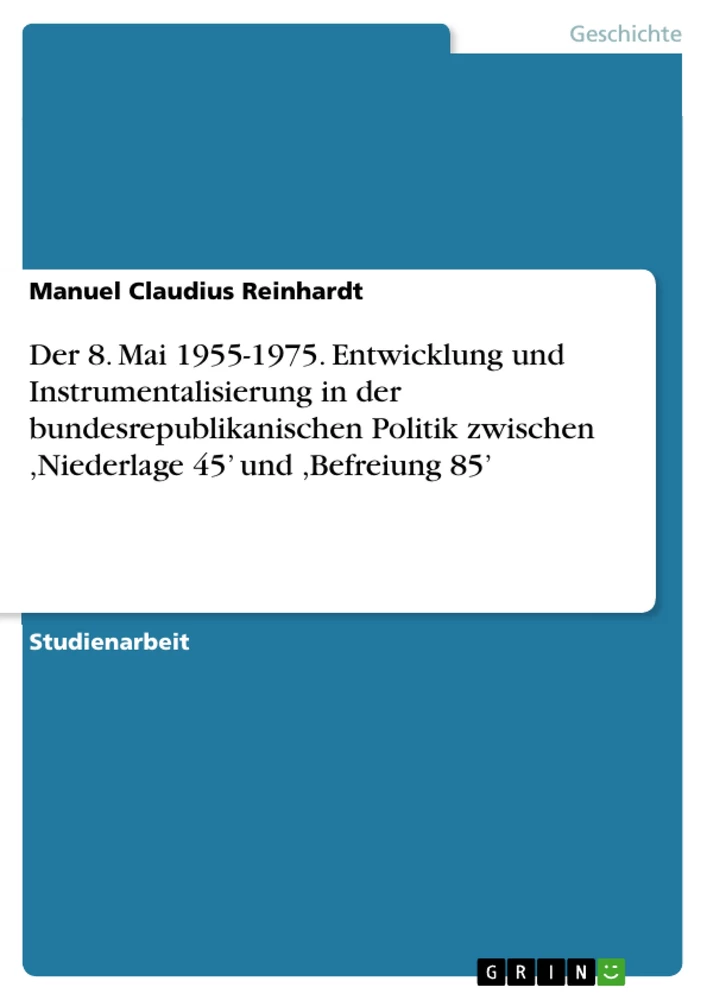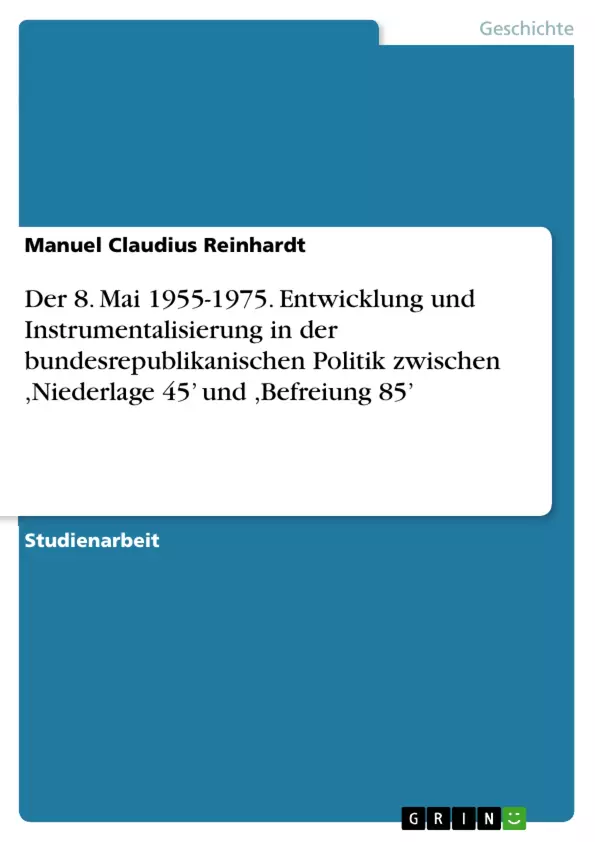Niederlage, Befreiung – Diese zwei Wörter sind die Schlüsselbegriffe in bezug auf den 8. Mai in Deutschland. Der 8. Mai 1985 stellte den Wendepunkt einer Diskussion dar, die bereits 1945, im Jahr der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht und des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa, begann und sich durch vier Jahrzehnte zog (s. Abb. 1). Der 8. Mai 1945 war ein Tag der Niederlage – so der gängige Konsens bis in die 1970er Jahre in der Bundesrepublik; als Befreiung konnten v.a. die Zeitzeugen diesen Tag nicht empfinden. Verschiedene Faktoren bedingten von da an eine leise, langsame aber dennoch stete Umdeutung des 8. Mai in Westdeutschland, die 1985 schließlich ihren Höhepunkt mit der Rede Richard von Weizsäckers vor dem deutschen Bundestag erreichte. Vom 8. Mai 1945 zum 8. Mai 1985 – von der Niederlage zur Befreiung . Diese zwei Extreme ergaben sich nicht über Nacht. Wie konstituierte sich der 8. Mai nun genau zwischen diesen beiden Eckpfeilern in der Bundesrepublik Deutschland? Mit Richard von Weizsäcker, 1985 Bundespräsident, war es ein führender Politiker, der die öffentliche Bewertung und somit die Erinnerung an den 8. Mai prägte. Hieraus leite ich das Motiv dieser Arbeit ab, die Frage nach der Einordnung des Tages des Kriegsendes in Europa nicht nur, aber fast ausschließlich in die Hände der Mächtigen der Republik – im folgenden der Bundeskanzler Konrad Adenauer (1955), Ludwig Erhard (1965), Willy Brandt (1970), Helmut Schmidt (1975), Bundespräsident Walter Scheel (1975) sowie von Oppositionsführern – zu legen. Der 8. Mai diente der politischen Elite – so meine These – nicht nur zur Erinnerungs- und Identitätsstiftung, sondern als Werkzeug ihrer jeweiligen Politik. Im folgenden soll die Entwicklung des Gedenktages ,8. Mai’ parallel zur Instrumentalisierung desselben betrachtet werden. Unabdingbar ist bei der Untersuchung der Gedenktage von 1955, 1965, 1970 und 1975 auch ein knapper Blick auf den Stellenwert und das Begehen des 8. Mai in der DDR, da dies – auch in Zusammenhang mit dem 17. Juni ab 1953 – mit der Präsens des 8. Mai im westlichen Bruderstaat verflochten war. Zunächst sollen jedoch die Begriffe Erinnerungskultur, Geschichtspolitik sowie politischer Gedenktag knapp dargestellt werden, da sie zum besseren Verständnis der Entwicklung des Umganges mit dem 8. Mai beitragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erinnerungskultur, Geschichtspolitik, politischer Gedenktag. Eine Einführung
- Der 8. Mai 1945: Niederlage!
- Der 8. Mai von 1955 bis 1975
- Der 8. Mai 1955: Zehn Jahre danach
- Exkurs: 8. Mai vs. 17. Juni I
- Der 8. Mai 1965: Das „Erfolgsmodell BRD“?
- Der 8. Mai 1970: Die Renaissance des 8. Mai
- Exkurs: 8. Mai vs. 17. Juni II
- Der 8. Mai 1975: Inhaltliche Kontinuität und bewertender Wandel
- Der 8. Mai 1955: Zehn Jahre danach
- Der 8. Mai 1985: Befreiung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung des 8. Mai 1945 in der bundesrepublikanischen Erinnerungspolitik zwischen 1955 und 1975. Sie untersucht, wie die politische Elite den Gedenktag instrumentalisierte und die öffentliche Bewertung des 8. Mai beeinflusste. Dabei liegt das Augenmerk auf der Instrumentalisierung des Gedenktages durch die jeweiligen Bundeskanzler und Oppositionsparteien, die den 8. Mai zur Erinnerungs- und Identitätsstiftung sowie zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele nutzten.
- Die Instrumentalisierung des 8. Mai durch die politische Elite
- Die Entwicklung des Gedenktages von der „Niederlage“ zur „Befreiung“
- Der Einfluss des 17. Juni und der DDR auf die bundesrepublikanische Erinnerungskultur
- Die Bedeutung der Neuen Ostpolitik für die Renaissance des 8. Mai
- Der Wandel der öffentlichen Bewertung des 8. Mai und die Rolle der Generationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und präsentiert die zentralen Schlüsselbegriffe: Niederlage und Befreiung. Die Arbeit zeichnet den Weg des 8. Mai von der Niederlage zur Befreiung nach und beleuchtet die Rolle von Richard von Weizsäcker als prägenden Faktor in der öffentlichen Bewertung des Tages. Das zweite Kapitel erläutert die Begriffe Erinnerungskultur, Geschichtspolitik und politischer Gedenktag. Es wird deutlich, dass Erinnerung nicht automatisch entsteht, sondern durch kollektive Bedürfnisse und politische Prozesse geformt wird. Das dritte Kapitel widmet sich dem 8. Mai 1945 und beschreibt diesen als Tag der Niederlage für Deutschland. Die Besatzung durch alliierte Truppen und der Zusammenbruch des Deutschen Reiches prägten die Wahrnehmung des Tages. Im vierten Kapitel werden die Gedenktage von 1955, 1965, 1970 und 1975 beleuchtet. Es werden die Reden und Handlungen der führenden Politiker, insbesondere der Bundeskanzler, analysiert. Die Kapitel zeigen, wie der 8. Mai als Werkzeug der Politik instrumentalisiert wurde, um die eigene Politik zu legitimieren, den Erfolg der Bundesrepublik zu betonen und die DDR in den Vordergrund zu stellen. Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Rede von Richard von Weizsäcker im Jahre 1985, die den 8. Mai als Tag der Befreiung definierte. Diese Rede löste eine breite Diskussion aus, die sich in den folgenden Jahren fortsetzte.
Schlüsselwörter
Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind: Erinnerungskultur, Geschichtspolitik, politischer Gedenktag, 8. Mai, Niederlage, Befreiung, Bundesrepublik Deutschland, DDR, 17. Juni, Neue Ostpolitik, Instrumentalisierung, Identitätsstiftung, politische Ziele, Generationenkonflikt, kollektive Erinnerung, persönliche Erinnerung, Konsensfähigkeit, Zweideutigkeit, Schuld, Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wandelte sich die Bedeutung des 8. Mai in der Bundesrepublik?
Der 8. Mai entwickelte sich von einem Tag, der primär als "Niederlage" (1945/1950er Jahre) wahrgenommen wurde, hin zu einem Tag der "Befreiung", was 1985 durch die Rede von Richard von Weizsäcker offiziell besiegelt wurde.
Welche Rolle spielte die politische Elite beim Gedenken an den 8. Mai?
Bundeskanzler wie Adenauer, Brandt und Schmidt instrumentalisierten den Tag als Werkzeug für ihre jeweilige Politik, zur Identitätsstiftung und zur Abgrenzung oder Annäherung an die DDR.
Warum war die Rede von Richard von Weizsäcker 1985 ein Wendepunkt?
Weizsäcker definierte den 8. Mai erstmals vor dem Bundestag als "Tag der Befreiung" vom menschenverachtenden System der Nationalsozialisten, was eine neue Phase der deutschen Erinnerungskultur einleitete.
Welchen Einfluss hatte die DDR auf das westdeutsche Gedenken?
In der DDR wurde der 8. Mai früh als Tag der Befreiung durch die Rote Armee gefeiert. Dies führte in der BRD oft zu einer Abgrenzung, wobei der 17. Juni als Gegen-Gedenktag an Bedeutung gewann.
Was versteht man unter Geschichtspolitik im Kontext dieser Arbeit?
Geschichtspolitik bezeichnet den bewussten Einsatz von Geschichte und Gedenktagen durch politische Akteure, um aktuelle politische Ziele zu legitimieren und das kollektive Gedächtnis zu formen.
- Quote paper
- Manuel Claudius Reinhardt (Author), 2005, Der 8. Mai 1955-1975. Entwicklung und Instrumentalisierung in der bundesrepublikanischen Politik zwischen ,Niederlage 45’ und ,Befreiung 85’, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/83996