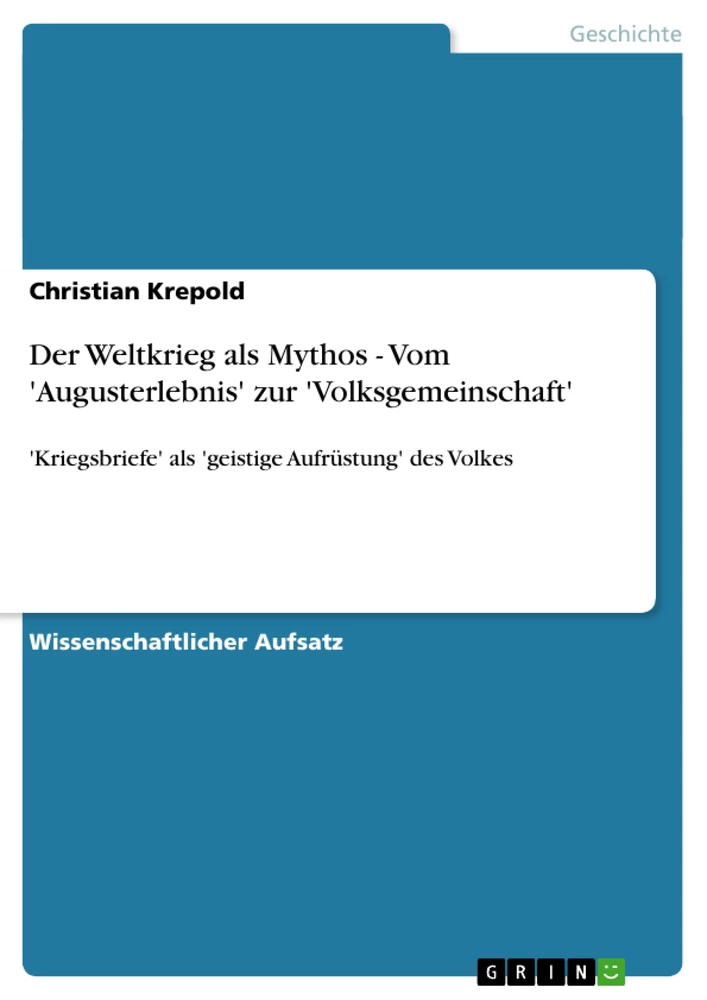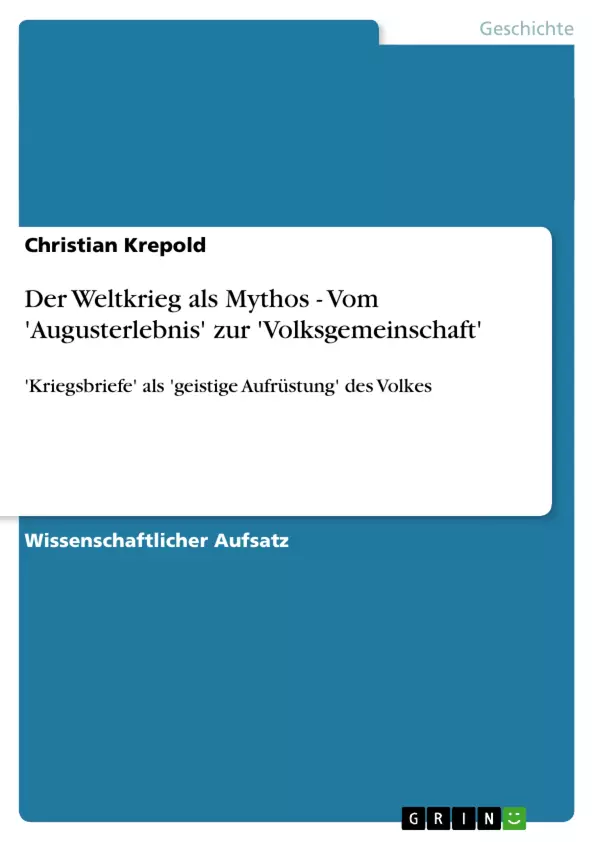Diese Studie leistet einen Beitrag, den Aufstieg der NS-Bewegung vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs oder vielmehr der ideologischen Inanspruchnahme des Weltkriegserlebnisses verstehbar zu machen. "Kriegsbriefe" im Ersten Weltkrieg gefallener Soldaten wurden im Dienste "geistiger Aufrüstung" selektiv ediert und das zunehmend am Ende der 20er-Jahre. Zeigt ein unvoreingenommener Blick auf die Edition Philipp Witkops, die im Mittelpunkt der Analyse steht, ein durchaus differenziertes Bild – von hymnischer Kriegsbegeisterung bis zu erklärtem Pazifismus –, so waren Feldpostbriefe dennoch besonders geeignet, die Mythisierung des Krieges voranzutreiben. Als authentisches Zeugnis der jungen Gefallenen stilisierten sie den "Opfertod" zum Vermächtnis für die Überlebenden: Soll ihr Opfer nicht vergebens gewesen sein, verpflichtet es für die Zukunft – und erfüllt damit vor allem in der Orientierungslosigkeit der Krisenjahren am Ende der Weimarer Republik eine sinnstiftende Funktion, von der die NS-Bewegung profitieren konnte. Die besonders ausführliche Quellen- und Forschungsbibliographie mag für jeden hilfreich sein, der sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus beschäftigt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Fragestellung
- II. Die „Ideen von 1914“ und der Krieg als „Bildungserlebnis“
- III. „Für das neue, größere, bessere Vaterland...“
- IV. Kultur, Nation und Religion: Sinnstiftung in Krieg und „Nachkrieg“
- V. Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung des „Augusterlebnisses“ von 1914 für den Aufstieg der NS-Bewegung. Sie analysiert die Konstruktion des Kriegsbeginns als nationaler Aufbruch und die Rolle der „Kriegsbriefe“ als Medium der „geistigen Aufrüstung“ des Volkes.
- Der Mythos des „Augusterlebnisses“ und seine Instrumentalisierung durch die NS-Propaganda
- Die Rolle von Kriegserfahrungen und Kriegspropaganda in der Bildung der „Volksgemeinschaftsideologie“
- Die Konstruktion des „Dolchstoßes“ und seine Verbindung zum „Augusterlebnis“
- Die Rezeption des „Augusterlebnisses“ in der Weimarer Republik und die Bedeutung für die Entstehung des Nationalsozialismus
- Die Wählerschaft der NSDAP und ihre Empfänglichkeit für den Krieg als „Mythos“
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Fragestellung: Dieses Kapitel stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung des „Augusterlebnisses“ für den Aufstieg der NS-Bewegung in den Vordergrund und betont die Notwendigkeit, den Weg zur „Volksgemeinschaftsideologie“ sowie die Perspektive der Niederlage und des „Dolchstoßes“ zu betrachten.
- II. Die „Ideen von 1914“ und der Krieg als „Bildungserlebnis“: In diesem Kapitel werden die ambivalenten Reaktionen auf den Kriegsausbruch von 1914 beleuchtet, mit Fokus auf die Euphorie junger Menschen und die Skepsis der älteren Generation. Die Rolle der „Kriegsbriefe“ als Medium der „geistigen Aufrüstung“ wird vorgestellt.
- III. „Für das neue, größere, bessere Vaterland...“: Das Kapitel untersucht die Rhetorik und Propaganda der Kriegspropaganda sowie die Ideologie der „Volksgemeinschaft“, die während des Krieges konstruiert wurde.
- IV. Kultur, Nation und Religion: Sinnstiftung in Krieg und „Nachkrieg“: Dieses Kapitel widmet sich den Themen der Kriegspropaganda und der Ideologie der „Volksgemeinschaft“ sowie den Möglichkeiten der Sinnstiftung in Krieg und Nachkriegszeit.
Schlüsselwörter
„Augusterlebnis“, „Volksgemeinschaft“, „Kriegsbriefe“, „geistige Aufrüstung“, „Dolchstoßlegende“, „NS-Propaganda“, „Weimarer Republik“, „Mythos“, „nationaler Aufbruch“, „Kriegsbegeisterung“
- Quote paper
- Christian Krepold (Author), 2004, Der Weltkrieg als Mythos - Vom 'Augusterlebnis' zur 'Volksgemeinschaft', Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/82992