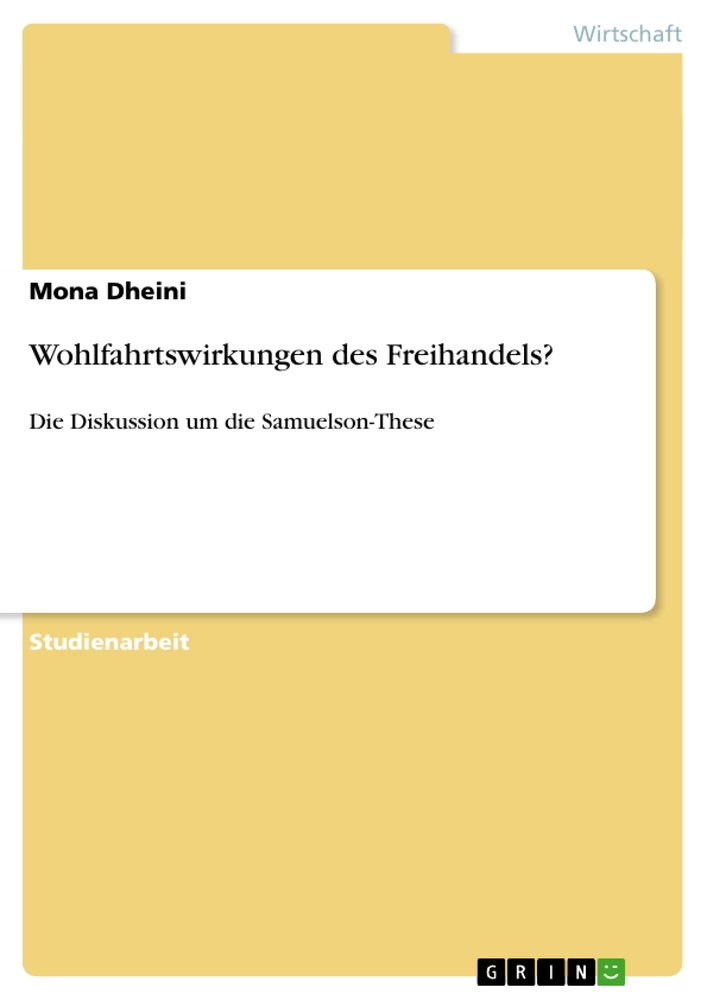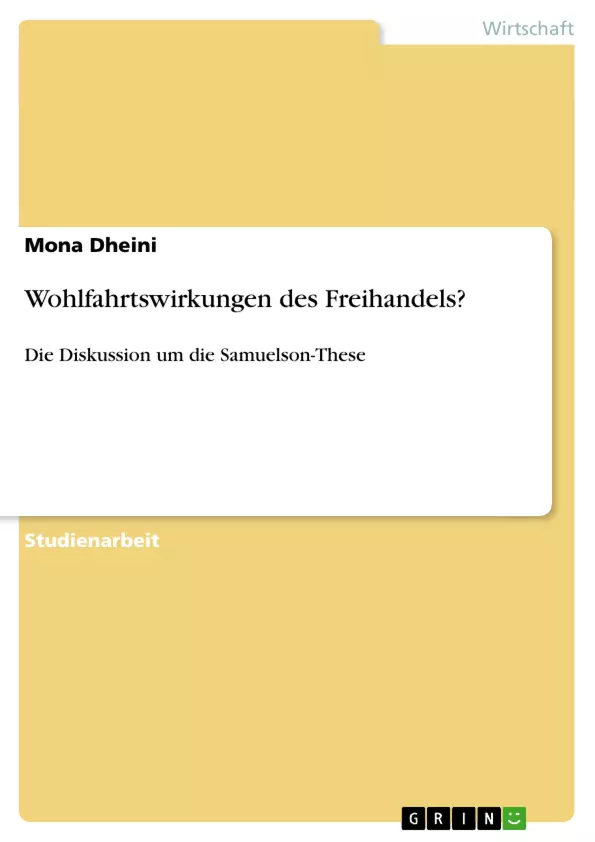Liberale teilen die Ansicht, dass es allen Menschen möglich ist wohlhabend zu werden, wenn die wirtschaftliche Freiheit gewährleistet ist. Dementsprechend fordern sie eine freie Marktwirtschaft einschließlich des Freihandels. Das Schwanken zwischen Freihandel und Protektionismus prägt auch im Zeitalter der Globalisierung nahezu alle internationalen Wirtschaftsbeziehungen egal ob zwischen Industriestaaten oder Schwellen- bzw. Entwicklungsländer.
Die seit über 200 Jahren herrschende Freihandelslehre ist jedoch von Samuelson in Frage gestellt worden und zeigt seine Argumentation anhand eines zwei Länder – zwei Güter - Modells. Ziel dieser Hausarbeit ist es die Idee des Freihandels sowie die einzelnen Kritikpunkte Samuelsons sowie seiner Gegner näher zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Freihandel überhaupt?
- Idee des Freihandels
- Allgemeine Probleme des Freihandels
- Theorien von Samuelson und Ricardo
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Wohlfahrtswirkungen des Freihandels, wobei die Samuelson-These im Mittelpunkt steht. Ziel ist es, die Idee des Freihandels zu erläutern und die Kritikpunkte von Samuelson und seinen Gegnern näher zu beleuchten.
- Idee des Freihandels und Arbeitsteilung
- Vorteile und Nachteile des Freihandels
- Die Samuelson-These und ihre Auswirkungen
- Die Theorie des komparativen Vorteils nach Ricardo
- Langfristige Wohlfahrtswirkungen der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Freihandel und die Relevanz der Samuelson-These ein. Sie stellt den Kontext der Hausarbeit dar.
- Was ist Freihandel überhaupt?: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Freihandels und seine Ziele in Bezug auf die Förderung des Wohlstands und der Lebensqualität.
- Idee des Freihandels: Dieses Kapitel erläutert die zentrale Idee des Freihandels, die Arbeitsteilung und die daraus resultierende Steigerung von Produktivität und Effizienz.
- Allgemeine Probleme des Freihandels: Hier werden allgemeine Probleme des Freihandels beleuchtet, wie die Benachteiligung von landwirtschaftlichen Produzenten im globalen Handel.
- Theorien von Samuelson und Ricardo: Dieses Kapitel stellt die Theorien von Samuelson und Ricardo im Hinblick auf die Wohlfahrtswirkungen des Freihandels gegenüber. Es werden die Kritikpunkte von Samuelson und seine Argumente gegen die Allgemeingültigkeit der Freihandelslehre nach Ricardo diskutiert.
Schlüsselwörter
Freihandel, Samuelson-These, komparativer Vorteil, Ricardo, Arbeitsteilung, Globalisierung, Wohlfahrtswirkungen, Wirtschaftsliberalismus, Protektionismus, Outsourcing, Industrieprodukte, Landwirtschaft.
- Quote paper
- Mona Dheini (Author), 2005, Wohlfahrtswirkungen des Freihandels?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/82894