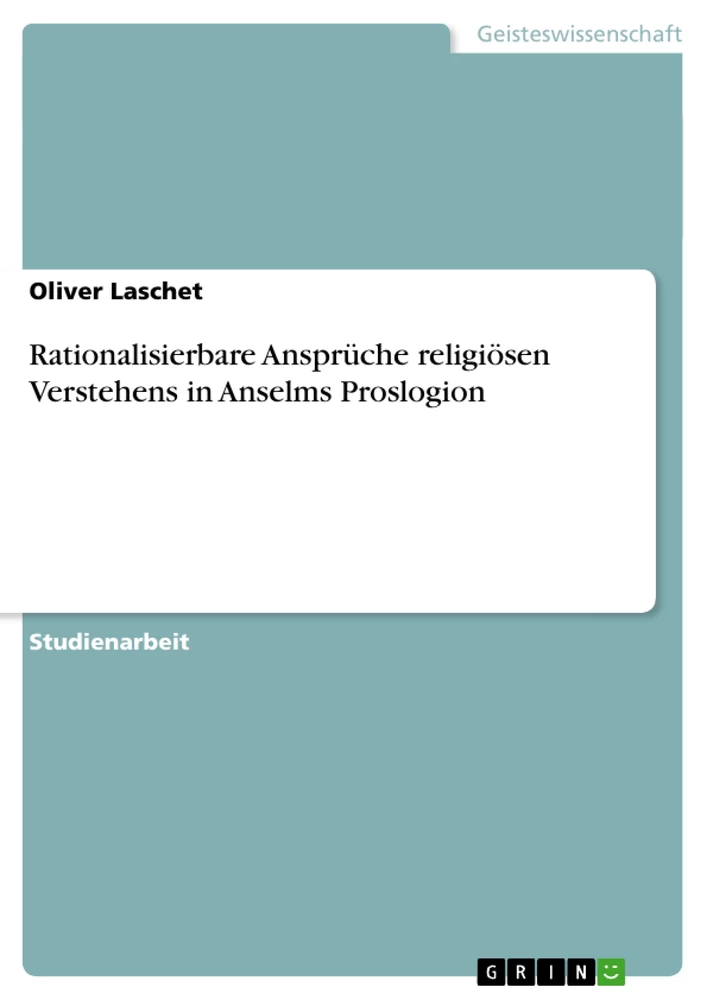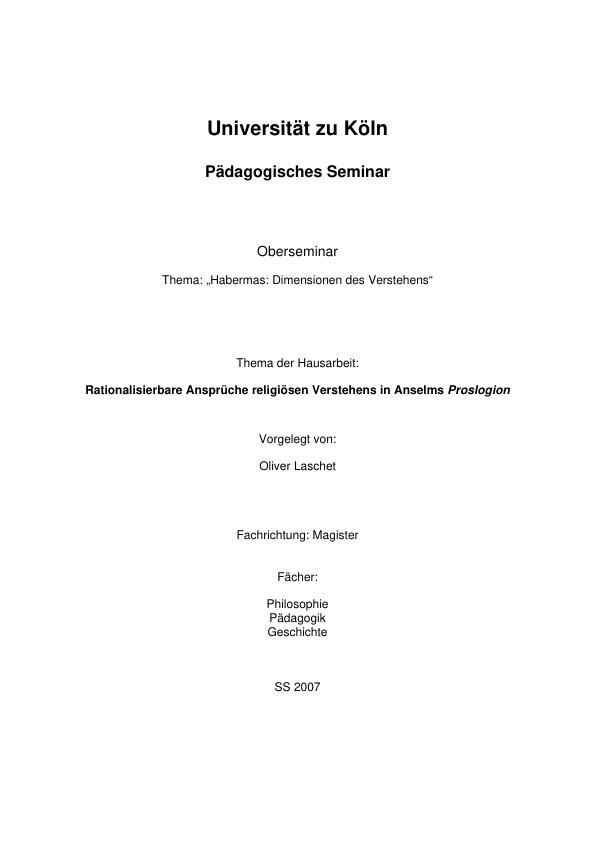Anselm von Canterbury (1033-1109) war ohne Zweifel einer der bedeutendsten Philosophen des Mittelalters, und dies, obwohl der Terminus ‚Philosophie’ in seinem Werk kein einziges Mal auftaucht. Doch auch den Begriff ‚Theologie’ sucht man in seinen Schriften vergeblich. Offenbar bestimmte er sich weder als Theologen noch als Philosophen, obschon er vom heutigen Standpunkt aus beides gewesen ist. Die seinem Denken in dieser Hinsicht eigentümliche Differenzlosigkeit, die in der Patristik noch nicht möglich gewesen ist und in der Hochscholastik nicht mehr möglich sein wird, ist ein Kennzeichen des kulturgeschichtlichen Selbstverständnisses seiner Zeit, in der Glaubens- und Kulturgemeinschaft noch als deckungsgleich gedacht wurden.
Doch unabhängig von der anachronistischen Frage nach der philosophischen oder theologischen Bestimmtheit Anselms fehlt das unter methodischer Perspektive Philosophische an der Philosophie, nämlich die vernünftige Argumentation, gerade im Zusammenhang mit dem von ihm in seinem kleinen Werk Proslogion („Anrede“, um 1077/78) vorgelegten Gottesbeweis nicht. Der offensichtlich programmatische Charakter des ursprünglichen Titels dieser Schrift, Fides quaerens intellectum („Der Glaube, der nach Einsicht strebt“), lässt Anselms Generalintention besser erkennen: Es geht um eine vernünftige Begründung des Glaubens an die Existenz Gottes, eine Begründung aufgrund von Einsicht.
Inhalt:
I. Einleitung 2
II. Der doppelte Beweisgang im Monologion 5
III. Beweisform und Beweisführung im Proslogion 8
IV. Erläuterungen zum Proslogion-Argument 12
V. Einwände gegen das ontologische Argument 16
Literaturverzeichnis 18
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der doppelte Beweisgang im Monologion
- III. Beweisform und Beweisführung im Proslogion
- IV. Erläuterungen zum Proslogion-Argument.
- V. Einwände gegen das ontologische Argument.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Anselms ontologisches Gottesargument im Proslogion und setzt es in den Kontext seiner philosophischen und theologischen Überlegungen. Die Arbeit untersucht die Beweisführungsstruktur im Proslogion und setzt sie in Beziehung zum vorherigen Werk Anselms, dem Monologion. Dabei werden auch Einwände gegen das ontologische Argument behandelt und diskutiert.
- Der Gottesbeweis im Proslogion und seine Verbindung zum Monologion
- Die Beweisführungsstruktur und Argumentationsweise im Proslogion
- Die Rolle der Vernunft im religiösen Verstehen
- Einwände gegen das ontologische Argument
- Anselms philosophische und theologische Position
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Dieses Kapitel stellt Anselm von Canterbury als bedeutenden Philosophen des Mittelalters vor und verdeutlicht seine einzigartige Position zwischen Theologie und Philosophie. Es werden die Herausforderungen der Zeit und das Spannungsfeld zwischen Glaube und Vernunft beleuchtet, welches die Entstehung des Gottesbeweises im Proslogion prägte. Anselm strebte nach einer vernünftigen Begründung des Glaubens an die Existenz Gottes, ohne den Glauben selbst in Frage zu stellen.
II. Der doppelte Beweisgang im Monologion
Dieses Kapitel befasst sich mit den Gottesbeweisen, die Anselm bereits im Monologion formuliert hatte. Die Arbeit rekonstruiert die beiden Beweise im Monologion, um die Grundlagen für die Argumentation im Proslogion aufzuzeigen. Beide Beweise basieren auf den philosophischen Traditionen des Platonismus und des Augustinismus und werden kurz beschrieben.
III. Beweisform und Beweisführung im Proslogion
Dieses Kapitel fokussiert auf die spezifische Beweisführung im Proslogion. Anselms Argumentation basiert auf dem Konzept des „größten denkbaren Wesens" und der Annahme, dass dieses Wesen notwendigerweise existieren muss. Die Arbeit analysiert die Beweisstruktur und die Argumentationsschritte, die Anselm im Proslogion präsentiert.
IV. Erläuterungen zum Proslogion-Argument.
Dieses Kapitel bietet eine tiefergehende Analyse des Proslogion-Arguments. Es werden die zentralen Begriffe und Konzepte des Argumentes erläutert und die Argumentation Anselms aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Die Arbeit beleuchtet die Stärken und Schwächen des ontologischen Gottesbeweises.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Themen der Philosophie und Theologie im 11. Jahrhundert und untersucht die Argumentation Anselms von Canterbury im Proslogion. Die Schlüsselwörter umfassen: ontologisches Gottesargument, Proslogion, Monologion, Vernunft, Glaube, Existenz, Gott, Beweisführung, Philosophie, Theologie, Mittelalters.
- Quote paper
- Oliver Laschet (Author), 2007, Rationalisierbare Ansprüche religiösen Verstehens in Anselms Proslogion, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/81039