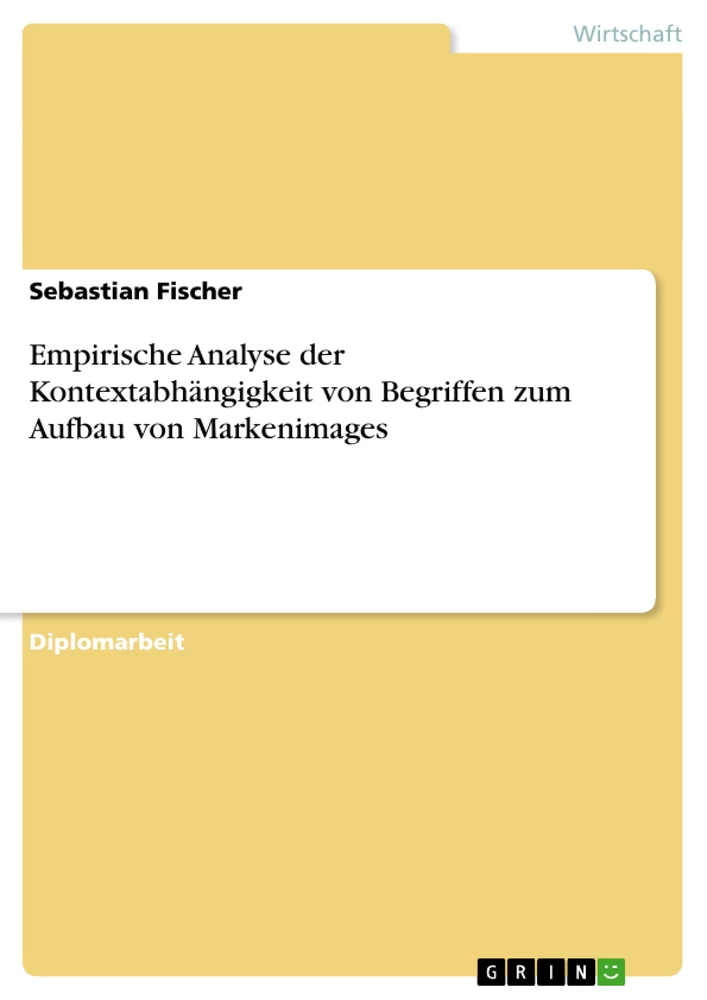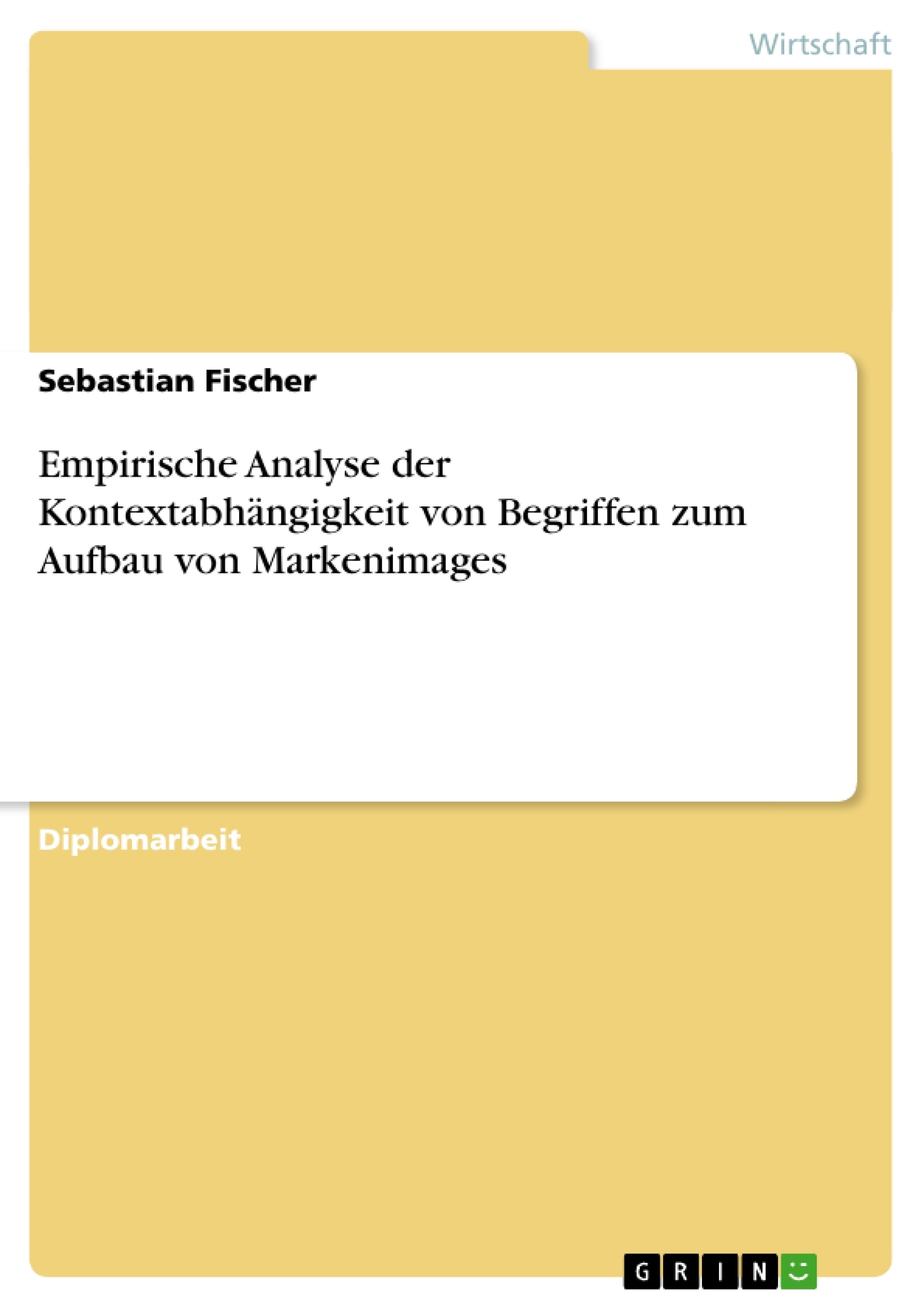Kognitive Repräsentationen, die Konsumenten zu einer Marke aufgebaut haben, beeinflussen ihre Beurteilung und damit die Kaufentscheidung. Demnach ist zum Aufbau eines Markenimages fundiertes Wissen über die Markenassoziationen der Konsumenten nötig. Freie Assoziationsverfahren ermöglichen, Begriffe zu erheben, die den Unternehmen die Wahrnehmung der Marke aus Konsumentensicht darlegt. Doch sind diese qualitativen Methoden zur Erfassung des Markenwissens und damit als strategische Entscheidungshilfe der Unternehmenskommunikation ausreichend?
Zur Beantwortung der Frage wurden zunächst die Zusammenhänge zwischen der Gestaltung der Markenidentität, Markenpositionierung und der intendierten Wirkung am Markt, dem Markenimage vorgestellt. Die dargestellten Konzepte veranschaulichten aufgrund des Strebens der Unternehmen nach Markendifferenzierung die Notwendigkeit einer qualitativ orientierten Markenbeurteilung zur Erfassung des Markenwissens der Konsumenten. Hieraus entwickelt sich die Frage, ob die in bspw. Freelisting und der Fokusgruppe erhobenen Begriffslisten ausreichen, oder ob hinsichtlich der Anwendbarkeit von Begriffen die Kontextabhängigkeit von Begriffen beachtet werden muss. Das Ziel der Arbeit ist die Schaffung von konzeptionellen und methodischen Grundlagen, indem eine Vergleichsstudie zwischen Produktmerkmalen geplant und durchgeführt wird. Hierzu werden die Bedeutungsähnlichkeiten bzw. die Kontextspezifität von Begriffen zu verschiedenen Produktgruppen in drei Designsets per Triadentest erhoben (N=106). Eine Konsensanalyse prüft das Ausmaß der Kontextspezifität. Während für Produktkategorien wie gustatorische vs. visuell-haptische Produkte kaum Kontextspezifität (2,2%) nachgewiesen werden konnte, beträgt sie für die Produktgruppen selbst immerhin Ø 5,4% (bei 24,2 % universellem Konsens). Die gefundenen kontextspezifischen Bedeutungen der Begriffe wurden anschließend anhand von Distanzprofilen, Zentralitäts- und Kontextinvarianzkennwerten sowie Multidimensionalen Skalierungen inhaltlich interpretiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer und methodischer Hintergrund des Markenimages
- Markenimage, Markenidentität und Markenpositionierung
- Qualitative Markenforschung
- Semantische Netze, Cognitive Mapping, Triadentest
- Kontextabhängigkeit von Begriffen
- Methodik der Kontextabhängigkeits-Studie
- Ziel der Studie
- Operationalisierung
- Gewinnung des Untersuchungsmaterials und -designs
- Triadentest
- Durchführung
- Ergebnisse
- Ergebnisse der Konsensmessung im Kovarianzstrukturmodell
- Ergebnisse der inhaltlichen Analyse
- Diskussion
- Methodische Reflexion
- Interpretation und Nutzung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Kontextabhängigkeit von Begriffen, die zum Aufbau von Markenimages verwendet werden. Ziel ist es, zu analysieren, ob die in der qualitativen Markenforschung eingesetzten Verfahren zur Erfassung von Markenassoziationen ausreichend sind oder durch den Einsatz von Begriffsnetzen und Cognitive Maps ergänzt werden müssen.
- Konzept der Markenidentität und Markenpositionierung
- Methodik der qualitativen Markenforschung
- Darstellung von Markenwissen durch semantische Netze und Cognitive Maps
- Analyse der Kontextabhängigkeit von Begriffen im Triadentest
- Bewertung der Ergebnisse für die praktische Anwendung in der Markenforschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2.1: Dieses Kapitel definiert die grundlegenden Konzepte der Markenidentität, Markenpositionierung und Markenimage. Es wird dargelegt, wie Unternehmen versuchen, ein positives Vorstellungsbild ihrer Marke im Bewusstsein der Konsumenten zu schaffen und wie wichtig die Abstimmung des Selbstbilds der Marke auf das empfangene Fremdbild ist.
- Kapitel 2.2: Kapitel 2.2 befasst sich mit Methoden der qualitativen Markenforschung, insbesondere dem Freelisting und der Fokusgruppe. Diese Verfahren dienen dazu, unverfälschte Aussagen der Zielgruppen über ihre Markenassoziationen zu ermitteln.
- Kapitel 2.3: Kapitel 2.3 erläutert die Visualisierung von Markenassoziationen in Form von semantischen Netzen und Cognitiven Maps. Diese Verfahren ermöglichen es, die Struktur des Markenwissens graphisch darzustellen und kontextabhängige Bedeutungen sichtbar zu machen.
- Kapitel 3: Kapitel 3 beschreibt die Methodik der Kontextabhängigkeits-Studie. Es wird die Forschungsfrage, die Hypothese und das Design der Studie erläutert. Es werden Produktgruppen und Attribute ausgewählt, die in einem Triadentest auf ihre Kontextabhängigkeit hin untersucht werden sollen.
- Kapitel 4: Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es werden die Ergebnisse der Konsensanalyse im Kovarianzstrukturmodell und der inhaltlichen Analyse der Begriffsstruktur in den einzelnen Designsets dargestellt.
Schlüsselwörter
Markenimage, Markenidentität, Markenpositionierung, Qualitative Markenforschung, Freelisting, Fokusgruppe, Semantische Netze, Cognitive Mapping, Triadentest, Kontextabhängigkeit, Konsensanalyse, Distanzprofile, Zentralitätsanalyse, Kontextinvarianzkennwert, Multidimensionale Skalierung, semantische Lücke.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist das Markenwissen der Konsumenten für Unternehmen so wichtig?
Kognitive Repräsentationen und Markenassoziationen beeinflussen maßgeblich die Beurteilung einer Marke und damit die letztliche Kaufentscheidung der Konsumenten.
Was ist das Ziel der empirischen Untersuchung in dieser Arbeit?
Das Ziel ist die Analyse der Kontextabhängigkeit von Begriffen beim Aufbau von Markenimages, um festzustellen, ob einfache Begriffslisten für die strategische Kommunikation ausreichen.
Welche methodischen Verfahren wurden in der Studie angewandt?
Es wurde ein Triadentest zur Erhebung von Bedeutungsähnlichkeiten durchgeführt, ergänzt durch Konsensanalysen, Multidimensionale Skalierungen und Zentralitätsanalysen.
Wie hoch ist die nachgewiesene Kontextspezifität bei Markenbegriffen?
Die Studie ergab eine Kontextspezifität von durchschnittlich 5,4 % für Produktgruppen, während bei Kategorien wie visuell-haptischen Produkten kaum Kontextspezifität vorlag.
Was versteht man unter Cognitive Mapping im Markenkontext?
Cognitive Mapping dient der graphischen Visualisierung von Markenassoziationen in semantischen Netzen, um die Struktur des Markenwissens im Bewusstsein der Konsumenten sichtbar zu machen.
- Quote paper
- Diplom-Kaufmann Sebastian Fischer (Author), 2007, Empirische Analyse der Kontextabhängigkeit von Begriffen zum Aufbau von Markenimages, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/80961