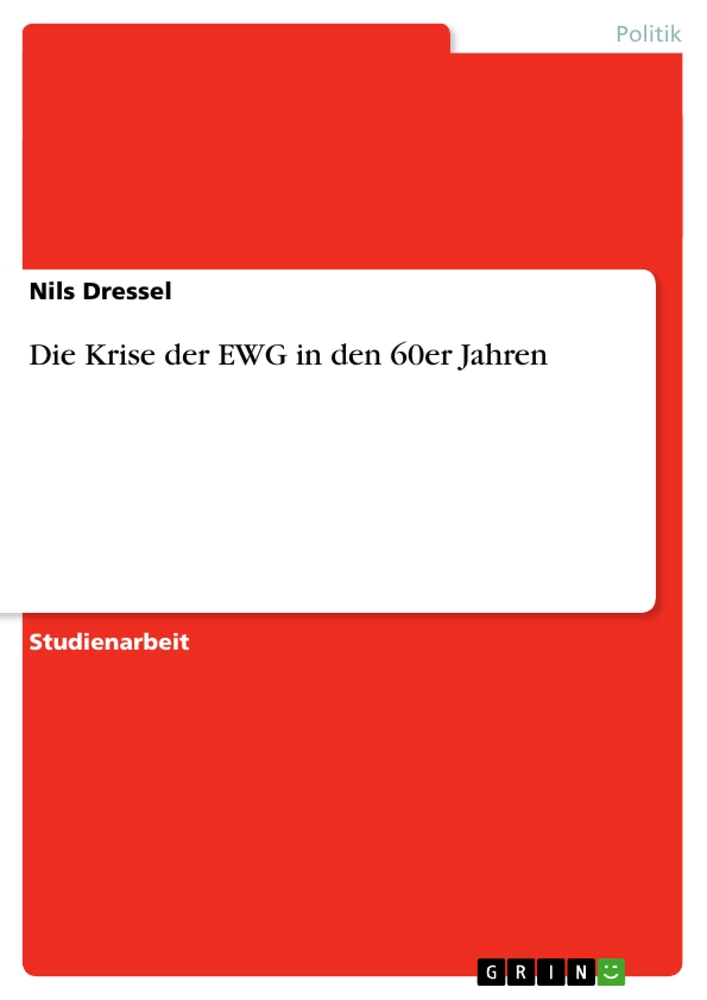Die 60er Jahre waren ein ereignisreiches Jahrzehnt für die europäische Integration. Die europäische Gemeinschaft befand sich in einer Phase der Neuordnung und damit gleichzeitig der Krise. Dabei gab es drei herausragende Ereignisse: Die Fouchet - Pläne, das England - Veto Frankreichs und der Luxemburger Kompromiss. Diese drei Krisen waren exemplarisch für die Kernprobleme der europäischen Integration, die hier zum ersten Mal deutlich hervortraten.
Durch ein geändertes politisches Umfeld fehlte der europäischen Integration plötzlich eine treibende Kraft zur ihrer Verwirklichung. Die Ursachen und Folgen dieser Entwicklung werden im nächsten Abschnitt eingehender beleuchtet.
An den Krisen selbst werde ich die zentrale These dieser Arbeit festmachen. Sie lautet:
Die Krise der EWG in den 60er Jahren ist auf den Kampf zweier unterschiedlichen Vorstellungen, wie ein geeintes Europa organisiert sein sollte, zurückzuführen: das Intergouvernementale gegen das supranationale Konzept.
Für den Begriff des Intergouvernementalismus werden synonym die Begriffe ‚Nationalstaatlichkeit′ und ‚Europa der Vaterländer′, für Supranationalismus der Begriff ‚Föderalismus′ verwendet.
Jene These kann mit Sicherheit nicht als alleiniger Erklärungsansatz für die Entwicklung der EWG von 1960-70 gelten. So gibt es verschiedene andere Theorien, die sich mit ihr ergänzen oder erweitern, wie die Andrew Moravcsiks , der die Krisen hauptsächlich aus ökonomischen Gründen heraus erklärt. Ich denke jedoch, dass die unterschiedlichen Integrationsvorstellungen gerade das Verhalten der zwei Hauptakteure Frankreich und Deutschland zu dieser Zeit erklären können.
Um die These zu überprüfen wird jede der drei Krisen mit folgendem Fragenkomplex untersucht:
- Wer waren die Verursacher der Krisen und welche Gründe hatten sie?
- Wie wurden die Krisen überwunden?
- Stellten die Krisen eine Bedrohung für die EWG und damit die europäische Integration dar?
- Welche Bedeutung hatten die Krisen für die weitere Entwicklung der EWG?
- Lassen sich intergouvernementale oder föderale Aspekte finden?
Die Ergebnisse der Fragen sollen anschließend die These belegen oder widerlegen und Erklärungen für die Ereignisse des untersuchten Jahrzehnts geben können.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die politische Situation zu Beginn der 60er Jahre
- III. Die Fouchet - Pläne
- IV. Das England - Veto
- V. Die Politik des leeren Stuhls und der Luxemburger Kompromiss
- VI. Zusammenfassung
- VII. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Krise der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) in den 1960er Jahren und beleuchtet dabei den Konflikt zwischen Intergouvernementalismus und Supranationalismus. Ziel ist es, die Ursachen und Folgen dieser Entwicklung zu verstehen und die Auswirkungen auf die weitere Integration Europas zu beleuchten.
- Der Konflikt zwischen Intergouvernementalismus und Supranationalismus als zentrale Ursache der EWG-Krise
- Die Fouchet-Pläne, das England-Veto Frankreichs und der Luxemburger Kompromiss als Schlüsselereignisse der Krise
- Die Rolle Frankreichs und Deutschlands als Hauptakteure in der Krise
- Die Bedeutung der politischen Situation zu Beginn der 1960er Jahre für die EWG
- Die Folgen der Krise für die weitere Entwicklung der Europäischen Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor: Die EWG-Krise der 1960er Jahre ist auf den Kampf zweier unterschiedlicher Vorstellungen über die Organisation eines geeinten Europas zurückzuführen - Intergouvernementalismus versus Supranationalismus.
Kapitel II beleuchtet die politische Situation zu Beginn der 1960er Jahre und analysiert die Faktoren, die zum Wandel der europäischen Integration führten, wie den Verlust kolonialer Einflussgebiete und den wirtschaftlichen Aufschwung in Westeuropa.
Kapitel III untersucht die Fouchet-Pläne, die Frankreichs Vision eines europäischen Staatenbundes widerspiegelten, der jedoch am Widerstand anderer Mitgliedstaaten scheiterte.
Kapitel IV analysiert das England-Veto Frankreichs, das die Beitrittsverhandlungen Großbritanniens zur EWG blockierte und die Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten weiter verschärfte.
Kapitel V fokussiert auf die "Politik des leeren Stuhls" und den Luxemburger Kompromiss, die den Konflikt zwischen Intergouvernementalismus und Supranationalismus versöhnlich beendeten, jedoch auch die Schwächen des bestehenden europäischen Systems aufzeigten.
Schlüsselwörter
Europäische Integration, EWG-Krise, Intergouvernementalismus, Supranationalismus, Fouchet-Pläne, England-Veto, Luxemburger Kompromiss, Frankreich, Deutschland, Politik des leeren Stuhls.
- Quote paper
- Nils Dressel (Author), 2002, Die Krise der EWG in den 60er Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/8072