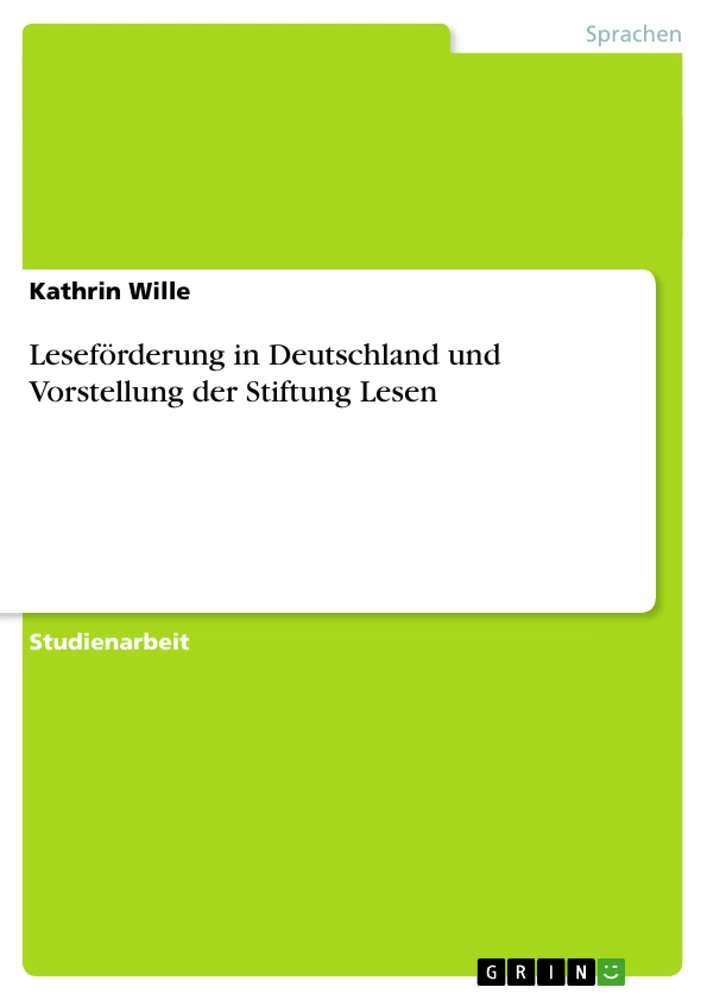Die Aktualität des Themas >>Leseförderung<< ist spätestens seit Veröffentlichung der Pisa-Studie im Jahr 2000 öffentlich bekannt geworden.
Das schlechte Abschneiden der deutschen Schüler im Bereich Lesetechnik und Leseverständnis löste heftige Diskussionen, sowohl in der Politik wie in den Medien, über mögliche Gegenmaßnahmen wie Leseförderung aus.
Um die Leseförderung im richtigen Kontext betrachten zu können, möchte ich zunächst kurz auf den Begriff des Lesens an sich und das Leseverhalten in Deutschland eingehen.
Der Begriff >>Lesen<< leitet sich von dem althochdeutschen >>lesan<< ab, was ursprünglich >>zusammentragen, sammeln<< bedeutete. Später wurde es auch für >>erzählen, berichten<< sowie für das Zusammenstellen von Buchstaben zu Wörtern >>und damit für die Sinnentnahme aus geschriebenen und gedruckten Sprachzeichen und im weiteren Sinne auch für die Sinndeutung vorgegebener Zeichen oder Zeichengruppen überhaupt<< verwendet.
Das Lesen ist also ein Prozess, schriftlich niedergelegte Informationen und Ideen aufzunehmen und zu verstehen. Dies kann man als Kulturtechnik bezeichnen, die vom Menschen geschaffen wurde, um miteinander kommunizieren zu können, und die von den Mitgliedern einer Gesellschaft erlernt werden muss, um am gesellschaftlichen Handeln teilnehmen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff des Lesens
- Das Leseverhalten in Deutschland
- PISA 2000
- Studie der Stiftung Lesen
- Leseförderung in Deutschland
- Allgemeines
- Leseförderungsmaßnahmen
- Leseförderung für Kinder und Jugendliche
- Initiatoren der Leseförderung
- Probleme
- Stiftung Lesen
- Projekte
- Wirtschaftliche Situation
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bedeutung der Leseförderung in Deutschland im Kontext der Ergebnisse der PISA-Studie 2000. Sie beleuchtet das veränderte Leseverhalten in Deutschland, analysiert verschiedene Leseförderungsmaßnahmen und stellt die Stiftung Lesen und ihre Projekte vor.
- Der Einfluss der PISA-Studie 2000 auf die öffentliche Diskussion über Leseförderung
- Die Entwicklung des Leseverhaltens in Deutschland im Kontext des digitalen Wandels
- Verschiedene Ansätze und Methoden der Leseförderung für unterschiedliche Altersgruppen
- Die Rolle der Stiftung Lesen als wichtige Institution für die Förderung der Lesekultur
- Herausforderungen und Chancen der Leseförderung in der heutigen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Aktualität des Themas Leseförderung im Kontext der PISA-Studie 2000 dar und erläutert den Aufbau der Arbeit.
- Der Begriff des Lesens: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs "Lesen" und definiert ihn als Kulturtechnik, die für gesellschaftliche Teilhabe und Kommunikation unerlässlich ist.
- Das Leseverhalten in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert das Leseverhalten in Deutschland anhand der Ergebnisse der PISA-Studie 2000 und der Studie "Leseverhalten der Deutschen im neuen Jahrtausend". Es zeigt die Herausforderungen und den Bedarf an Leseförderung auf.
- Leseförderung in Deutschland: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Ansätze und Maßnahmen der Leseförderung, die sich an unterschiedliche Altersgruppen richten, und beleuchtet die Rolle der Initiatoren.
- Stiftung Lesen: Dieses Kapitel stellt die Stiftung Lesen und ihre Projekte zur Förderung der Lesekultur vor, inklusive ihrer wirtschaftlichen Situation.
Schlüsselwörter
Leseförderung, PISA-Studie, Leseverhalten, digitale Medien, Stiftung Lesen, Lesekultur, Kulturtechnik, gesellschaftliche Teilhabe.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte die PISA-Studie 2000 auf die Leseförderung?
Das schlechte Abschneiden deutscher Schüler löste eine bundesweite Debatte über Lesetechnik und Leseverständnis sowie verstärkte Maßnahmen zur Leseförderung aus.
Was ist die Stiftung Lesen?
Die Stiftung Lesen ist eine zentrale Institution in Deutschland, die Projekte zur Förderung der Lesekultur bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen initiiert und durchführt.
Wie wird "Lesen" historisch definiert?
Der Begriff leitet sich vom althochdeutschen "lesan" (sammeln, zusammentragen) ab und entwickelte sich zur Bezeichnung für die Sinnentnahme aus schriftlichen Zeichen.
Warum gilt Lesen als wichtige Kulturtechnik?
Lesen ist die Voraussetzung für Kommunikation und die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Handeln in einer modernen Informationsgesellschaft.
Welche Rolle spielen digitale Medien bei der Leseförderung?
Der digitale Wandel verändert das Leseverhalten; Leseförderung muss heute auch digitale Kompetenzen einbeziehen und neue Formate nutzen, um junge Zielgruppen zu erreichen.
- Quote paper
- Kathrin Wille (Author), 2005, Leseförderung in Deutschland und Vorstellung der Stiftung Lesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/80333