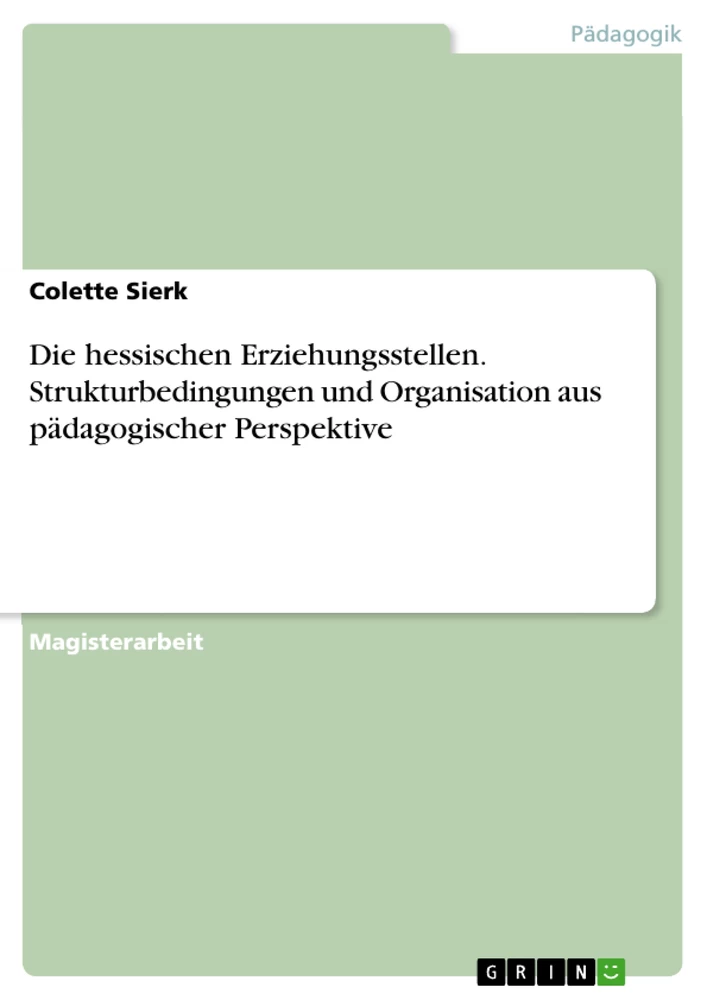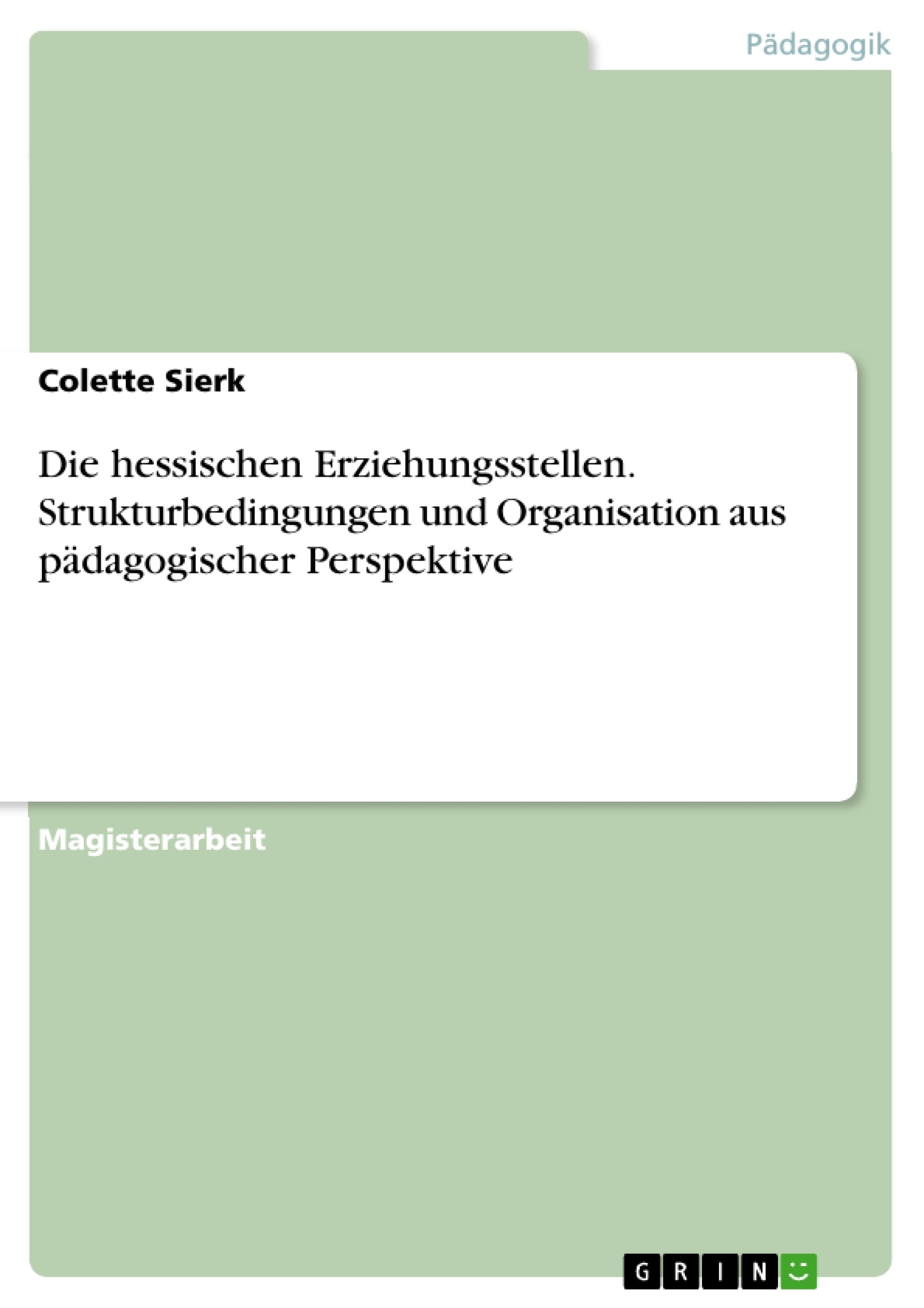Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Situation von in Erziehungsstellen betreuten Kindern. Ausgangsthese der vorliegenden Arbeit lautet dabei, dass die Qualität pädagogischer Maßnahmen in Hilfesystemen wie dem der Erziehungsstellen nicht nur von der Professionalität des pädagogischen Handelns abhängt, sondern auch von der Struktur des Hilfesystems. Diese Struktur wird aus einer konsequent pädagogischen Perspektive analysiert und anschließend beurteilt. Als theoretisches pädagogisches Fundament wird zum einen die Sichtweise der Psychoanalytischen Pädagogik, bezüglich der pädagogischen Professionalisierung zum anderen die Professionalisierungstheorie von Ulrich Oevermann zugrunde gelegt.
Struktur und Organisation des Hilfesystems "Erziehungsstellen" werden herausgearbeitet und mit den pädagogischen Erfordernissen in Beziehung gesetzt. Es wird gezeigt, dass die bestehenden Strukturen erheblichen Einfluss auf das pädagogische Geschehen nehmen und in einigen wesentlichen Punkten die professionalisierte pädagogische Arbeit, die in den Erziehungsstellen, den Fachdiensten und auch den Jugendämtern geleistet wird, degradieren und konterkarieren.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung – Problemstellung
- II. Die pädagogische Perspektive
- II.1 Pflegekinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen.
- II.2 Was brauchen diese „schwierigen“ Pflegekinder?
- II.2.1 Überlegungen zum pädagogischen Selbstverständnis..
- II.2.2 Psychoanalytische Pädagogik als theoretischer Standpunkt.………………………..
- II.2.3 Die psychoanalytische Sicht auf das Pflegekind
- II.2.4 Was brauchen Erziehungsstellenkinder? – Grundsätze psychoanalytischer Pädagogik für die Arbeit in Erziehungsstellen
- II.3 Pädagogische Professionalisierung..
- II.3.1 Die Professionalisierungstheorie Oevermanns.
- II.3.2 Bedingungen professionalisierten pädagogischen Handelns.
- III. Strukturbedingungen und Organisation der Erziehungsstellen des LWV Hessen
- III.1 Gesetzliche Bestimmungen..
- III.1.1 Allgemeine Vorschriften des KJHG.
- III.1.2 Rechtsanspruch
- III.1.3 Kindeswohl und Sorgerecht.
- III.1.4 Unbestimmte Rechtsbegriffe
- III.1.5 Gerichtliche Verfahrensvorschriften.
- III.1.6 Datenschutz und Verschwiegenheitspflicht.
- III.1.7 Hilfeformen.........
- III.1.8 Hilfeplan
- III.1.9 Finanzielle Leistungen
- III.1.10 Andere (hoheitliche) Aufgaben und Zuständigkeit........
- III.1.11 Ausstattung der Jugendämter
- III.1.12 Fortbildung und Eignung..
- III.1.13 Zusammenarbeit
- III.2 Die Organisation des Jugendamtes...
- III.3 Organisation und pädagogische Konzeption der Erziehungsstellen ...........
- III.3.1 Der Landeswohlfahrtsverband......
- III.3.2 Die Fachdienste und die Erziehungsstellen........
- III.4 Rechtliche Beziehungen..
- III.4.1 Die Gewaltenteilung.
- III.4.2 Das jugendhilferechtliche Dreiecksverhältnis.
- III.4.3 Die rechtliche Stellung des Kindes .........
- IV. Auswirkungen der strukturellen Vorgaben.......
- IV.1 Auswirkungen der Organisation des Fachdienstes und der Erziehungsstellen – Ergebnis 1
- IV.2 Auswirkungen der Organisation der Jugendamtsverwaltung..
- IV.3 Auswirkungen der Mittelzuweisung.......
- IV.4 Ergebnis 2...
- IV.5 Auswirkungen des Rechtsanspruchsregelungen
- IV.6 Auswirkungen der Zuständigkeitsregelungen .
- IV.7 Auswirkungen der „gerichtlichen Überprüfbarkeit“.
- IV.8 Ergebnis 3...
- IV.9 Auswirkungen der Verschwiegenheitspflicht – Ergebnis 4...
- IV.10 Ergebnisübersicht und Reflexion..\n_
- V. Förderliche Strukturen
- VI. Zusammenfassung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit von Colette Sierk untersucht die hessischen Erziehungsstellen aus pädagogischer Perspektive. Das Ziel der Arbeit ist es, die strukturellen Bedingungen und die Organisation der Erziehungsstellen zu analysieren und deren Auswirkungen auf die Qualität der pädagogischen Arbeit zu beleuchten.
- Die besonderen Bedürfnisse von Pflegekindern, insbesondere „schwierigen“ Kindern, und die Bedeutung von pädagogischer Professionalität für ihre Betreuung.
- Die Rolle von psychoanalytischer Pädagogik im Verständnis und der Arbeit mit Erziehungsstellenkindern.
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Jugendhilfe in Hessen und die spezifischen Anforderungen an die Organisation und das Management der Erziehungsstellen.
- Die Auswirkungen der verschiedenen strukturellen Ebenen – rechtliche, organisatorische und handlungsbezogene – auf die pädagogische Arbeit in den Erziehungsstellen.
- Die Bedeutung von professionellem pädagogischen Handeln und die Notwendigkeit eines strukturierten Hilfesystems, um den besonderen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung der Arbeit und die Relevanz des Themas erläutert. Anschließend werden die pädagogischen Perspektiven auf die Arbeit in Erziehungsstellen beleuchtet, wobei insbesondere auf die besonderen Bedürfnisse von Pflegekindern und die Bedeutung von pädagogischer Professionalisierung eingegangen wird. Das dritte Kapitel analysiert die Strukturbedingungen und Organisation der Erziehungsstellen in Hessen, wobei die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Organisation des Jugendamtes und die spezifische Konzeption der Erziehungsstellen im Detail beleuchtet werden. Im vierten Kapitel werden die Auswirkungen der strukturellen Vorgaben auf die pädagogische Arbeit in den Erziehungsstellen untersucht. Die Arbeit endet mit einem Kapitel über förderliche Strukturen und einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den hessischen Erziehungsstellen, der pädagogischen Arbeit mit „schwierigen“ Pflegekindern, psychoanalytischer Pädagogik, rechtlichen Rahmenbedingungen der Jugendhilfe, Organisation und Management der Erziehungsstellen, professionellem pädagogischem Handeln, strukturellen Bedingungen und deren Auswirkungen auf die Qualität der pädagogischen Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind hessische Erziehungsstellen?
Es handelt sich um eine Form der stationären Jugendhilfe, bei der Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in einem familiären Rahmen betreut werden.
Welche Kinder werden in Erziehungsstellen betreut?
Meist sind es Kinder mit schwierigen Biografien oder traumatischen Erfahrungen, die eine besonders intensive pädagogische Begleitung benötigen.
Welche Rolle spielt die Psychoanalytische Pädagogik in der Arbeit?
Sie dient als theoretisches Fundament, um die tiefenpsychologischen Bedürfnisse der Pflegekinder und die Dynamik in der Erziehungsstelle zu verstehen.
Wie beeinflussen Strukturen die pädagogische Qualität?
Die Arbeit zeigt, dass rechtliche und organisatorische Vorgaben (z.B. Zuständigkeiten, Datenschutz) die professionelle pädagogische Arbeit oft behindern können.
Was ist die Professionalisierungstheorie nach Oevermann?
Diese Theorie wird genutzt, um die Bedingungen für echtes professionelles Handeln in der Jugendhilfe zu analysieren und zu bewerten.
Was ist das „jugendhilferechtliche Dreiecksverhältnis“?
Es beschreibt die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Jugendamt, dem Leistungserbringer (Erziehungsstelle) und dem Leistungsberechtigten (Kind/Eltern).
- Quote paper
- M.A. Colette Sierk (Author), 2007, Die hessischen Erziehungsstellen. Strukturbedingungen und Organisation aus pädagogischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/80294