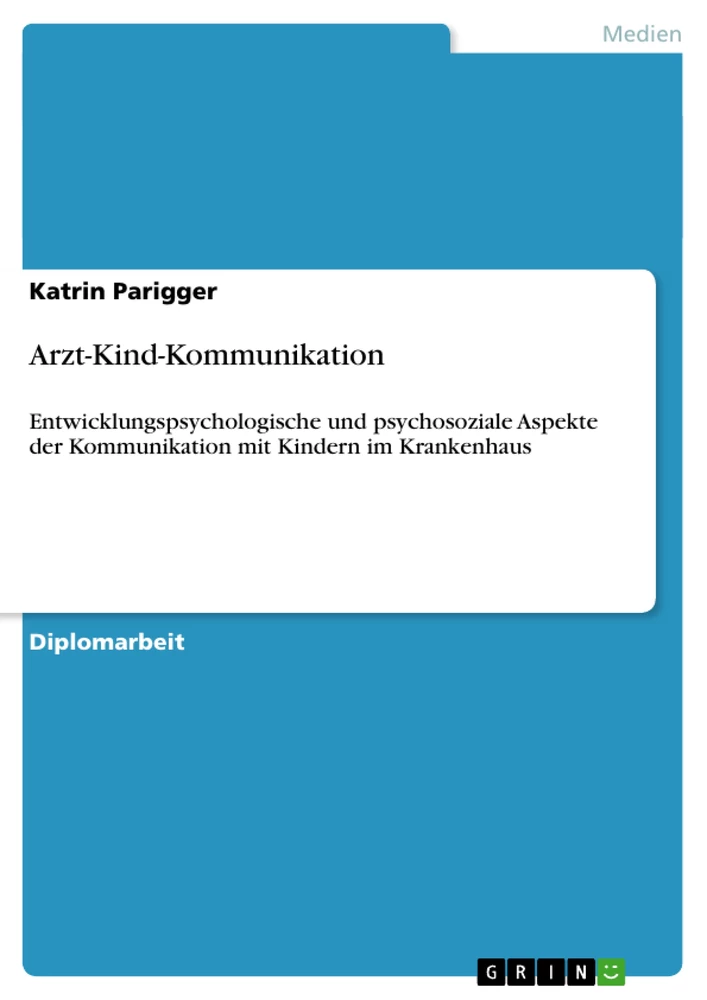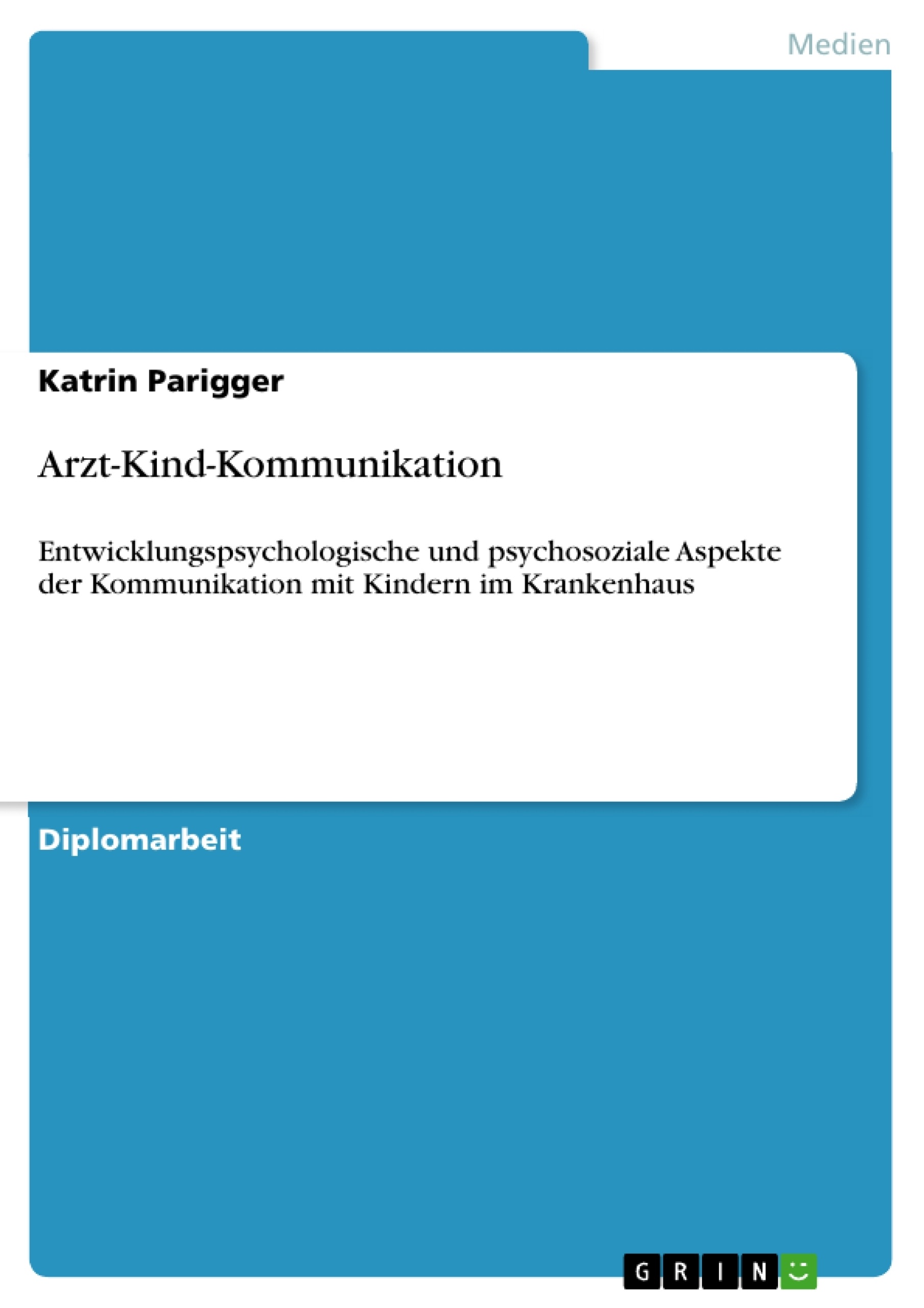Gegenstand: Analyse der Kommunikationsstrukturen mit stationär aufgenommenen Kindern im Krankenhaus.
Ziel: Unterstützung der Tendenz zur Sensibilisierung der Thematik „Kind im Krankenhaus“; Einblick in die entwicklungspsychologischen, kognitiven und sozialen Faktoren, welche in der Kommunikation mit stationär aufgenommenen Kindern vor allem von Seiten des medizinischen Fachpersonals berücksichtigt werden sollten.
Abgrenzung: Kommunikation wird als wechselseitig bewusst oder unbewusst stattfindender Prozess der Bedeutungsvermittlung verstanden. Beim Kind wird der Schwerpunkt auf die kognitiven Fähigkeiten und die soziale Einbettung gelegt. Geistige Gesundheit und Zugehörigkeit zur westlichen Gesellschaft sind die Rahmenbedingungen.
Hypothesen: Das Kind ist wegen seines jeweiligen Entwicklungsstandes und seiner Bevormundung durch die Eltern in der „schwächeren“ Position gegenüber dem Erwachsenen. Das durch seine organische Krankheit geschwächte Kind ist im Krankenhaus einer Reihe von zusätzlichen psychischen Belastungen ausgesetzt. Auf Grund dieser Aspekte muss mit Kindern im Krankenhaus in besonderer Form umgegangen und kommuniziert werden.
Ergebnisse und Schlussfolgerungen: Entwicklungsbedingt haben Kinder je nach Altersstufe begrenzte Verständnis- und Ausdrucksmöglichkeiten. Im Rahmen einer Erkrankung und eines Krankenhausaufenthaltes kommt es zu einer Reihe von Vorstellungen, Ängsten und Bedürfnissen, die Aufklärung, Aufmerksamkeit und Unterstützung verlangen. Eigenschaften „idealer“ Kommunikation mit Kindern im Krankenhaus sind: offen, ehrlich, aufrichtig; aktiv, motivierend; ganzheitlich, familienorientiert; abgestimmt auf Alter, Entwicklung, Persönlichkeit; kontinuierlich; vertrauensvoll, mitfühlend; unterstützend, akzeptierend. Es besteht ein großer Bedarf an internationalen Richtlinien und Standards sowie an spezieller Ausbildung des Personals.
Methoden: Literaturanalyse; Analyse und Vergleich internationaler empirischer Studien und Konzepte; Experteninterviews
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Problemstellung
- 2. Kind Sein
- 2.1 Kindheit im Wandel
- 2.1.1 Lloyd deMauses Evolution der Kindheit
- 2.1.2 Kindheit heute
- 2.2 Geistige Entwicklung des Kindes
- 2.2.1 Kognitive Entwicklung nach Jean Piaget
- 2.2.2 Persönlichkeitsentwicklung nach Erik H. Erikson
- 2.2.3 Sprachliche und kommunikative Entwicklung
- 2.2.4 Kindliche Entwicklung im therapeutischen Kontext
- 2.1 Kindheit im Wandel
- 3. Krank Sein - im Krankenhaus Sein
- 3.1 Kranke Kinder
- 3.1.1 Krankheitskonzepte und Krankheitserleben
- 3.1.2 Krankheitsbedingte Vorstellungen und Ängste
- 3.1.3 Kindliche Krankheitsbewältigung
- 3.1.4 Exkurs: Akute, chronische und lebensbedrohliche Krankheiten
- 3.2 Kinder im Krankenhaus
- 3.2.1 Das Kinderkrankenhaus und seine Entwicklung
- 3.2.2 Die Problematik „Kind im Krankenhaus“
- 3.2.3 Spezifische Ängste und Bedürfnisse im Krankenhaus
- 3.2.4 Konzepte und Beispiele zur Verbesserung der Situation
- 3.1 Kranke Kinder
- 4. Kommunikation mit Kindern im Krankenhaus
- 4.1 Grundlegende Aspekte der Arzt-Patient-Kommunikation
- 4.1.1 Die fünf kommunikationspsychologischen Axiome
- 4.1.2 Sprachloses oder sprachliches Leid?
- 4.2 „Arzt-Kind-Kommunikation“ - Wo stehen wir?
- 4.2.1 Der Stand der Forschung – ein Review
- 4.2.2 Problematiken in der Kommunikationspraxis
- 4.2.3 Die EACH-Charta - Rechte des Kindes im Krankenhaus
- 4.3 Ansätze einer „neuen“ Arzt-Kind-Kommunikation
- 4.3.1 Kommunikation mit und Information von kranken Kindern
- 4.3.2 Die Rolle der Ärzte und des Pflegepersonals
- 4.3.3 Die Rolle der Eltern
- 4.3.4 Das psychosoziale Betreuungskonzept des St. Anna Kinderspitals Wien
- 4.1 Grundlegende Aspekte der Arzt-Patient-Kommunikation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Arzt-Kind-Kommunikation im Krankenhaus, fokussiert auf entwicklungspsychologische und psychosoziale Aspekte. Ziel ist es, die Notwendigkeit eines angemessenen kommunikativen Umgangs mit kranken Kindern zu betonen und Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.
- Entwicklungspsychologische Besonderheiten von Kindern
- Situation kranker Kinder im Krankenhaus
- Analyse der Kommunikationsabläufe zwischen Kindern, Eltern und medizinischem Personal
- Problematiken in der Arzt-Kind-Kommunikation
- Ansätze zur Verbesserung der Arzt-Kind-Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung begründet die Relevanz der Arbeit mit dem Fokus auf die Verbesserung der Arzt-Kind-Kommunikation im Krankenhaus. Es wird argumentiert, dass die Kommunikation mit Kindern im Krankenhaus trotz Fortschritten in der allgemeinen Arzt-Patient-Kommunikation ein weitgehend unerforschtes Feld ist. Die Arbeit hebt die Notwendigkeit hervor, die spezifischen kognitiven und psychosozialen Bedürfnisse von Kindern in dieser Situation zu berücksichtigen.
2. Kind Sein: Dieses Kapitel beleuchtet die kindliche Entwicklung aus entwicklungspsychologischer Perspektive. Es betrachtet den Wandel des Kindesbildes im historischen Kontext und analysiert die kognitive, persönlichkeitsbezogene und sprachliche Entwicklung des Kindes. Besonderes Augenmerk liegt auf der Berücksichtigung der kindlichen Entwicklung im therapeutischen Kontext, um die Grundlage für ein verständnisvolles und kindgerechtes Vorgehen im Krankenhaus zu schaffen.
3. Krank Sein - im Krankenhaus Sein: Dieses Kapitel beschreibt die Situation kranker Kinder im Krankenhaus. Es werden Krankheitskonzepte und das Krankheitserleben von Kindern untersucht, sowie spezifische Ängste und Bedürfnisse im Krankenhauskontext thematisiert. Es werden bestehende Konzepte und Beispiele zur Verbesserung der Situation kranker Kinder im Krankenhaus vorgestellt, welche die Grundlage für die weiteren Kapitel bilden.
4. Kommunikation mit Kindern im Krankenhaus: Das Herzstück der Arbeit konzentriert sich auf die Kommunikation mit Kindern im Krankenhaus. Es werden grundlegende Aspekte der Arzt-Patient-Kommunikation erläutert, der aktuelle Forschungsstand zur Arzt-Kind-Kommunikation dargestellt und bestehende Problematiken analysiert. Schließlich werden Ansätze für eine verbesserte Arzt-Kind-Kommunikation vorgestellt, unter Berücksichtigung der Rolle von Ärzten, Pflegepersonal und Eltern. Das psychosoziale Betreuungskonzept eines Wiener Kinderspitals dient als Beispiel für gute Praxis.
Schlüsselwörter
Arzt-Kind-Kommunikation, Krankenhaus, Kinder, Entwicklungspsychologie, Psychosoziale Aspekte, Kommunikation, Krankheitserleben, Ängste, Kindesrechte, EACH-Charta, therapeutischer Kontext, Kommunikationsmodelle.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Arzt-Kind-Kommunikation im Krankenhaus
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Arzt-Kind-Kommunikation im Krankenhaus unter Berücksichtigung entwicklungspsychologischer und psychosozialer Aspekte. Das Ziel ist, die Notwendigkeit eines angemessenen kommunikativen Umgangs mit kranken Kindern aufzuzeigen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die entwicklungspsychologischen Besonderheiten von Kindern, die Situation kranker Kinder im Krankenhaus, die Analyse der Kommunikationsabläufe zwischen Kindern, Eltern und medizinischem Personal, Problematiken in der Arzt-Kind-Kommunikation und Ansätze zur Verbesserung dieser Kommunikation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung und Problemstellung, Kind Sein, Krank Sein - im Krankenhaus Sein und Kommunikation mit Kindern im Krankenhaus. Jedes Kapitel befasst sich mit spezifischen Aspekten der Arzt-Kind-Kommunikation, beginnend mit einer Einführung in die kindliche Entwicklung und der Situation kranker Kinder im Krankenhaus, um schließlich Ansätze zur Verbesserung der Kommunikation zu präsentieren.
Welche Aspekte der kindlichen Entwicklung werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den Wandel des Kindesbildes im historischen Kontext und analysiert die kognitive, persönlichkeitsbezogene und sprachliche Entwicklung des Kindes. Besonderes Augenmerk liegt auf der Berücksichtigung der kindlichen Entwicklung im therapeutischen Kontext.
Wie wird die Situation kranker Kinder im Krankenhaus beschrieben?
Die Arbeit untersucht Krankheitskonzepte und das Krankheitserleben von Kindern, thematisiert spezifische Ängste und Bedürfnisse im Krankenhauskontext und stellt bestehende Konzepte und Beispiele zur Verbesserung der Situation kranker Kinder vor.
Welche Aspekte der Arzt-Kind-Kommunikation werden analysiert?
Die Arbeit erläutert grundlegende Aspekte der Arzt-Patient-Kommunikation, stellt den aktuellen Forschungsstand zur Arzt-Kind-Kommunikation dar und analysiert bestehende Problematiken. Sie präsentiert Ansätze für eine verbesserte Arzt-Kind-Kommunikation, unter Berücksichtigung der Rolle von Ärzten, Pflegepersonal und Eltern. Ein Beispiel für gute Praxis wird anhand des psychosozialen Betreuungskonzepts eines Wiener Kinderspitals vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arzt-Kind-Kommunikation, Krankenhaus, Kinder, Entwicklungspsychologie, Psychosoziale Aspekte, Kommunikation, Krankheitserleben, Ängste, Kindesrechte, EACH-Charta, therapeutischer Kontext, Kommunikationsmodelle.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit betont die Notwendigkeit eines angemessenen kommunikativen Umgangs mit kranken Kindern und zeigt Verbesserungspotenziale auf. Sie unterstreicht die Bedeutung der Berücksichtigung der spezifischen kognitiven und psychosozialen Bedürfnisse von Kindern im Krankenhaus.
- Quote paper
- Katrin Parigger (Author), 2006, Arzt-Kind-Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/78623