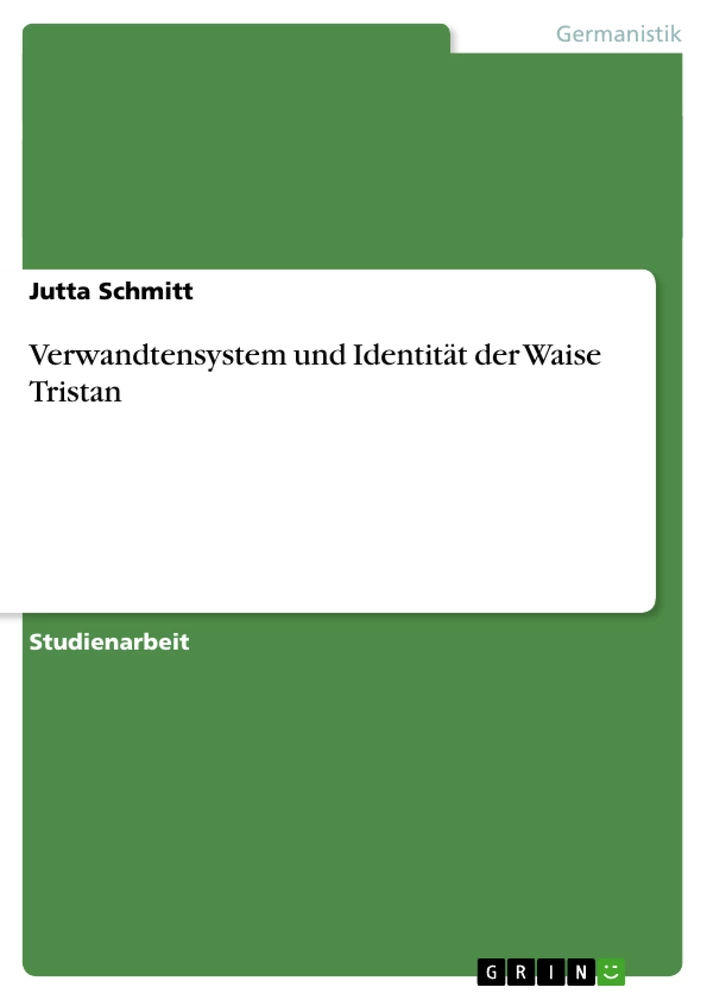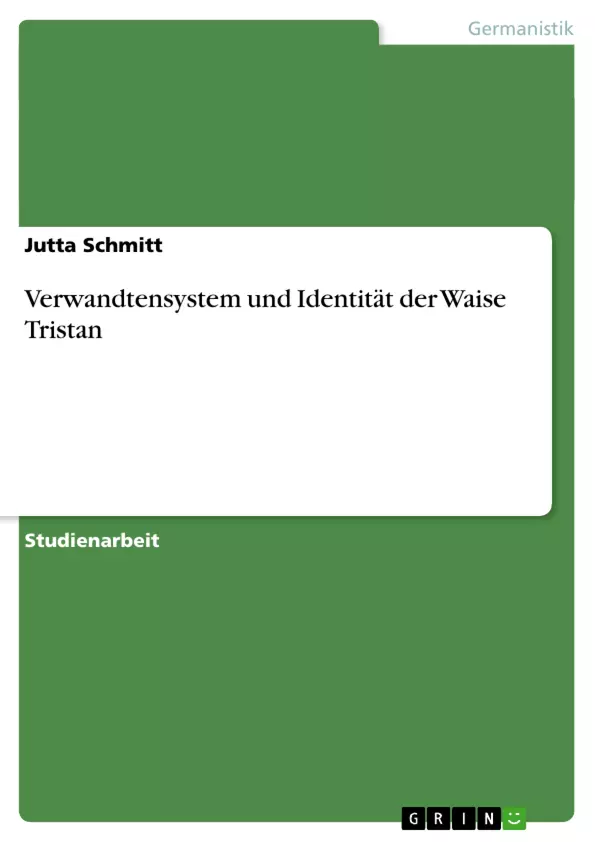Gottfrieds Roman Tristan ist wahrscheinlich einer der bekanntesten und für die Literaturwissenschaft auch einer der interessantesten Texte des 12. und 13. Jahrhunderts. Der Roman ist einerseits geprägt von der persönlichen Geschichte seines Helden, dem jungen Tristan, der bereits als Waise zur Welt kommt, andererseits aber auch von der Geschichte seiner Eltern, die sich in ihm spiegelt und von dem Verwandtensystem in das er hineingeboren wird.
Besonders was die Kindheit und Jugend der Waise anbetrifft, gibt es gewisse Elemente, die Gottfrieds Tristan mit anderen Helden mittelhochdeutscher Epen, wie beispielsweise Parzival und Gregorius, gemeinsam hat und die das Werk als typisch für seine Zeit charakterisieren.
So lassen sich in der Kindheit und Jugendzeit Tristans gewisse Stationen und Elemente ausmachen, die in allen vergleichbaren zeitgenössischen Epen wiederkehren und auch in den oben genannten Werken zu finden sind.
Um ihren Status in der Literatur zu rechtfertigen, müssen die Heldenkinder diese Stationen auf ihrem Weg ins Erwachsensein durchlaufe bzw. die einzelnen Elemente müssen in ihrem Lebenslauf gegeben sein.
Diese Stationen und Elemente sind: Die adelige Abstammung des Helden, die ungewöhnliche Zeugung desselben (im Tristan auf dem Totenbett des Vaters), die verborgene Geburt der Heldenkinder, die frühe Verwaisung (im Tristan quasi während der Geburt), die Gefahr in der der junge Held schwebt (hier durch den Mörder seines Vaters Morgân), die wundersame Rettung (bei Tristan durch Floraetes Scheinschwangerschaft), das ungemäße Aufwachsen (beim Marschall seines Vaters), die Offenbarung seiner Tugenden und die Offenbarung von Namen und Herkunft des jungen Helden (in Gottfrieds Werk durch den Marschall des Vaters: Rûal).
Allerdings gibt es neben diesen verbindenden Aspekten gerade in der Elterngeschichte, in den verwandtschaftlichen Beziehungen und im Identitätsfindungsprozess Tristans viele Aspekte, die den Roman von den übrigen zeitgenössischen Werken abgrenzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Autor und Werk
- Das Verwandtensystem
- Verwandtschaftliche Zusammenhänge
- Bedeutsamkeit der verwandtschaftlichen Beziehung
- Identitätsstiftende Aspekte im Tristan
- Identitätsstiftung und Identitätsverleugnung durch den Namen
- Identität durch Legitimation
- Identität durch Vater und Vaterbild
- Die Beziehung zum leiblichen Vater
- Die Beziehung zum „Pflegevater“
- Die Beziehung zum Onkel und die Bedeutung des Avunkulats im Tristan
- Brüche in den verwandtschaftlichen Beziehungen – Brüche mit den Vätern
- Verwandtschaft und Gesellschaft kontra Minne
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Verwandtensystem und die Identität des Waisen Tristan in Gottfrieds Roman. Ziel ist es, die besondere Bedeutung der verwandtschaftlichen Beziehungen für Tristans Entwicklung und die Herausforderungen, die seine verwaiste Existenz mit sich bringt, zu beleuchten.
- Die Bedeutung der verwandtschaftlichen Beziehungen für die Identitätsfindung des Waisen Tristan
- Die Rolle des Vaters und der verschiedenen Vaterfiguren in Tristans Leben
- Die Herausforderungen der verwaisten Existenz für Tristans Selbstverständnis
- Der Einfluss der verwandtschaftlichen Strukturen auf Tristans Beziehungen zu anderen Figuren
- Der Konflikt zwischen den traditionellen Werten der Gesellschaft und der Minneliebe
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung stellt Gottfrieds Roman Tristan als ein bedeutendes Werk des 12. und 13. Jahrhunderts vor und hebt die Besonderheiten der Geschichte des Waisen Tristan hervor. Sie vergleicht Tristan mit anderen Helden mittelhochdeutscher Epen und zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf ihre Lebensläufe und Identitätsfindungsprozesse.
- Autor und Werk: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über Gottfried von Straßburg und die Entstehung des Romans. Es beleuchtet die Handlungsschritte des Romans, insbesondere die Elterngeschichte und die Kindheit Tristans, und beleuchtet die Quellen und Inspirationen des Werkes.
- Das Verwandtensystem: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen verwandtschaftlichen Beziehungen, die Tristan prägen. Es betrachtet die Bedeutung der verwandtschaftlichen Beziehungen für Tristans Identität und die Rolle der Familie in der mittelalterlichen Gesellschaft.
- Identitätsstiftende Aspekte im Tristan: Dieses Kapitel untersucht, wie Tristans Identität durch verschiedene Faktoren geprägt wird. Es analysiert die Bedeutung von Name, Legitimation und Vaterfiguren für die Entwicklung seines Selbstverständnisses.
- Brüche in den verwandtschaftlichen Beziehungen – Brüche mit den Vätern: Dieses Kapitel beleuchtet die Konflikte und Brüche, die in Tristans verwandtschaftlichen Beziehungen auftreten. Es analysiert die schwierige Beziehung zu seinen Vätern und die Folgen für seine Identität.
- Verwandtschaft und Gesellschaft kontra Minne: Dieses Kapitel setzt sich mit dem Konflikt zwischen den traditionellen Werten der Gesellschaft und der Minneliebe auseinander. Es betrachtet die Frage, wie sich Tristans verwandtschaftliche Beziehungen auf seine romantische Beziehung zu Isolde auswirken.
Schlüsselwörter
Der Roman Tristan ist geprägt von Themen wie Verwandtschaft, Identität, Minneliebe, Vater-Kind-Beziehungen, Verwaisung, mittelalterliche Gesellschaft, höfische Kultur und literarische Traditionen des Mittelalters.
- Quote paper
- Jutta Schmitt (Author), 2006, Verwandtensystem und Identität der Waise Tristan, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/78280