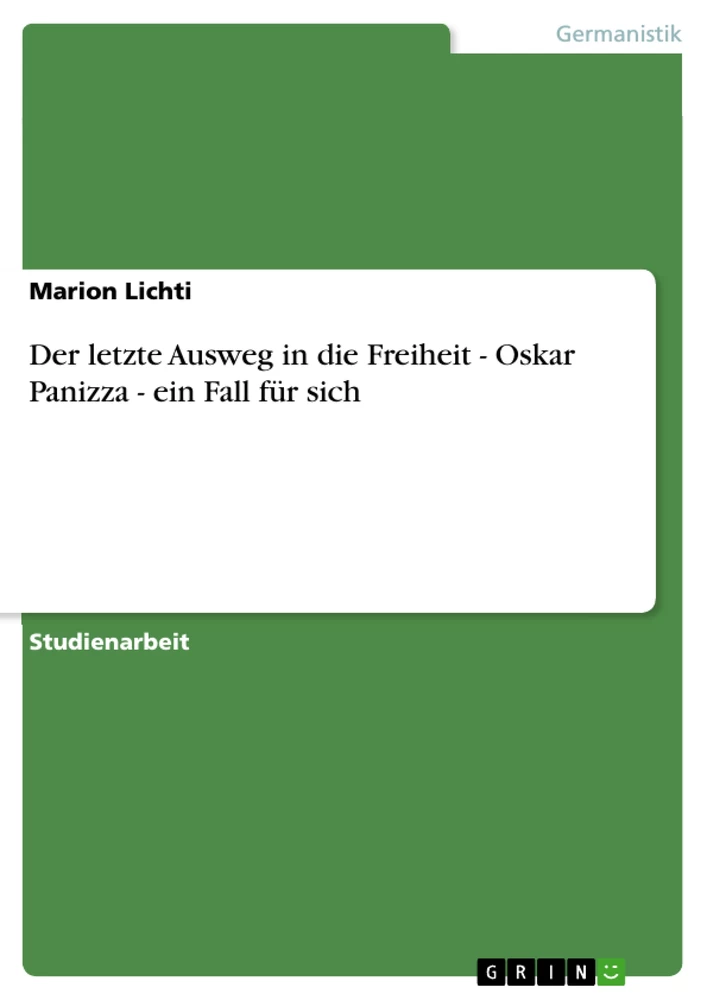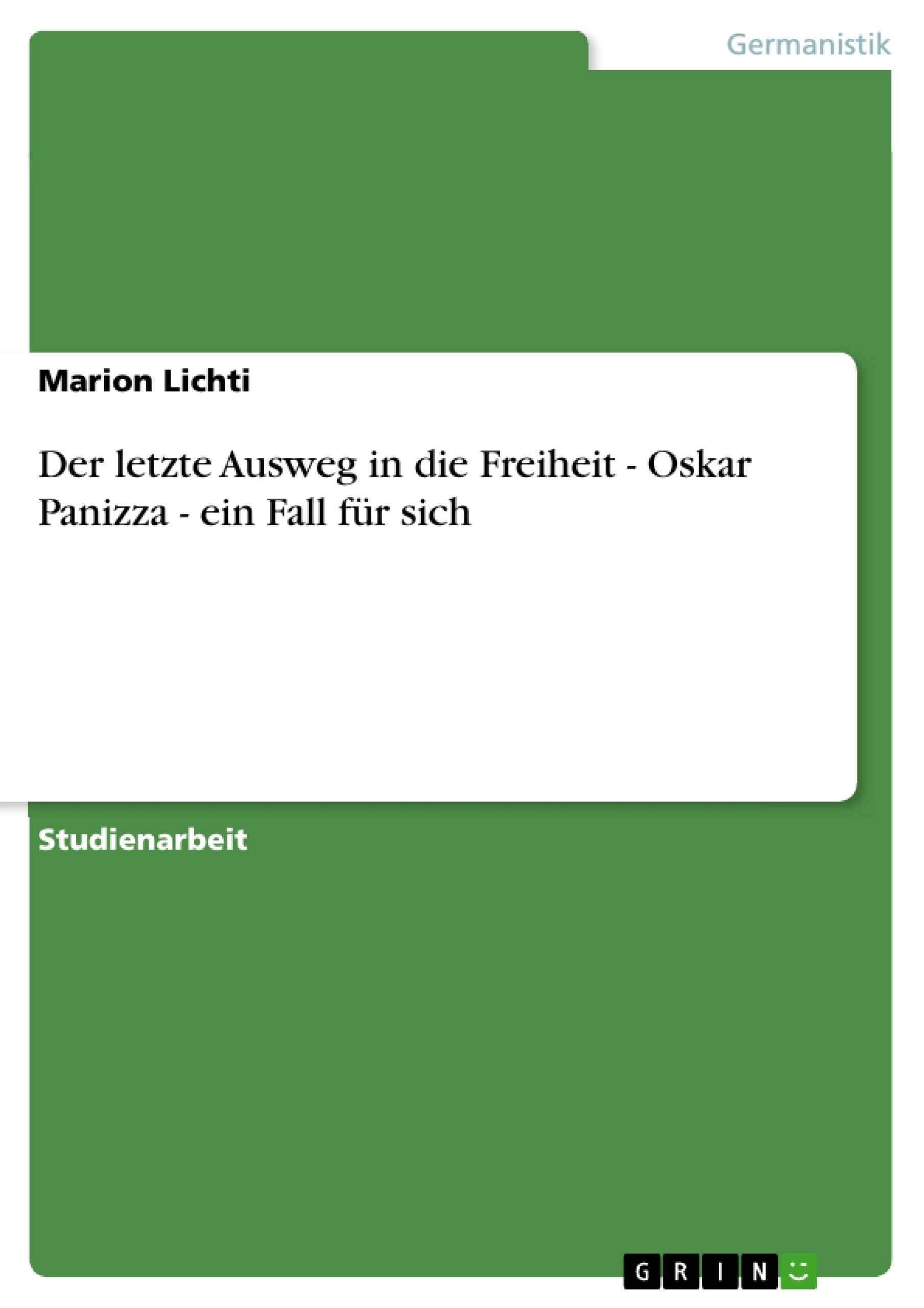Ausgangspunkt dieser Arbeit sind Zweifel an der Berechtigung der Internierung und Entmündigung von Oskar Panizza, sowie an seiner Stigmatisierung als Geisteskranker. Meine These ist, dass Oskar Panizza von Kindesbeinen an zwischen die Mühlsteine von gesellschaftlichen Verhältnissen geraten ist. Er – weit entfernt davon Ursache dieser Verhältnisse zu sein – hat sich ihnen sicher nicht brav entzogen und wurde somit mehr als einmal zur Zielscheibe für diejenigen Verfechter der Wahrheit und des Gesetzes, die ein Exempel statuieren wollten.
Wer Oskar Panizza war, was er wollte und was geschah, kann man nur dann ansatzweise verstehen, wenn man sein Leben in einen größeren politischen und kulturellen Kontext eingebettet betrachtet.
Da eine vollständige Analyse seines schillernden Lebens den Rahmen dieser Arbeit leider sprengt, wird auf drei exemplarische Phasen seines Lebens größeres Gewicht gelegt, die jeweils zu einem „Fall Panizza“ führten und mit ihren Ursachen und Auswirkungen entscheidend für das Verstehen von Leben und Werk von Oskar Panizza sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: genial oder geisteskrank?
- Der erste „Fall Panizza“- zwischen den Mühlrädern von Staat und Kirche
- Streit um die Konfession der Kinder Panizza: Die Eltern
- Streit um die Konfession der Kinder Panizza: Kirche und Staat
- Staat und Kirche: historischer Exkurs
- Problematik der Mischehen
- Machtverlust der katholischen Kirche in den deutschen Ländern
- Radikalisierung der katholischen Kirche
- Die Katholische Kirche und die Moderne
- Der erste Fall Panizza und seine Folgen für Oskars Leben
- Der Berufswunsch der Mutter
- Welche Rolle hat der Berufswunsch der Mutter in Panizzas Leben gespielt?
- Die Sehnsucht nach Freiheit und Grundsteine für sein späteres literarisches Schaffen
- Der Zweite Fall Panizza: Die katholische Kirche, die liberale Regierung und der Geist der Naturalisten / Geisteskrankheit als Rettung
- Vom Arzt zum Dichter
- Panizzas Auseinandersetzung mit dem Begriff „krank“
- Kultur im München des 19. Jahrhunderts
- Martin Georg Conrad und die „Gesellschaft für Modernes Leben“
- Im „Mittelpunkt des Intereßes“
- Panizza und die „Modernen“
- Die Mühen des Staatsanwalts / Der Fall Panizza
- Etwas ist faul im Staate Bayern
- Das hohe Strafmaß
- Kratzen an der katholischen Kirche
- Panizza – ein gefährlicher Sozialdemokrat
- Panizza – ein Märtyrer?
- Das Gnadengesuch
- Der dritte Fall Panizza: Geisteskrankheit als Urteil
- München – Zürich
- Psichopatia Criminalis - die Erste
- Panizza – Ein Kaiserinnen-Mörder?
- Psichopatia Criminalis – die Zweite
- Der vierte Fall Panizza: Der „Fall“ Panizza
- Die Diagnose
- Das Entmündigungsverfahren
- Der entmündigte Kranke
- Krank oder nicht krank? Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit Oskar Panizza und seiner Stigmatisierung als Geisteskranker. Sie analysiert exemplarische Phasen seines Lebens, die zu einem "Fall Panizza" führten, und setzt diese in den politischen und kulturellen Kontext des späten 19. Jahrhunderts.
- Die Konflikte zwischen Oskar Panizza, der katholischen Kirche und dem Staat
- Die Rolle des "geisteskranken" Künstlers in der Gesellschaft
- Die Bedeutung der "Modernen" Bewegung im München des 19. Jahrhunderts
- Die gesellschaftliche und politische Verwertbarkeit von Psychiatrie und Pathographie
- Die Bedeutung der individuellen Freiheit und Autonomie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit untersucht die Frage, ob Oskar Panizza ein Geisteskranker oder ein Vorreiter seiner Zeit war. Es werden verschiedene Perspektiven auf sein Leben und Werk dargestellt.
- Der erste „Fall Panizza“: Beschreibt den Streit um die Konfessionelle Erziehung der Kinder Panizza. Die Mutter, Mathilde Panizza, kämpft gegen die katholische Kirche um das Recht ihre Kinder protestantisch erziehen zu dürfen.
- Der zweite „Fall Panizza“: Behandelt die Verurteilung von Oskar Panizza wegen Gotteslästerung aufgrund seines Theaterstücks "Das Liebeskonzil". Der Prozess wird als ein Exempel statuieren angesehen, um die „Modernen" und ihre Kritik an Religion und Gesellschaft einzuschüchtern.
- Der dritte „Fall Panizza“: Zeigt die Ausweisung von Oskar Panizza aus Zürich und seine anschließende Einweisung in eine Irrenanstalt in München. Panizza wird als geisteskrank diagnostiziert, obwohl er selbst die Diagnose als eine Satire auf die politische Verwertbarkeit von Psychiatrie sieht.
- Der vierte „Fall Panizza“: Beschreibt die Entmündigung von Oskar Panizza aufgrund seines vermeintlichen Verfolgungswahns. Die Arbeit argumentiert, dass Panizzas geistige Verwirrung die Folge seiner Verfolgung durch den Staat und die Kirche war, und nicht eine krankhafte Geistesverfassung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der Pathographie im Kontext des deutschen fin-de-siècle. Sie analysiert das Leben und Werk von Oskar Panizza, einem Künstler, der sowohl als Genie als auch als Geisteskranker wahrgenommen wurde. Die Arbeit beleuchtet dabei die Konflikte zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft, die Rolle der Kirche und des Staates in der kulturellen Entwicklung und die Bedeutung von Freiheit und Autonomie.
- Arbeit zitieren
- Marion Lichti (Autor:in), 2007, Der letzte Ausweg in die Freiheit - Oskar Panizza - ein Fall für sich, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/76645