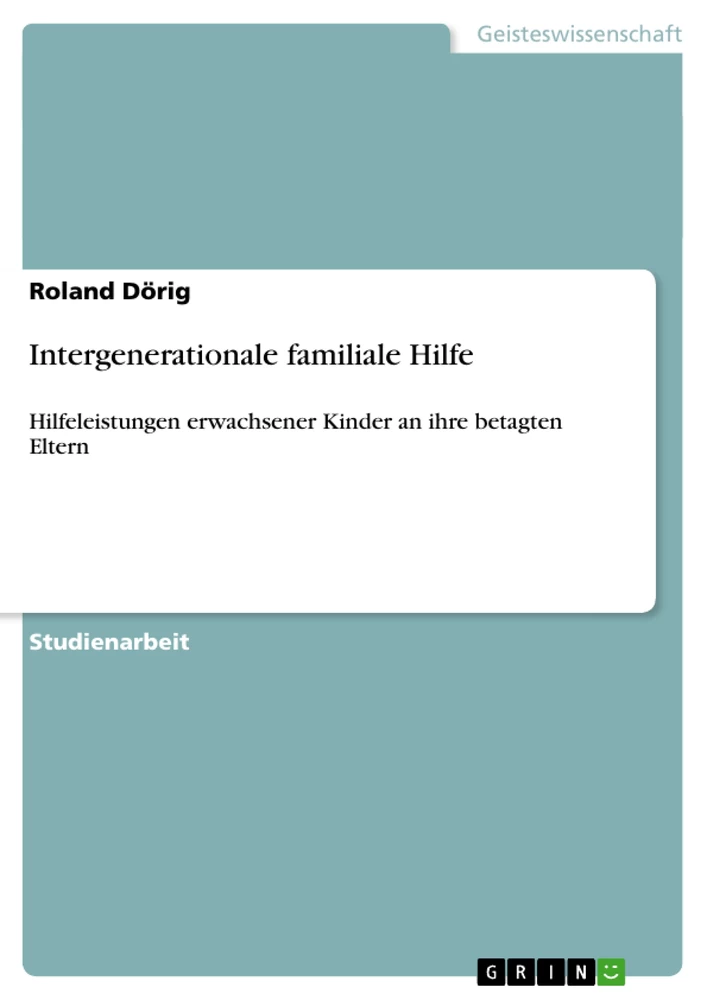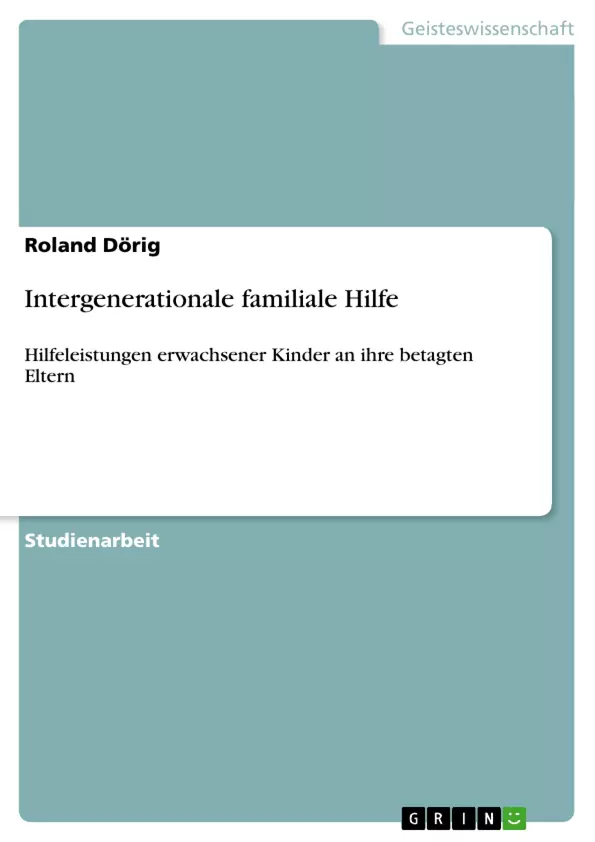Demographische Veränderungen in den letzten Jahrzehnten haben zu bedeutsamen Veränderungen in den Familienstrukturen geführt. Zum einen hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung zwischen 1900 und 2000 verdoppelt und zudem sind die Geburtenraten massiv gesunken (Bengtson & Martin, 1991). Diese Veränderungen haben zur Folge, dass es vermehrt Familien gibt, in denen drei, vier oder sogar fünf Generationen gleichzeitig leben (Grundy & Henretta, 2006). Bengtson, Rosenthal und Burton (1990; zit. nach Bengtson & Martin, 1991, S. 707) sprechen im Zusammenhang mit dem gestiegenen Anteil an Mehrgenerationenfamilien von einer Vertikalisierung der Familienstrukturen. Da der Anteil an Familienmitgliedern, die einer anderen Generation angehören grösser geworden und durch die erhöhte Lebenserwartung auch die gemeinsame Lebensdauer verschiedener Generationen gestiegen ist, hat die Thematik intergenerationaler Beziehungen an Wichtigkeit gewonnen (Szydlik, 1995).
Bengtson und Roberts (1991) betrachten intergenerationale Beziehungen aus der Perspektive intergenerationaler Solidarität. Zentraler Aspekt des mehrdimensionalen Konstrukts intergenerationaler Solidarität ist die funktionale Solidarität, die den Austausch von Hilfe beschreibt. Attias-Donfut (2001) zeigte in einer Studie mit französischen Familien, dass zwischen Kindern, ihren beruftätigen Eltern und deren alten, pensionierten Eltern ein gegenseitiger Austausch von Hilfe zu beobachten ist.
Angesichts der hohen Komplexität familiärer Beziehungen zwischen mehreren Generationen wird sich der Fokus vorliegender Arbeit auf die intergenerationale Hilfe von erwachsenen Kindern an ihre alten Eltern richten. Aldous (1987; zit. nach Walker & Pratt, 1991, S. 4) berichten, dass sich erwachsene Kinder und ihre alten Eltern gegenseitig unterstützen. Die erwachsenen Kinder unterstützen ihre Eltern bei Dingen, die physische Kraft erfordern, während die Eltern ihre Kinder vor allem finanziell unter die Arme greifen. Hilfeleistung erwachsener Kinder an ihre alten Eltern ist ein weit verbreitetes Phänomen und trägt in entscheidendem Masse zur Aufrechterhaltung von Autonomie resp. zur Verzögerung von Abhängigkeit und somit zur Lebensqualität betagten Menschen bei (Bazo & Ancizu, 2003). Britische Studien haben ergeben, dass 15 % der erwachsenen Bevölkerung Hilfeleistungen für ihre alten Eltern erbringen (Lowenstein & Daatland, 2006). Lowenstein und Daatland (2006) bemerken dazu, dass erwachsene Kinder die wichtigsten Erbringer von Hilfeleistungen an ihre betagten Eltern sind und somit das Rückgrad des Unterstützungssystems älterer Menschen bilden.
In Form einer „Literaturreview“ soll die vorliegende Arbeit die wichtigsten Aspekte des überaus bedeutsamen Themas intergenerationaler familialer Hilfe von erwachsenen Kindern an ihre betagten Eltern erörtern.
Primär sollen dabei folgende Fragestellungen beantwortet werden:
· Wer erhält Hilfe?
· Wer leistet Hilfe?
· Nach welchen Prinzipien wird Hilfe geleistet?
· Gibt es im europäischen Vergleich Länderunterschiede bezüglich Hilfeleistungen von erwachsenen Kindern an ihre Eltern?
In einer anfänglichen Begriffsklärung soll erläutert werden, was der Begriff Hilfe im genannten Kontext beinhaltet. Im Zentrum steht dabei die Abgrenzung vom Begriff Hilfe zum Begriff Pflege, sowie eine Kategorisierung verschiedener Formen der Hilfeleistung. Im Anschluss wird die Frage nach den Erbringern und Empfängern von Hilfeleitungen behandelt. Es ist anzunehmen, dass nicht alle betagten Eltern in selbem Masse Unterstützung von ihren erwachsenen Kindern erfahren und auch nicht alle Kinder gleich viel Hilfe leisten. Anhand der wichtigsten, vorwiegend demographischen Charakteristika von Eltern und Kindern wird erläutert, wer Hilfe bekommt resp. leistet und womit dies zu tun haben mag. Der dritte Teil dieser Arbeit widmet sich dann den Prinzipien nach denen Hilfe geleistet wird. In Anlehnung an theoretische Erklärungsansätze werden empirische Befunde zu möglichen Motiven und Mustern von Hilfeleistungen erwachsener Kinder an ihre Eltern diskutiert.
Abschliessend soll die vorwiegend mikro- und mesosoziologische Perspektive durch einen europäischen Vergleich auf Länderebene ergänzt werden. Es wird exemplarisch dargestellt, inwiefern kulturelle Unterschiede innerhalb Europas die intergenerationale Hilfe prägen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. BEGRIFFSKLÄRUNG
- 2.1 ABGRENZUNG HILFE VERSUS PFLEGE
- 2.1.1 ADL versus IADL
- 2.1.2 Kriterium der Abhängigkeit
- 2.1.3 Methodische Implikationen
- 2.3 KATHEGORISIERUNG VON HILFELEISTUNGEN
- 3. CHARAKTERISTIKA VON ERBRINGERN UND EMPFÄNGERN VON HILFE
- 3.1 WER LEISTET HILFE?
- 3.2 WEM WIRD GEHOLFEN?
- 4. PRINZIPIEN NACH DENEN HILFE GELEISTET WIRD
- 4.1 THEORETISCHE BEZÜGE
- 4.2 NORMATIVE VERANTWORTUNG GEGENÜBER ELTERN (NORMS OF FILIAL RESPONSIBILITY)
- 4.3 EMOTIONALE VERBUNDENHEIT
- 4.3 REZIPROZITÄT
- 5. HILFE IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH
- 6. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem wichtigen Thema der intergenerationalen familialen Hilfe von erwachsenen Kindern an ihre betagten Eltern. Sie zielt darauf ab, die wichtigsten Aspekte dieses Themas zu beleuchten und zentrale Fragestellungen zu beantworten, die sich auf die Erbringer, Empfänger und die Prinzipien der Hilfeleistung beziehen.
- Untersuchung des Begriffs "Hilfe" im Kontext intergenerationaler Beziehungen und Abgrenzung zur Pflege
- Analyse der Charakteristika von Erbringern und Empfängern der Hilfeleistung, insbesondere die demographischen Faktoren
- Diskussion der Prinzipien, die der Hilfeleistung zugrunde liegen, unter Einbezug theoretischer Erklärungsansätze und empirischer Befunde
- Einbezug des europäischen Vergleichs, um den Einfluss kultureller Unterschiede auf die intergenerationale Hilfe aufzuzeigen
- Erforschung der Bedeutung von intergenerationaler Solidarität im Kontext der alternden Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema intergenerationaler familialer Hilfe ein und beleuchtet die demographischen Veränderungen, die die Relevanz dieses Themas verstärken. Kapitel 2 definiert den Begriff "Hilfe" im Kontext der Arbeit und grenzt ihn von "Pflege" ab. Es werden verschiedene Kategorien von Hilfeleistungen vorgestellt und die Unterscheidung zwischen ADL und IADL erläutert.
Kapitel 3 untersucht die Charakteristika von Erbringern und Empfängern von Hilfeleistungen. Es wird diskutiert, wer Hilfe leistet und wer Hilfe erhält, wobei demographische Faktoren wie Alter, Geschlecht und Familiengröße eine Rolle spielen. Kapitel 4 fokussiert auf die Prinzipien, die der Hilfeleistung zugrunde liegen. Anhand theoretischer Ansätze und empirischer Befunde werden mögliche Motive und Muster der Hilfeleistung erwachsener Kinder an ihre Eltern analysiert.
Schlüsselwörter
Intergenerationale Hilfe, Familienstrukturen, Demographischer Wandel, Hilfeleistungen, Pflegebedürftigkeit, ADL, IADL, Solidarität, Familiensolidarität, Eltern-Kind-Beziehung, kulturelle Unterschiede, Europa, Demographische Veränderungen
- Quote paper
- Roland Dörig (Author), 2007, Intergenerationale familiale Hilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/76558