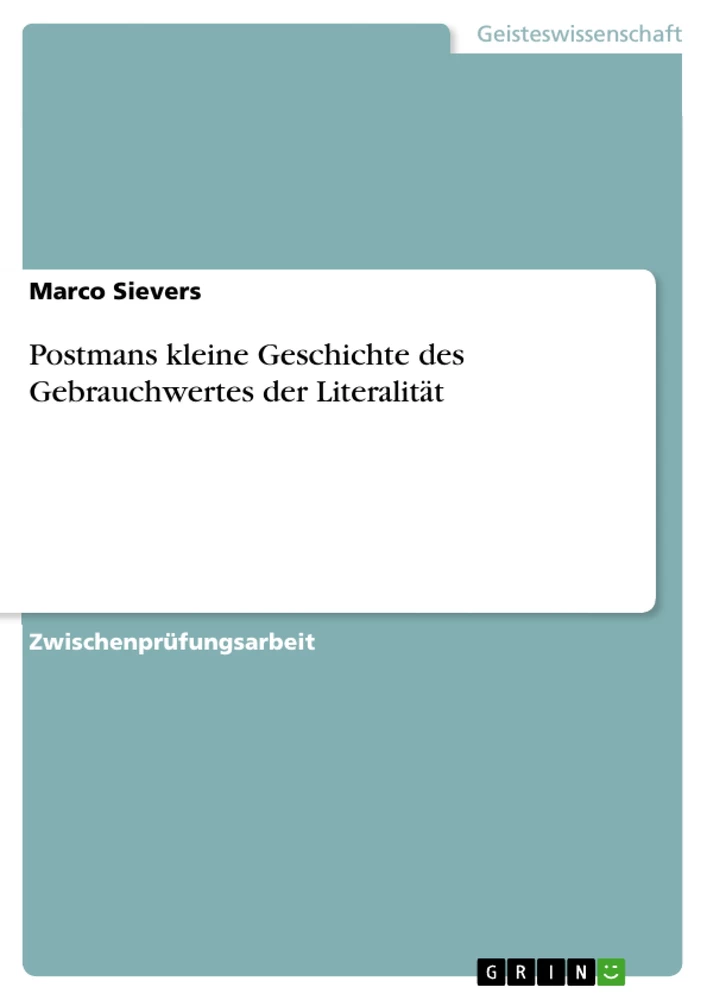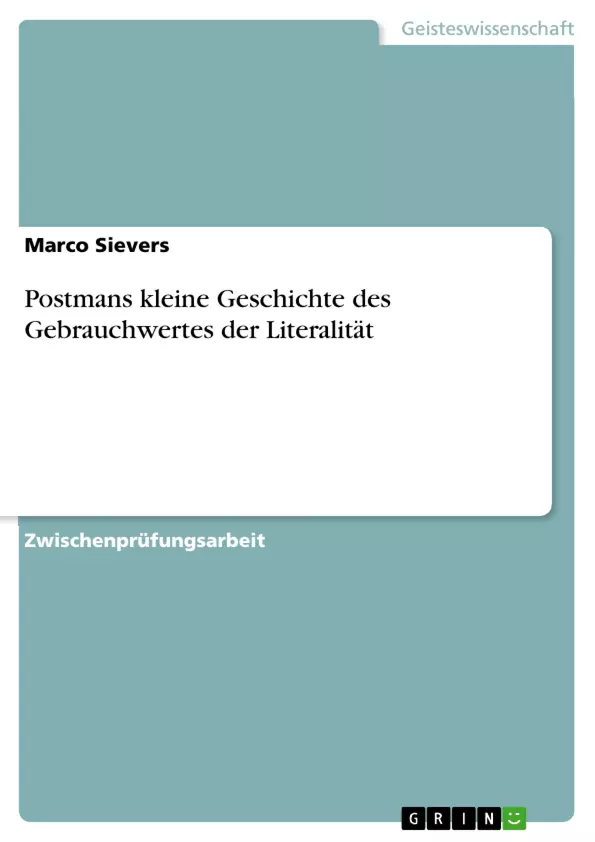Die vorliegende Arbeit beabsichtigt, anhand zweier Texte von Neil Postman einen kleinen systematischen Überblick über den Gebrauchswert der Kulturtechnik Literalität zu geben. Sie versucht dabei eine Kombination normativ-ontologisch und kritisch-dialektischer Ansätze. Die Grundlage der Auseinandersetzung bildet Postmans Buch „Das Verschwinden der Kindheit“, ergänzend wird die Abhandlung „Keine Götter mehr“ herangezogen.
Obwohl Postmans Sicht der Literalität im Vordergrund der Erörterungen steht, erfolgen an gegebener Stelle weitergehende thematische Ergänzungen, wobei beabsichtigt ist, eine weitest-gehende Vorstellung über die Vielschichtigkeit und Komplexität, aber auch über Vor- und Nachteile der Literalität zu vermitteln. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann dabei ebenso wenig erhoben werden, wie einzelne Aspekte bis ins Detail zu analysieren oder zu bewerten, Ziel ist vielmehr, ein Ordnungsschema für eine Diskussion des Themas anzubieten. Insofern ist Postmans Sicht der Literalität eher der rote Faden der Erörterung, nicht aber der sie begrenzende Rahmen.
Die Arbeit gliedert sich in sieben Abschnitte. Zunächst werden die Begriffe Literalität und Gebrauchswert definiert, daran schließt sich eine Darstellung der Anwendungsgebiete der Literalität und deren positive Auswirkungen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene an. Danach wird auf den Unwert der Literalität, dass heißt auf ihre negativen Auswirkungen, eingegangen, und eine Differenzierung zwischen sozialer Literalität und Fachliteralität vorgenommen, um anhand dieser Begriffe eine Analyse des Status Quo in der heutigen BRD vorzunehmen. Im Rahmen dieser Untersuchung wird auch die Frage nach dem Aufkommen einer „Computer-Literalität“ erörtert werden. Schließlich wird im Rahmen einer abschließenden Zusammenfassung mit Ausblick der Versuch einer Prognose bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Literalität unternommen.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung
- B) Hauptteil
- I) Der Gebrauchswert von Literalität
- II) Die Anwendungsfelder der Literalität
- 1.) Technik zur Perpetuierung von Sprache
- 2.) Wissensvermittlung, Wissenskonservierung und Wissensakkumulation
- 3.) Instrument der Konfliktbewältigung und der Herrschaft
- 4.) Literalität als Instrument der Persönlichkeitsformung
- 5.) Kleine Formen der Literalität
- III) Mittelbare soziale und politische Folgen der Literalität
- 1.) Einfluss auf die Organisation sozialer Systeme
- 2.) Aufkommen der modernen Wissenschaft
- 3.) Homogenisierende und separierende Folgen der Literalität
- 4.) Gesellschaftliche Vorstellungen vom Menschen
- IV) Der „Unwert“ der Literalität
- 1.) Wissensüberflutung und Probleme der Wissenschaft
- 2.) Entfremdung des Bücherwissens vom Alltag / Autorität des geschriebenen Wortes
- 3.) Nachteile einer analytisch-begrifflichen Denkweise
- 4.) Negative Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung
- 5.) Gesellschaftlich separierende Wirkungen des Individualismus
- V) Soziale Literalität und Fachliteralität
- VI) Literalität in der heutigen BRD – Vorhandensein einer Computer-Literalität?
- VII) Zusammenfassung und Ausblick
- C) Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, einen systematischen Überblick über den Gebrauchswert der Kulturtechnik Literalität zu liefern, indem sie sich auf zwei Texte von Neil Postman stützt. Sie kombiniert dabei normativ-ontologische und kritisch-dialektische Ansätze.
- Die Bedeutung der Literalität als Technik zur Perpetuierung von Sprache und deren Auswirkungen auf den Handel, die Herrschaft und das Recht.
- Die Rolle der Literalität bei der Wissensvermittlung, Wissenskonservierung und Wissensakkumulation.
- Die Folgen der Literalität auf die Organisation sozialer Systeme, das Aufkommen der modernen Wissenschaft und die gesellschaftlichen Vorstellungen vom Menschen.
- Der „Unwert“ der Literalität, d.h. die negativen Auswirkungen wie Wissensüberflutung, Entfremdung des Wissens vom Alltag und die Nachteile einer analytisch-begrifflichen Denkweise.
- Die Unterscheidung zwischen sozialer und Fachliteralität und die Frage nach dem Aufkommen einer „Computer-Literalität“ in der heutigen BRD.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition der Begriffe Literalität und Gebrauchswert. Anschließend werden die Anwendungsgebiete der Literalität beleuchtet, wobei der Fokus auf der Perpetuierung von Sprache, der Wissensvermittlung und der Bewältigung von Konflikten liegt.
Daraufhin werden die positiven Auswirkungen der Literalität auf individueller und gesellschaftlicher Ebene erörtert, bevor die negativen Folgen thematisiert werden. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Entfremdung des Wissens vom Alltag, den Nachteilen einer analytisch-begrifflichen Denkweise und den negativen Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung.
Weiterhin wird eine Unterscheidung zwischen sozialer und Fachliteralität vorgenommen, um den Status Quo in der heutigen BRD zu analysieren. In diesem Zusammenhang wird auch die Frage nach dem Aufkommen einer „Computer-Literalität“ erörtert. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Literalität.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Gebrauchswert der Literalität, analysiert die Anwendungsgebiete, die Auswirkungen und die Folgen dieser Kulturtechnik. Sie beleuchtet die Perpetuierung von Sprache, Wissensvermittlung, Konfliktbewältigung, Persönlichkeitsformung, soziale und politische Folgen sowie den „Unwert“ der Literalität. Die Arbeit differenziert zwischen sozialer und Fachliteralität und erörtert die Frage nach dem Aufkommen einer „Computer-Literalität“ in der heutigen BRD.
- Arbeit zitieren
- Dipl.Jurist Marco Sievers (Autor:in), 2004, Postmans kleine Geschichte des Gebrauchwertes der Literalität , München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/76038