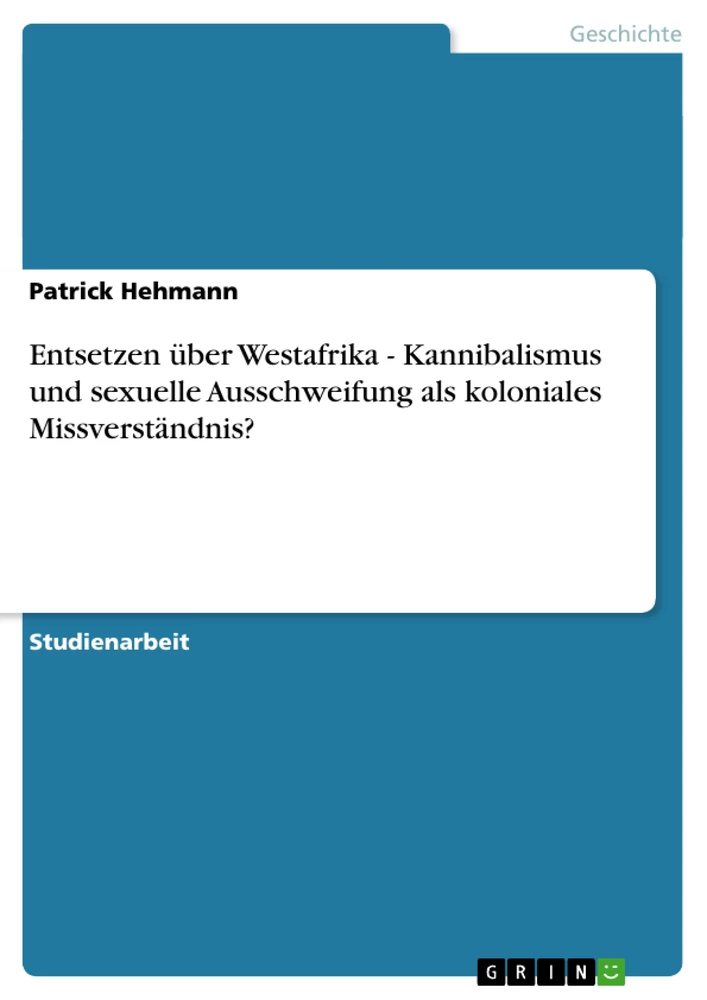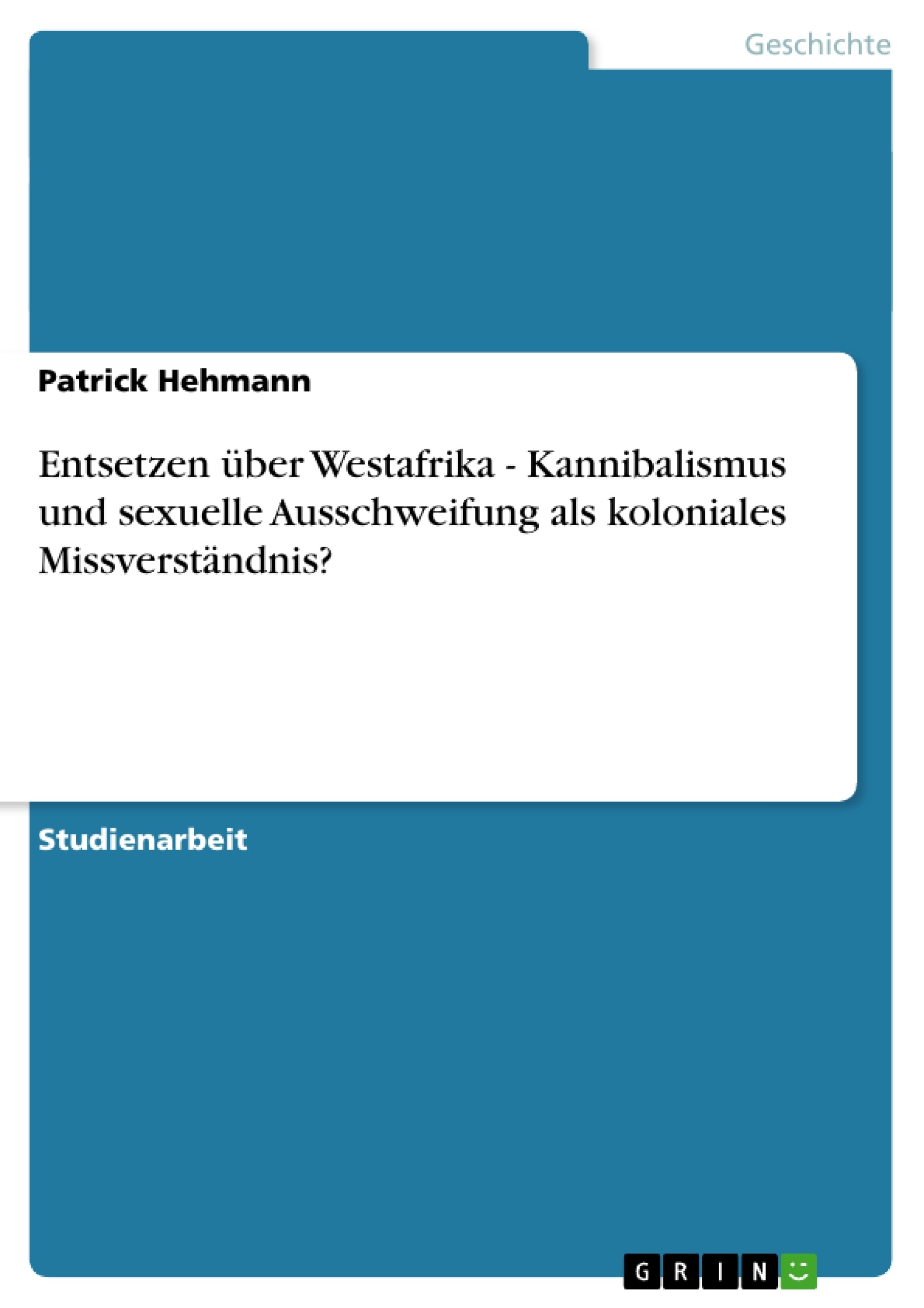Aus rassistichen Vorurteilen wuchsen Vorwürfe, die sich teilweise hartnäckig bis in die Gegenwart gehalten haben. Woher kommen die ethnischen Vorurteile und welchen Einfluss hatten sie auf die Kolonialpolitik Englands? Woher kam das Unwissen über das Innenland Westafrikas? Was war die Hottentottenvenus und gibt es tatsächlich Indizien, die für Kannibalismus oder ausschweifende Sexualpraktiken der Westafrikaner im 19. Jahrhundert sprechen? Diese und andere Fragen werden in der vorliegenden Arbeit geklärt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verbot des Sklavenhandels und die frühe Mission ins Niger-Delta
- Gründe für das verhaltene Vorstoßen der britischen Mission in das westafrikanische Hinterland
- Das African fever
- Die lokalen Mächte Westafrikas
- Probleme innerhalb der Mission
- Politische Schwierigkeiten
- Das Bild der Sexualität der Afrikanerin
- Der Vorwurf des Kannibalismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung negativer Stereotype über Westafrika während der britischen Kolonialzeit, insbesondere die Vorwürfe von Kannibalismus und sexueller Ausschweifung. Sie analysiert die Faktoren, die zu diesen Missverständnissen beitrugen und hinterfragt die Motive und Ziele der britischen Missionare und Händler.
- Die Rolle des Sklavenhandelsverbots und die frühen Missionen im Niger-Delta
- Die Gründe für das zögerliche Vordringen der Briten ins westafrikanische Hinterland
- Die Konstruktion des Stereotyps der sexuellen Ausschweifung afrikanischer Frauen
- Der Vorwurf des Kannibalismus als Instrument der Kolonialpolitik
- Die Auswirkungen von Unwissenheit und Vorurteilen auf die Wahrnehmung Westafrikas
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das negative Bild, das sich die Briten im 19. Jahrhundert von Westafrika machten, geprägt von Vorwürfen sexueller Ausschweifung und Kannibalismus. Sie führt in die Thematik ein und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Entstehung dieser Stereotype anhand historischer und gesellschaftlicher Faktoren untersucht. Der Fokus liegt auf der Erörterung der Rolle von Unwissenheit und Vorurteilen bei der Herausbildung dieser negativen Stereotype.
Verbot des Sklavenhandels und die frühe Mission ins Niger-Delta: Dieses Kapitel beleuchtet die Folgen des Sklavenhandelsverbots durch Großbritannien im Jahr 1807. Obwohl der Sklavenhandel offiziell verboten wurde, persistierte er, und die britischen Importe aus Afrika stiegen sogar an. Das Kapitel analysiert die innenpolitischen Herausforderungen, die das Verbot mit sich brachte, insbesondere die Frage der Behandlung ehemaliger Sklaven in Großbritannien, die den Wunsch nach kolonialen Märkten verstärkte. Die Gründung von "slave villages" wird als logische Folge des Verbots und des gleichzeitig gestiegenen Interesses an afrikanischen Rohstoffen dargestellt. Der wirtschaftliche Aspekt wird mit anderen Motiven des britischen Eingreifens in Afrika kontrastiert, wie dem Bestreben, die "verdorbene Ordnung" Afrikas zu "zivilisieren".
Gründe für das verhaltene Vorstoßen der britischen Mission in das westafrikanische Hinterland: Dieses Kapitel erörtert die Faktoren, die das zögerliche Vordringen der britischen Missionare und Händler ins westafrikanische Hinterland beeinflussten. "African fever" (Fiebererkrankungen), die Macht der lokalen Herrscher, interne Probleme innerhalb der Mission und politische Schwierigkeiten werden als zentrale Hemmnisse identifiziert. Die gescheiterte erste Niger-Expedition von 1841 aufgrund einer Fieber-Epidemie wird als Beispiel für die Herausforderungen angeführt. Die darauffolgenden Expeditionen werden im Kontext des "white man's burden" betrachtet und ihr Erfolg kritisch hinterfragt. Trotz anfänglicher Misserfolge legten diese Expeditionen den Grundstein für den Bruch der Macht afrikanischer Mittelsmänner und den direkten Handel im Landesinneren.
Schlüsselwörter
Westafrika, Britische Kolonialisierung, Kannibalismus, Sexuelle Ausschweifung, Sklavenhandel, Stereotype, Vorurteile, Missionierung, Niger-Delta, Kolonialpolitik, "African fever", "white man's burden".
Häufig gestellte Fragen zum Text über die britische Kolonialisierung Westafrikas
Was ist der zentrale Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht die Entstehung negativer Stereotype über Westafrika während der britischen Kolonialzeit. Im Fokus stehen die Vorwürfe von Kannibalismus und sexueller Ausschweifung, deren Entstehung anhand historischer und gesellschaftlicher Faktoren analysiert wird. Die Rolle von Unwissenheit und Vorurteilen bei der Herausbildung dieser Stereotype wird besonders hervorgehoben.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Folgen des Sklavenhandelsverbots, die Gründe für das zögerliche Vordringen der Briten ins westafrikanische Hinterland (u.a. "African fever", lokale Machtkämpfe, interne Probleme der Mission und politische Schwierigkeiten), die Konstruktion des Stereotyps der sexuellen Ausschweifung afrikanischer Frauen, den Vorwurf des Kannibalismus als Instrument der Kolonialpolitik und die Auswirkungen von Unwissenheit und Vorurteilen auf die Wahrnehmung Westafrikas. Die Rolle des "white man's burden" wird ebenfalls diskutiert.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über das Sklavenhandelsverbot und die frühen Missionen im Niger-Delta, ein Kapitel über die Gründe für das zögerliche Vordringen der Briten ins Hinterland, ein Kapitel über das Bild der Sexualität der Afrikanerin, ein Kapitel über den Vorwurf des Kannibalismus und ein Fazit. Die Kapitel analysieren jeweils spezifische Aspekte der britischen Kolonialpolitik und die damit verbundenen Stereotype. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet detailliertere Informationen zum Inhalt jedes Kapitels.
Welche Rolle spielte der Sklavenhandel im Kontext der britischen Kolonialisierung Westafrikas?
Das Kapitel über das Sklavenhandelsverbot zeigt, dass trotz des offiziellen Verbots im Jahr 1807 der Sklavenhandel weiterbestand und sogar zu einem Anstieg der britischen Importe aus Afrika führte. Die innenpolitischen Herausforderungen, die das Verbot mit sich brachte, wie die Behandlung ehemaliger Sklaven in Großbritannien, verstärkten den Wunsch nach kolonialen Märkten und führten zur Gründung von "slave villages". Der wirtschaftliche Aspekt wird mit dem Bestreben der Briten, Afrika zu "zivilisieren", kontrastiert.
Warum drangen die Briten so zögerlich ins westafrikanische Hinterland vor?
Das zögerliche Vordringen der Briten wird auf verschiedene Faktoren zurückgeführt: "African fever" (tropische Krankheiten), die Macht der lokalen Herrscher, interne Probleme innerhalb der britischen Missionen und politische Schwierigkeiten. Die gescheiterte erste Niger-Expedition von 1841 wird als Beispiel für die Herausforderungen angeführt. Die darauffolgenden Expeditionen werden im Kontext des "white man's burden" betrachtet und kritisch hinterfragt. Trotz anfänglicher Misserfolge legten sie den Grundstein für den direkten Handel im Landesinneren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Westafrika, Britische Kolonialisierung, Kannibalismus, Sexuelle Ausschweifung, Sklavenhandel, Stereotype, Vorurteile, Missionierung, Niger-Delta, Kolonialpolitik, "African fever", "white man's burden".
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text untersucht die Entstehung negativer Stereotype über Westafrika, insbesondere die Vorwürfe von Kannibalismus und sexueller Ausschweifung während der britischen Kolonialzeit. Er analysiert die Faktoren, die zu diesen Missverständnissen beitrugen und hinterfragt die Motive und Ziele der britischen Missionare und Händler.
- Arbeit zitieren
- Patrick Hehmann (Autor:in), 2007, Entsetzen über Westafrika - Kannibalismus und sexuelle Ausschweifung als koloniales Missverständnis?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/75642