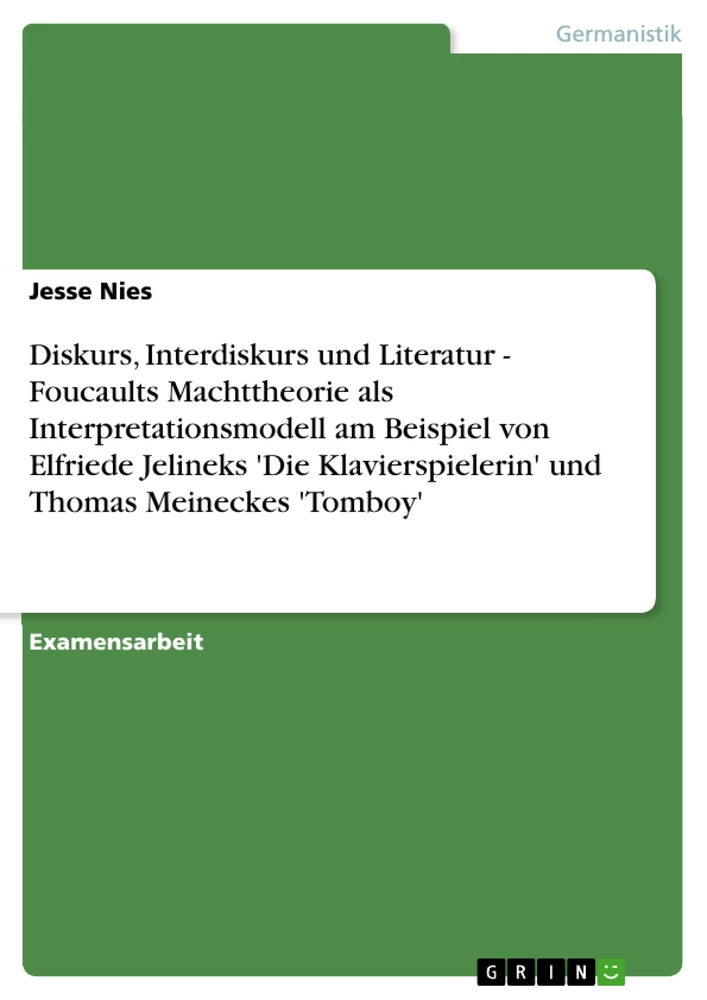Der Begriff der Hermeneutik wird in der Literatur als die Kunst der Auslegung bzw. der Interpretation von Texten oder Werken der bildenden Kunst und Musik definiert. Ihren Namen verdankt die Hermeneutische Methode dem griechischen Götterboten Hermes, der zwischen den Göttern des Olymp und den Menschen vermittelte. Die Entwicklung der hermeneutischen Theorie nahm ihren Anfang in der Antike und wurde im Mittelalter v.a. zur Bibelexegese genutzt. Im 19. Jahrhundert wurde sie von Friedrich Schleiermacher und später von Wilhelm Dilthey von ihrem theologischen Gegenstand losgelöst und auch auf andere Textgattungen angewendet. Die Hermeneutik wurde so zur allgemein anerkannten Grundlage der Geisteswissenschaften (vgl. Brockhaus Literatur 2004: 623). Über 2000 Jahre hinweg galt die Hermeneutik also als die einzige zutreffende Interpretationsmethode. Es ist sozusagen ein methodisches Monopol entstanden. Dieser monopolistische Anspruch der Hermeneutik sorgte im 20. Jahrhundert mehrfach für Anstoß.
Einer derjenigen, die diesen Anspruch der Hermeneutik bezweifelten, war Michel Foucault. Er lehnte die Hermeneutik ab und setzte ihr seine eigene Philosophie entgegen. Nach Foucaults Tod wurden seine Schriften zum Ausgangspunkt zahlreicher neuer Ansätze in nahezu allen wissenschaftlichen Disziplinen. Von dieser Strömung wurde auch die Literaturwissenschaft erfasst. Es entstanden diskursanalytische Schulen und auch Debatten und Gegensätze zwischen diesen. Eine dieser Methoden, die interdiskursive Literaturanalyse, bildet das theoretische Herzstück der vorliegenden Arbeit und wird in Kapitel drei eingehend erläutert.
Die Fragestellung, der die vorliegende Arbeit auf den Grund gehen möchte, teilt sich in zwei Fragekomplexe auf. Zunächst beschäftigt sie sich damit, ob die Methode der interdiskursiven Literaturanalyse praktisch umsetzbar und operationalisierbar ist. Daran anknüpfend wird sie einen Vergleich zwischen der herkömmlichen, hermeneutischen Interpretationsmethode und der Methode der Interdiskursanalyse durchführen. Zudem werden angrenzende Methoden wie die historische Diskursanalyse erläutert, um einen besseren Überblick über die diskursanalytische Methodendebatte zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Michel Foucaults Philosophie
- Das Gleiche und das Andere
- Diskurse und ihre Ordnungen
- Der Ursprung der Diskurse
- Das totalitäre Prinzip der Macht
- Das Machtdispositiv
- Revision der Unfreiheit
- Foucaults Stellung in der Literaturwissenschaft
- Diskursanalyse
- Gemeinsame Voraussetzungen
- Historische Diskursanalyse
- Interdiskursanalyse
- Hermeneutische Analyse von Meineckes „Tomboy“
- Inhaltsangabe
- Analyse
- Aufbau des Romans
- Erzählsituation
- Zeitstruktur
- Sprache und Sprachstil
- Romanfiguren
- Vivian
- Frauke und Angelo
- Korinna
- Die drei Lehrerinnen
- Hans
- Theorieexkurse
- Leserwirkung und Autorintention
- Wirkung der Romanfiguren
- Einordnung in literaturwissenschaftliche Kategorien
- Komik, Selbstironie und die Position des Autors
- Zusammenfassung
- Interdiskursanalyse von Meineckes „Tomboy“
- Der Diskurs der Geschlechterforschung
- Geschlechterforschung und Mode
- Geschlechterforschung und Musik
- Geschlechterforschung und Sexualität
- Interkulturelle Diskursanalyse
- Literatur, Musik und Film
- Psychologie und Philosophie
- Historie
- Nationale Identitäten
- Zusammenfassung
- Der Diskurs der Geschlechterforschung
- Validitätsprobe anhand Jelineks „Die Klavierspielerin“
- Erste Stichprobe
- Zweite Stichprobe
- Dritte Stichprobe
- Zusammenfassung
- Fazit
- Operativität der Interdiskursanalyse
- Hermeneutik und Interdiskursivität im Vergleich
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der interdiskursiven Literaturanalyse im Kontext von Michel Foucaults Machttheorie. Ziel ist es, die Operationalisierbarkeit dieser Methode anhand zweier literarischer Werke zu demonstrieren und ihre Ergebnisse mit der traditionellen hermeneutischen Interpretationsmethode zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet zudem die historische Entwicklung der Diskursanalyse und zeigt die Relevanz Foucaults für die Literaturwissenschaft auf. Die wichtigsten Themenschwerpunkte der Arbeit lassen sich wie folgt zusammenfassen:- Michel Foucaults Machttheorie und ihre Bedeutung für die Literaturwissenschaft
- Die methodischen Grundlagen der interdiskursiven Literaturanalyse
- Die Anwendung der Interdiskursanalyse auf zwei literarische Werke: Thomas Meineckes „Tomboy“ und Elfriede Jelineks „Die Klavierspielerin“
- Der Vergleich zwischen der hermeneutischen und der interdiskursiven Interpretationsmethode
- Die Rolle von Diskursen in der Konstruktion von Geschlecht, Kultur und Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 bietet einen einführenden Überblick über Michel Foucaults Philosophie und ihre Relevanz für die Literaturwissenschaft. Es beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Diskursanalyse und deren Anwendung auf die Interpretation von Texten. Kapitel 3 präsentiert zwei diskursanalytische Methoden: die historische Diskursanalyse nach Klaus-Michael Bogdal und die Interdiskursanalyse im Sinne Jürgen Links. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Interdiskursanalyse, welche den theoretischen Kern der vorliegenden Arbeit bildet. Kapitel 4 widmet sich der hermeneutischen Analyse von Thomas Meineckes Roman „Tomboy“. Es analysiert die narrative Struktur, die Sprache, die Figuren und die Leserwirkung des Werkes. Kapitel 5 untersucht „Tomboy“ aus der Perspektive der Interdiskursanalyse. Es zeigt auf, wie der Roman verschiedene Diskurse, wie beispielsweise den Diskurs der Geschlechterforschung und den interkulturellen Diskurs, aufgreift und miteinander verknüpft. Kapitel 6 setzt die interdiskursive Analyse anhand von Elfriede Jelineks Roman „Die Klavierspielerin“ fort, um die Ergebnisse der Analyse von „Tomboy“ zu überprüfen und zu vertiefen. Kapitel 7 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bewertet die Operativität der interdiskursiven Literaturanalyse. Es analysiert die Stärken und Schwächen der Methode und zeigt den Vergleich mit der hermeneutischen Interpretationsmethode auf.Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Diskursanalyse, Interdiskursanalyse, Michel Foucault, Machttheorie, Hermeneutik, Literaturwissenschaft, Geschlechterforschung, interkulturelle Diskursanalyse, Thomas Meinecke, Elfriede Jelinek, „Tomboy“, „Die Klavierspielerin“. Die Arbeit untersucht die Anwendung der interdiskursiven Literaturanalyse als Interpretationsmethode und beleuchtet ihre Relevanz für die Interpretation literarischer Werke.Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Hermeneutik und Diskursanalyse?
Hermeneutik sucht nach dem tieferen Sinn eines Textes (Interpretation), während die Diskursanalyse untersucht, wie Machtstrukturen und gesellschaftliche Regeln Texte formen.
Wie wendet man Foucault auf Literatur an?
Durch die Interdiskursanalyse werden literarische Werke (wie Meineckes „Tomboy“) daraufhin untersucht, wie sie verschiedene gesellschaftliche Wissensbereiche (Geschlecht, Musik, Mode) verknüpfen.
Worum geht es in Thomas Meineckes „Tomboy“?
Der Roman setzt sich intensiv mit Geschlechterforschung, Identität und kulturellen Diskursen auseinander, was ihn zum idealen Objekt für eine Diskursanalyse macht.
Welche Rolle spielt Macht in Elfriede Jelineks „Die Klavierspielerin“?
Die Arbeit nutzt Jelineks Werk als Validitätsprobe für Foucaults Machttheorie, um Unterdrückungsmechanismen und diskursive Ordnungen in der Literatur aufzuzeigen.
Was ist ein „Machtdispositiv“?
Ein Begriff von Foucault, der das Geflecht aus Diskursen, Institutionen, Gesetzen und philosophischen Lehrsätzen beschreibt, das Macht in einer Gesellschaft ausübt.
- Arbeit zitieren
- Jesse Nies (Autor:in), 2005, Diskurs, Interdiskurs und Literatur - Foucaults Machttheorie als Interpretationsmodell am Beispiel von Elfriede Jelineks 'Die Klavierspielerin' und Thomas Meineckes 'Tomboy', München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/74794