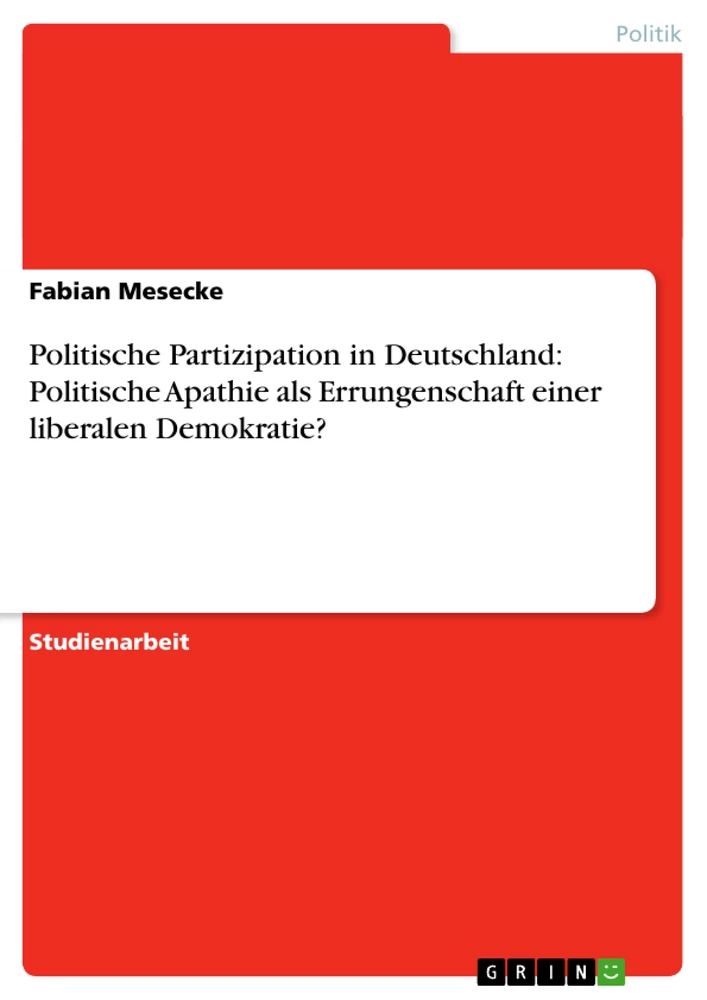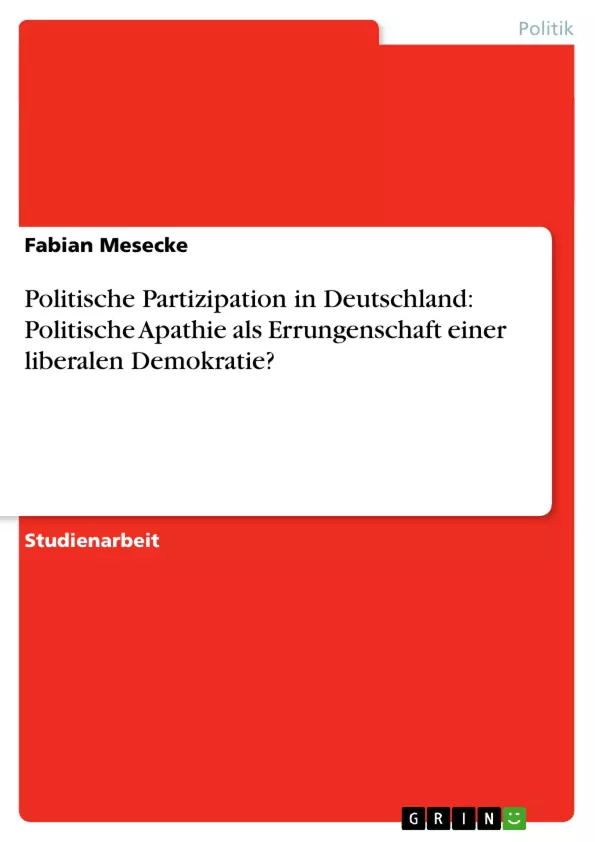Im Jahr 2006 fanden in der Bundesrepublik Deutschland fünf Landtagswahlen statt. Die Wahlbeteiligung lag bei keiner der fünf Wahlen über 60% (Bartsch 2006). In Sachsen-Anhalt gaben nur 44,4% der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Damit war zum ersten Mal bei einer Landtagswahl die Gruppe der Nichtwähler größer als die der Wahlberechtigten, die ihre Stimme abgaben (ebd.). In Baden-Württemberg lag im gleichen Jahr die Wahlbeteiligung bei 53,4%. Dieser Wert stellt die niedrigste Wahlbeteiligung dar, die je bei einer Landtagswahl in den alten Bundesländern gemessen wurde. Von einem spezifisch ostdeutschen Problem lässt sich also kaum sprechen. Vielmehr spiegelt diese Momentaufnahme des Jahres 2006 in Deutschland die Entwicklung in vielen westeuropäischen Staaten wieder. Bei den beiden letzten Parlamentswahlen in Großbritannien wurden die beiden niedrigsten Wahlbeteiligungsraten seit 1918 gemessen. Bei den letzten Wahlen zum österreichischen Nationalparlament wurde ebenfalls ein historischer Tiefstand erreicht. Das Gleiche gilt für die französischen Präsidentschaftswahlen im Jahre 20022. Die vier genannten Staaten können ohne Zweifel als postmoderne, hochgradig individualisierte Gesellschaften bezeichnet werden. Geht mit fortschreitender Individualisierung nun eine sinkende Partizipationsbereitschaft einher? Ulrich Beck sieht einen solchen Zusammenhang. Er bezeichnet politische Apathie als eine mögliche Folge von Individualisierungsprozessen. Für Benjamin Barber sind der Liberalismus und die damit verbundene Betonung von individuellen Freiheitsrechten die Ursachen für die sinkende Bereitschaft der Bürger zur Beteiligung an politischen Prozessen. Einen Kontrast zur eingangs angedeuteten Entwicklung bilden die Ergebnisse des Zweiten Volksentscheid Rankings der Initiative Mehr Demokratie. In diesem heißt es, dass die Zahl von Volksinitiativen und Volksbegehren in der Bundesrepublik kontinuierlich wachse. Ein klares Bild von der Höhe der Motivation der Bürger zur Beteiligung ist auf den ersten Blick also nicht zu erkennen.
Daher wird im Rahmen dieser Arbeit untersucht, wie sich die politische Partizipation in Deutschland insgesamt entwickelt hat und ob die von Kommunitariern wie Benjamin Barber attestierte politische Apathie in der Bundesrepublik heute wirklich vorzufinden ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorien politischer Partizipation
- 2.1 Politische Partizipation und das liberale Gesellschaftsmodell
- 2.1.1 Liberalismus nach John Rawls
- 2.1.2 Die kommunitaristische Kritik am Liberalismus
- 2.2 Bestimmungsfaktoren politischer Partizipation
- 2.3 Formen politischer Partizipation
- 3. Empirische Befunde zur politischen Partizipation in Deutschland
- 3.1 Die Entwicklung konventioneller Partizipationsformen
- 3.2 Die Entwicklung unkonventioneller Partizipationsformen
- 3.3 Zusammenfassung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der politischen Partizipation in Deutschland und setzt sich mit der Frage auseinander, ob politische Apathie in der Bundesrepublik heute wirklich vorzufinden ist. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen der politischen Partizipation im Kontext der Liberalismus-Kommunitarismus-Debatte und betrachtet die empirischen Befunde zur Entwicklung konventioneller und unkonventioneller Partizipationsformen.
- Politische Partizipation im Spannungsfeld von Liberalismus und Kommunitarismus
- Bestimmungsfaktoren und Formen der politischen Partizipation
- Entwicklung der politischen Partizipation in Deutschland
- Politische Apathie als Errungenschaft einer liberalen Demokratie?
- Das Verhältnis von Individualisierung und Partizipationsbereitschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2.1 beleuchtet die normativen Vorstellungen über politische Partizipation im Rahmen der Liberalismus-Kommunitarismus-Debatte. Im Fokus stehen die Ansätze von John Rawls und Benjamin Barber.
Kapitel 2.2 erörtert die wesentlichen Bestimmungsfaktoren der politischen Partizipation und analysiert die Faktoren, die Einfluss auf die Bereitschaft der Bürger zur Beteiligung an politischen Prozessen haben.
Kapitel 2.3 stellt die verschiedenen Formen der politischen Partizipation vor, differenziert zwischen konventionellen und unkonventionellen Ausprägungen der Bürgerbeteiligung und beleuchtet die jeweiligen Stärken und Schwächen.
Kapitel 3.1 und 3.2 untersuchen die Entwicklung der konventionellen und unkonventionellen Partizipationsformen in der Bundesrepublik Deutschland und analysieren Trends und Veränderungen über die Zeit.
Schlüsselwörter
Politische Partizipation, Liberalismus, Kommunitarismus, John Rawls, Benjamin Barber, Individualisierung, politische Apathie, konventionelle Partizipationsformen, unkonventionelle Partizipationsformen, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Warum sinkt die Wahlbeteiligung in modernen Demokratien?
Als Ursachen werden fortschreitende Individualisierungsprozesse und die Betonung individueller Freiheitsrechte gegenüber gemeinschaftlichen Pflichten diskutiert.
Was ist der Unterschied zwischen konventioneller und unkonventioneller Partizipation?
Konventionell bezieht sich auf Wahlen und Parteiarbeit; unkonventionell umfasst Volksbegehren, Bürgerinitiativen oder Demonstrationen.
Wie sieht Benjamin Barber die politische Apathie?
Barber sieht im Liberalismus eine Gefahr, da dieser die Bürgerbeteiligung zugunsten privater Interessen schwäche und so politische Apathie fördere.
Gibt es in Deutschland wirklich weniger politische Beteiligung?
Während die Wahlbeteiligung sinkt, wächst die Zahl der Volksinitiativen und punktuellen Bürgerbeteiligungen stetig an.
Was besagt John Rawls Theorie zum Liberalismus?
Rawls liefert die normative Grundlage für ein liberales Gesellschaftsmodell, das in dieser Arbeit der kommunitaristischen Kritik gegenübergestellt wird.
Ist politische Apathie ein ostdeutsches Problem?
Nein, die niedrige Wahlbeteiligung ist ein gesamtdeutsches und westeuropäisches Phänomen, wie Beispiele aus Frankreich und Großbritannien zeigen.
- Quote paper
- Fabian Mesecke (Author), 2007, Politische Partizipation in Deutschland: Politische Apathie als Errungenschaft einer liberalen Demokratie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/73484