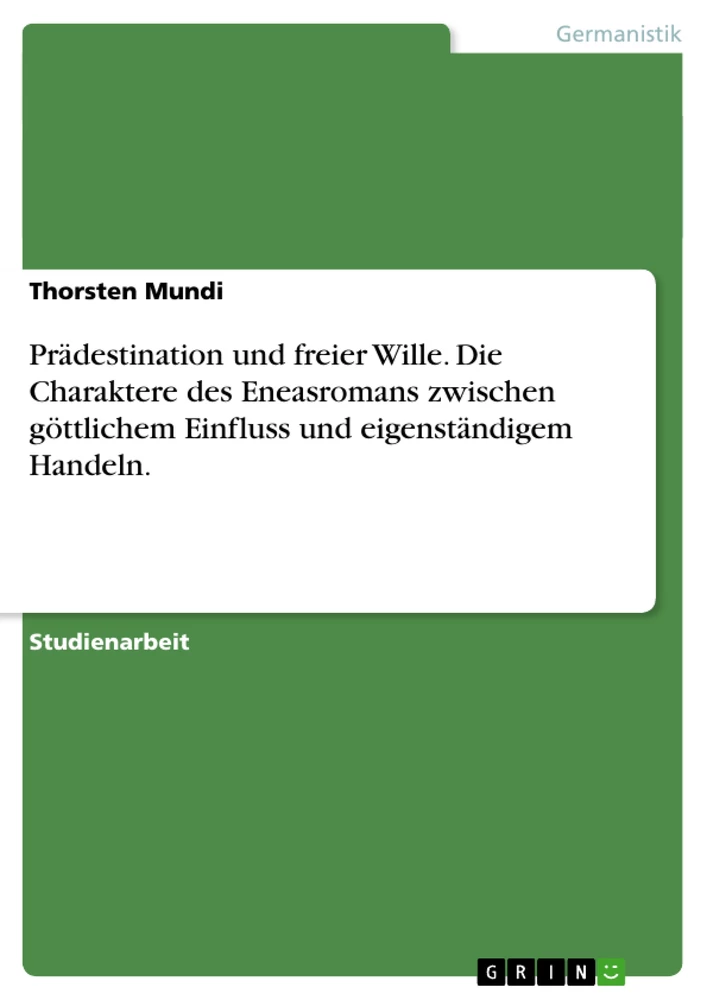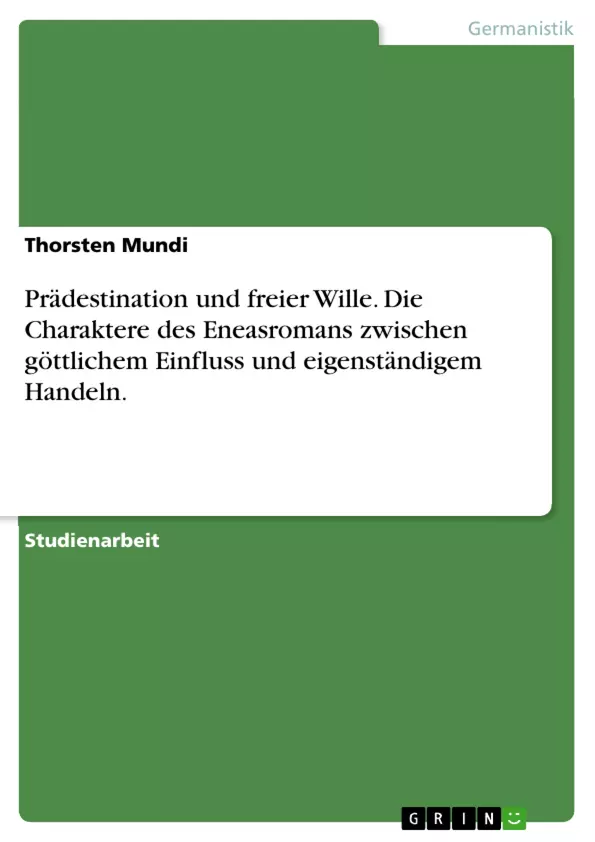Diese Arbeit befasst sich mit dem Einfuß des Götterwillens auf das Handeln der Protagonisten in Heinrichs von Veldecke "Eneasroman". Auf eine Analyse der Bruchstellen, welche Heinrichs Roman im Vergleich zu den beiden Vorgängerromanen, Vergils "Aenaeis" und dem französischen "Roman d ´Eneas" sicherlich aufweist, wird dabei verzichtet. Es soll vielmehr darum gehen, den Zusammenhang von höfischem Ehrenkodex und christlichem Weltbild des Mittelalters einerseits und dem Handeln der Charaktere des "Eneasromans" andererseits Offenzulegen. Es soll bewiesen werden, das es Heinrich gelungen ist, aus einer an das Antike Weltbild - dessen Merkmal der Glaube an eine Unzahl von Göttern und ihr Schicksalhaftes Einwirken auf den Lebensweg der Menschen ist - angepassten Vorlage eine Handlungsführung und Charaktere zu formen, deren Handeln für die höfische Welt durchaus Vorbildcharakter hat.
Diese Arbeit befasst sich demnach mit den Handlungsmotivationen der Figuren Eneas, Dido, Lavinia und Turnus. Da eine Untersuchung der Figur der Königin darüber hinaus keine neuen Erkenntnisse liefert, wird ihre Rolle keine Beachtung finden.
Für diese Betrachtung kommt der Untersuchung der Minnehandlung zwischen Eneas und Dido und ihrem zustande kommen während Eneas´ Aufenthalt in Karthago besondere Bedeutung zu, da diese in ihrem Ablauf im Gegensatz zu anderen Handlungstragenden Ereignissen des "Eneasromans" beinahe ausschließlich göttlichem Einfluss unterliegt.
Die Abschnitte 3.1-3.3 versuchen daher, das komplexe Zusammenspiel göttlichen Willens einerseits und der Fähigkeit des Individuums zur selbstbestimmten Entscheidung andererseits in Heinrichs "Eneasroman" zu beleuchten. Der Blick auf die mythologischen Grundlagen des Romans und ihrer Bearbeitung durch Vergil werden beweisen, das es Heinrich hier mit einem Widerspruch seiner antiken Vorlage zum mittelalterlichen Weltbild seiner Zeit zu tun hatte, dessen vollständige Auflösung ihm unmöglich bleiben musste. Der Anschließende Abschnitt 3.4 versucht dann, die Gründe hierfür Offenzulegen.
Die Untersuchung der für die Handlung des "Eneasromans" so zentralen Göttergebote und ihrer Bewertung durch Eneas und seine getreuen sowie die Betrachtung der Figur des Turnus und der Minnehandlung zwischen Eneas und Lavinia werden zeigen, das Heinrichs Charaktere keineswegs Spielbälle der Götter sind, sondern vielmehr als eigenständig handelnde Individuen die Erfüllung ihres Schicksals besorgen.
Inhaltsverzeichnis
- Prädestination und freier Wille.
- Das Götterbebot zur Italienfahrt...
- Eneas Aufenthalt in Karthago..
- Der Kampf um Troja...........
- Die Bearbeitung des Mythos in Vergils „Aenaeis“.
- Die Bearbeitung in Veldeckes „Eneasroman“.
- Die Dido – Episode als Spiegel des mittelalterlichen minne – und ere Begriffs .........
- Eneas und Lavinia…........
- Die Prophezeihung des Anchises
- Der Untergang des Turnus
- Die Entstehung der minne zwischen Eneas und Lavinia
- Die Auswirkungen der minne auf den Ausgang des Kampfes um Italien.
- Bewertung der Ergebnisse
- Bibliographie........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Einfluss des Götterwillens auf das Handeln der Protagonisten in Heinrichs von Veldeckes „Eneasroman“, mit besonderem Fokus auf das Zusammenspiel von höfischem Ehrenkodex und christlichem Weltbild des Mittelalters. Es soll gezeigt werden, wie Heinrich aus einer antiken Vorlage, die vom Glauben an eine Vielzahl von Göttern und deren Einfluss auf das menschliche Schicksal geprägt ist, eine Handlungsführung und Charaktere schuf, die für die höfische Welt Vorbildcharakter haben.
- Der Einfluss des Götterwillens auf das Handeln der Protagonisten
- Das Zusammenspiel von höfischem Ehrenkodex und christlichem Weltbild
- Die Entstehung der Minnehandlung zwischen Eneas und Dido
- Die Rolle der Göttergebote und deren Bewertung durch die Figuren
- Die Handlungsmotivationen der Figuren Eneas, Dido, Lavinia und Turnus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der zentralen Frage nach Prädestination und freiem Willen und legt den Fokus auf die Motivationen der Figuren und ihr Verhältnis zu den Göttern. Das zweite Kapitel analysiert das Götterbebot zur Italienfahrt, das Eneas erhält, und untersucht die Auswirkungen dieses Befehls auf seine Handlungsfreiheit. Das dritte Kapitel behandelt Eneas' Aufenthalt in Karthago und die Minnehandlung zwischen Eneas und Dido, welche beinahe ausschließlich von göttlichem Einfluss gesteuert wird. Es beleuchtet das komplexe Zusammenspiel von göttlichem Willen und individueller Entscheidung in diesem Kontext. Das vierte Kapitel konzentriert sich auf Eneas und Lavinia und untersucht die Prophezeihung des Anchises, den Untergang des Turnus und die Entstehung der Minne zwischen Eneas und Lavinia. Dieses Kapitel analysiert den Einfluss der Minne auf den Ausgang des Kampfes um Italien.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselthemen Prädestination und freier Wille, höfisches Ehrenkodex, christliches Weltbild, göttlicher Einfluss, Minne, Handlungsmotivation, Eneas, Dido, Lavinia, Turnus, „Eneasroman“, Heinrich von Veldecke, Mythologie, mittelalterliche Literatur.
- Arbeit zitieren
- Thorsten Mundi (Autor:in), 2000, Prädestination und freier Wille. Die Charaktere des Eneasromans zwischen göttlichem Einfluss und eigenständigem Handeln., München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/7347