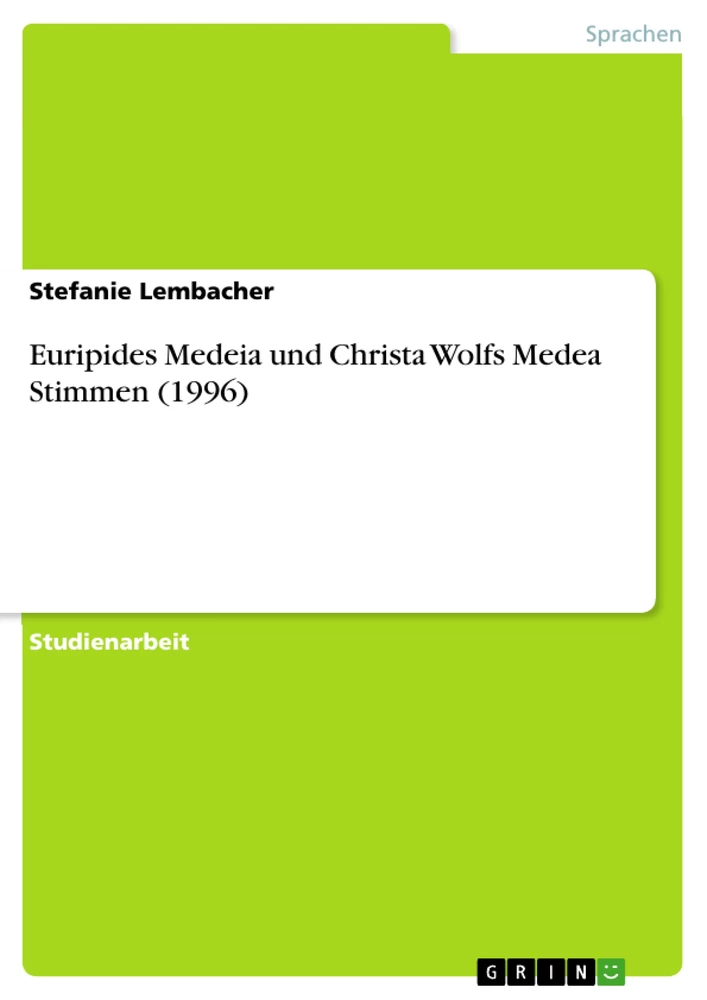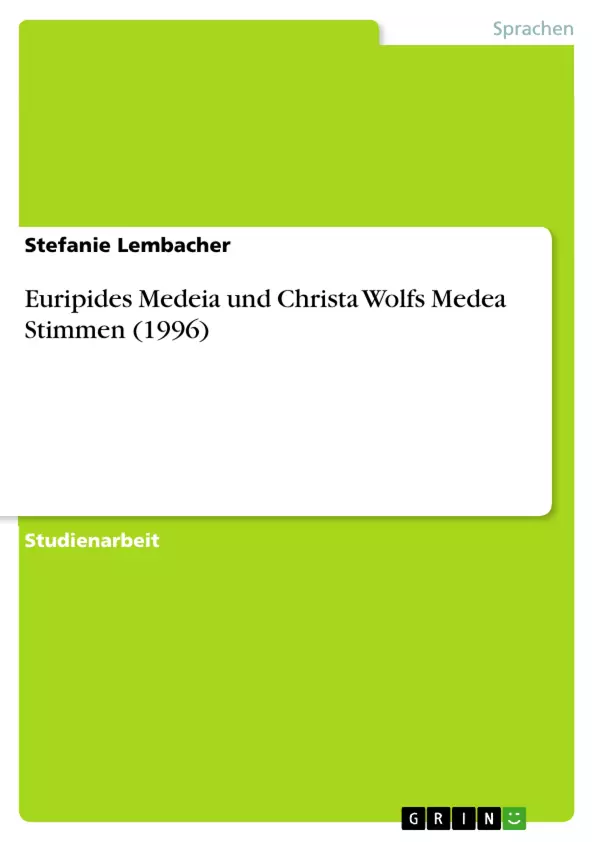Der Mythos der Figur Medea, der seit jeher Gegenstand der europäischen Literatur ist, hat verschiedene Bearbeitungen erfahren, die allerdings zum Großteil nur bruchstückhaft erhalten sind. Die verschiedenen Autoren von der Antike bis heute haben den Mythos um Medea unterschiedlich ausgelegt.
Der älteste Text, in dem von Medea berichtet wird, ist Hesiod´s Theogonie und stammt aus dem 7. Jahrhundert vor Christus . Sowohl in der Theogonie, als auch in den Pindarschen Oden fehlt das Motiv des Kindsmord durch Medea noch völlig. Die Pindarschen Oden zeichnen sogar das Bild einer klugen und hochherzigen Medea, einer „magna anima“.
Erst bei Euripides wird die Mutter zur Mörderin ihrer eigenen Kinder und erst seit dieser Bearbeitung ist die Rezeption des Medea Mythos von Entsetzten und Faszination bestimmt. Friedrich Schiller schreibt im Vorwort zu seinen Räubern: „Die Medea der alten Dramatiker bleibt bei all ihren Greueln noch ein grosses staunenswertes Weib “. Medea steht hier beispielhaft für eine Verbrecherin, die durch ihre Greueltat Schaudern und Furcht hervorruft, was gleichzeitig deren Faszination ausmacht. Nahezu alle künstlerischen und literarischen Bearbeitungen der Folgezeit greifen auf diese Neuerung, das Skandalon des Kindermordes, zurück und stellen Medea als rachsüchtige Ehefrau, Zauberin und barbarische Mörderin ihrer Kinder dar, auch wenn die Motivation für den Mord verschiedene Akzentuierung und Begründung erfährt. Hingewiesen sei hier auf die Dichtungen von Ovid und Ennius, sowie auf Senecas furiose Medea und Jean Anouilh´s Einakter Medée. In der Tragödie Medée von Pierre Cornielle erhält die Heldin sanfte Züge und Franz Grillparzers Medea Version Das goldene Vlies zeigt sie als verletzte Barbarin. Außerdem bot sich der Medea Stoff aufgrund der stark emotionalen Komponenten als überaus geeignet für die musikalische Bearbeitung in Opern .
Wer ist nun diese Medea, die französische, deutsche und italienische Literaten über Jahrhunderte gefangen hält? Dieser Frage soll anhand zweier Bearbeitungen des Medea- Mythos nachgegangen werden, der Tragödie Medeia des Euripides, sowie des Romans Medea. Stimmen von Christa Wolf.
Inhaltsverzeichnis
- Medea Gegenstand der europäischen Kunst und Literatur
- Medea - Die mythologische Überlieferung
- Euripides' Medea- Mythos
- Christa Wolfs Rückgriff auf den Medea- Mythos
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung der Medea bei Euripides und Christa Wolf.
- Die Beziehung zu Jason und Medeas Motiv zur Flucht
- Die Beziehung zur Köngstochter Glauke
- Das Motiv für Medeas Verbannung
- Medea - eine ambivalente Figur
- Heilerin oder Giftmischerin
- Unschuldiges Opfer oder kühne Verbrecherin
- Gesellschaftspolitische Situierung von Mann und Frau
- Aktuell Bezüge des Medea- Mythos in Christa Wolfs Medea. Stimmen.
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Figur der Medea in der europäischen Kunst und Literatur, insbesondere mit Euripides’ Tragödie "Medea" und Christa Wolfs Roman "Medea. Stimmen". Die Arbeit analysiert die mythologische Überlieferung der Figur, die verschiedenen Interpretationen des Mythos und die unterschiedlichen Bedeutungen, die Medea in den verschiedenen Epochen und Kulturen zugeschrieben wurden.
- Der Medea-Mythos als Spiegelbild von Kultur und Gesellschaft
- Die Ambivalenz der Figur Medea: Heilerin und Giftmischerin, Opfer und Täterin
- Der Einfluss des Medea-Mythos auf die europäische Literatur
- Die Darstellung von Frauen und Geschlechterrollen im antiken Griechenland und in der modernen Gesellschaft
- Der Umgang mit Gewalt und Rache in der Mythologie und Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Medea Gegenstand der europäischen Kunst und Literatur
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Medea-Mythos in der europäischen Literatur und Kunst. Es wird erläutert, dass die Figur der Medea in verschiedenen Werken bearbeitet und interpretiert wurde, wobei die kulturhistorischen Gegebenheiten die jeweilige Darstellung beeinflussten.
Kapitel 2: Medea - Die mythologische Überlieferung
Hier werden die verschiedenen Quellen der Medea-Geschichte aufgezeigt, insbesondere die "Argonautika" von Appolonius von Rhodos. Es wird die Liebesgeschichte von Medea und Jason und Medeas Rolle im Kampf um das Goldene Vlies erzählt. Auch Medeas grausame Taten, wie der Mord an ihrem Bruder und Pelias, werden hier thematisiert.
Kapitel 3: Euripides' Medea- Mythos
Dieses Kapitel konzentriert sich auf Euripides’ Tragödie "Medea". Es werden die Handlung des Stückes, die psychologische Motivation der Figuren und die Rolle des Frauenchors dargestellt. Auch die mögliche politische Intention Euripides’ wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Medea, Mythos, Euripides, Christa Wolf, Literatur, Kunst, Frauengestalten, Gewalt, Rache, Geschlechterrollen, Antike, Moderne, Interpretation, Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich die Medea bei Euripides von früheren Mythen?
Erst bei Euripides wird Medea zur Mörderin ihrer eigenen Kinder. In älteren Quellen wie bei Hesiod fehlt dieses Motiv des Kindsmords völlig.
Was ist das Besondere an Christa Wolfs "Medea. Stimmen"?
Christa Wolf greift auf ältere Schichten des Mythos zurück und stellt Medea als unschuldiges Opfer politischer Intrigen dar, statt als rachsüchtige Kindsmörderin.
Warum fasziniert die Figur der Medea die Literatur seit Jahrhunderten?
Medea verkörpert die Ambivalenz zwischen Heilerin und Giftmischerin, zwischen barbarischer Fremder und verletzter Ehefrau, was Raum für vielfältige Interpretationen bietet.
Welche Rolle spielt das Geschlechterverhältnis in den Medea-Bearbeitungen?
Sowohl Euripides als auch Christa Wolf thematisieren die gesellschaftspolitische Stellung von Mann und Frau sowie die Unterdrückung der Frau in patriarchalischen Strukturen.
Was motiviert Medea bei Euripides zu ihrer Tat?
Bei Euripides ist es die tiefe Kränkung und der Verrat durch Jason, der sie für eine andere Frau verlassen will, was ihren Wunsch nach extremer Rache auslöst.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Lembacher (Autor:in), 2007, Euripides Medeia und Christa Wolfs Medea Stimmen (1996), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/73081