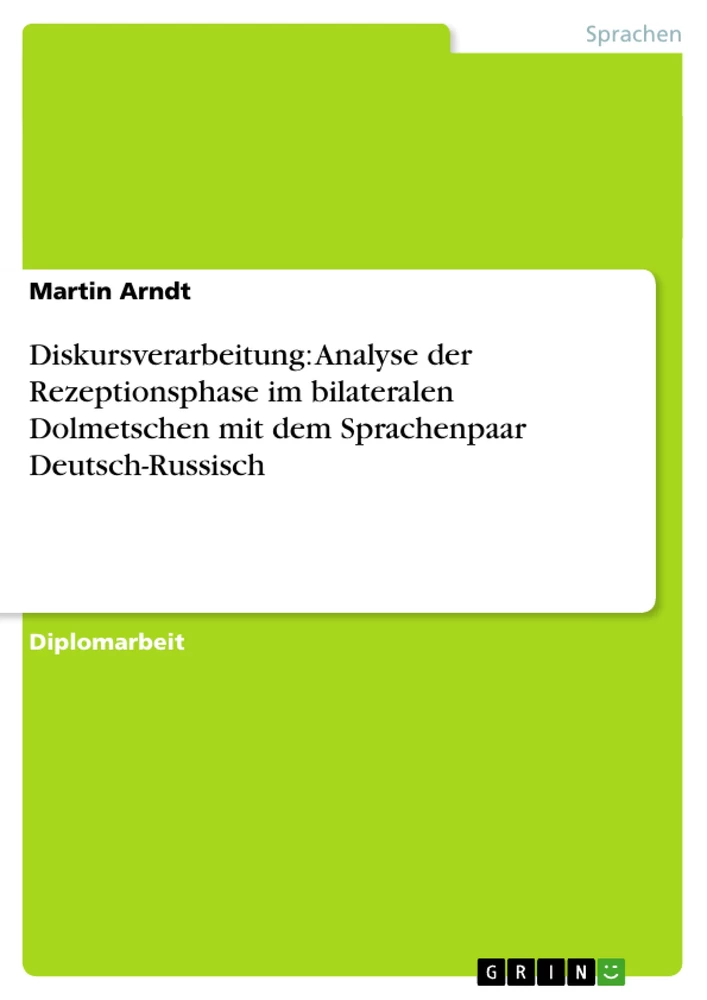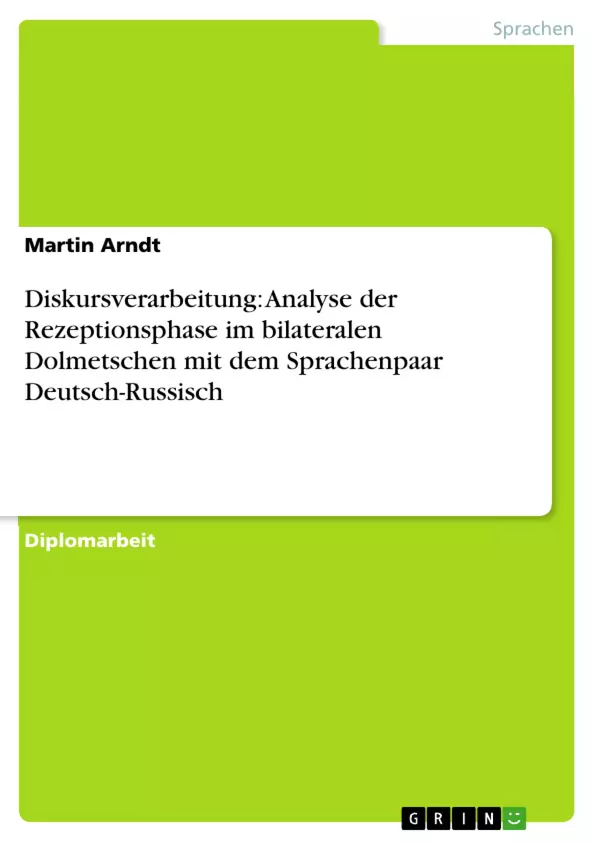Die Diskursverarbeitung als der große Abschnitt der Informationsaufnahme – der Rezeption – beim Dolmetschen ist in der Fachliteratur erst in Ansätzen untersucht worden. Dies gilt insbesondere für das dynamische bilaterale Dolmetschen, das in vorliegender Arbeit theoretisch und praktisch unter Verwendung des Sprachenpaares Deutsch – Russisch hinsichtlich der Rezeptionsphase untersucht wird.
Ganz offensichtlich trägt eine solche Untersuchung zur Erweiterung des Theoriegebäudes der Dolmetschwissenschaft bei. Insofern aber theoretisches Wissen das praktische Handeln und die Dolmetschleistung des Dolmetschers positiv beeinflussen kann, ist vorliegende Arbeit auch praktisch relevant: Wenn die aus der Analyse gewonnenen Ergebnisse für die universitäre Ausbildung eingesetzt werden, kann eine Optimierung der Rezeptionsqualität der Studenten und somit der zukünftigen Dolmetscher erreicht werden.
Die Rezeptionsphase des Dolmetschers ist methodologisch nur schwer zu untersuchen, denn es handelt sich um kognitive Prozesse, die von außen weitestgehend unsichtbar im Kopf des Dolmetschers – in der sogenannten „black box“ – ablaufen. Zeitlich ist die Rezeptionsphase nicht eindeutig von der Transposition und auch kaum von der (Re-)Produktion zu trennen, denn mitunter kann sich der Prozess des Verstehens bis in diese anderen Phasen erstrecken. Da ein unmittelbarer Zugang des Verstehensvorganges derzeit nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist, muss also auf die Korrelation zwischen Original und Translat zurückgegriffen werden, um Rückschlüsse bezüglich der Rezeptionsphase zu ziehen. Nach einer übergreifenden Einordnung des weiteren Untersuchungsbereiches – des bilateralen Dolmetschen – und des engeren Untersuchungsbereiches – die Rezeptionsphase im bilateralen Dolmetschen – werden Untersuchungsmethode und -kriterien zur empirischen Auswertung des aufgenommenen Tonbandmaterials hinsichtlich der Rezeptionsphase entwickelt. Es erfolgt im eigentlichen Hauptteil der Arbeit eine graphische Darstellung von theoretisch möglichen Existenzformen der kognitiven Gliederung. Im vierten Kapitel wird die theoretische Fundierung der Rezeptionsphase mit den praktischen Erkenntnissen zusammengeführt, um didaktische Konsequenzen für Gestaltung und Optimierung der universitären Ausbildung hinsichtlich der Rezeptionsphase beim Dolmetschen im Allgemeinen und beim bilateralen Dolmetschen im Besonderen zu erarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Ein einführendes Kapitel
- Kapitel 2: Ein weiteres wichtiges Kapitel
- Unterkapitel 2.1: Ein Unterkapitel
- Unterkapitel 2.2: Ein weiteres Unterkapitel
- Kapitel 3: Ein drittes Kapitel
- Unterkapitel 3.1: Ein Unterkapitel
- Unterkapitel 3.2: Ein weiteres Unterkapitel
- Unterkapitel 3.3: Ein drittes Unterkapitel
- Unterunterkapitel 3.3.1: Ein Beispiel
- Unterunterkapitel 3.3.2: Ein weiteres Beispiel
- Kapitel 4: Ein viertes Kapitel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, [hier die Zielsetzung des Werkes kurz beschreiben]. Die Analyse konzentriert sich auf die Interpretation und Einordnung der im Text präsentierten Informationen.
- Thema 1: [Hier das erste Hauptthema einfügen]
- Thema 2: [Hier das zweite Hauptthema einfügen]
- Thema 3: [Hier das dritte Hauptthema einfügen]
- Thema 4: [Hier das vierte Hauptthema einfügen, falls vorhanden]
- Thema 5: [Hier das fünfte Hauptthema einfügen, falls vorhanden]
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Ein einführendes Kapitel: Diese Einleitung legt den Grundstein für die gesamte Arbeit und führt den Leser in die Thematik ein. Es werden die wichtigsten Begriffe definiert, der Forschungsstand zusammengefasst und die Methodik der Analyse erläutert. Die Einleitung dient dazu, den Kontext der späteren Kapitel zu schaffen und die Relevanz der gewählten Themen zu unterstreichen. Hier wird beispielsweise [konkretes Beispiel aus der Einleitung] vorgestellt, um das Interesse des Lesers zu wecken und die Hauptfragen der Studie zu formulieren. Es soll ein Überblick über die behandelten Aspekte gegeben werden, ohne bereits detailliert in die Argumentation einzugehen.
Kapitel 2: Ein weiteres wichtiges Kapitel: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit [Hauptthema des Kapitels]. Es werden verschiedene Aspekte von [Hauptthema] beleuchtet, u.a. [Aspekt 1] und [Aspekt 2]. Die Analyse stützt sich auf [Quellen oder Methoden], die sorgfältig in den Unterkapiteln erläutert und angewendet werden. Durch die detaillierte Betrachtung wird ein umfassendes Verständnis von [Hauptthema] ermöglicht und der Weg für die Folgerungen in den späteren Kapiteln bereitet. Konkrete Beispiele im Kapitel veranschaulichen die argumentativen Punkte, z.B. [konkretes Beispiel]. Die Verbindungen zu anderen Kapiteln, insbesondere zu [anderes Kapitel], werden hier hergestellt.
Kapitel 3: Ein drittes Kapitel: Kapitel 3 widmet sich [Hauptthema des Kapitels], welches im Kontext der vorherigen Kapitel [Zusammenhang zu vorherigen Kapiteln] betrachtet wird. Die Argumentation des Kapitels basiert auf [Methode/Theorie] und wird durch [Beispiele] illustriert. Die verschiedenen Unterkapitel beleuchten spezifische Facetten des Hauptthemas und liefern ein differenziertes Bild von [Hauptthema]. Die Ergebnisse dieses Kapitels sind besonders relevant für [zukünftige Aspekte der Arbeit], welche in späteren Abschnitten behandelt werden.
Kapitel 4: Ein viertes Kapitel: [Hier die Zusammenfassung von Kapitel 4 einfügen, analog zur Struktur der vorherigen Kapitelzusammenfassungen. Mindestens 75 Wörter.]
Schlüsselwörter
Hier die Schlüsselwörter einfügen: [Schlüsselwörter in deutscher Sprache einfügen, z.B. Textanalyse, deutsche Sprache, Inhaltsanalyse, Thematik, Zusammenfassung, Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen].
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Komprehensiver Sprachüberblick
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über eine wissenschaftliche Arbeit. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der wichtigsten Themen, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der strukturierten Darstellung der Arbeit und der akademischen Analyse ihrer Inhalte.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in mehrere Abschnitte gegliedert: Ein Inhaltsverzeichnis mit Kapiteln und Unterkapiteln, ein Abschnitt zur Zielsetzung und den Themenschwerpunkten der Arbeit, ein Abschnitt mit Kapitelzusammenfassungen, die jeweils eine detaillierte Beschreibung des Inhalts und der Argumentation des jeweiligen Kapitels geben, und schließlich ein Abschnitt mit den wichtigsten Schlüsselwörtern der Arbeit.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die genauen Themen sind im Dokument nicht explizit benannt und müssen durch den Platzhaltertext "[Hier das erste Hauptthema einfügen]", "[Hier das zweite Hauptthema einfügen]" etc. ersetzt werden. Die Kapitelzusammenfassungen geben jedoch Hinweise auf die behandelten Inhalte. Die Schlüsselwörter bieten eine zusätzliche Orientierungshilfe für die behandelten Themen.
Wie ausführlich sind die Kapitelzusammenfassungen?
Die Kapitelzusammenfassungen sind relativ detailliert und beschreiben nicht nur den Inhalt, sondern auch die Argumentationsstruktur und die Methodik der jeweiligen Kapitel. Sie geben einen guten Überblick über die wichtigsten Punkte und die Verbindungen zwischen den einzelnen Kapiteln.
Wo finde ich die Schlüsselwörter?
Die Schlüsselwörter befinden sich im letzten Abschnitt des Dokuments, unter der Überschrift "Schlüsselwörter". Der Platzhaltertext "[Schlüsselwörter in deutscher Sprache einfügen, z.B. Textanalyse, deutsche Sprache, Inhaltsanalyse, Thematik, Zusammenfassung, Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen]" muss durch die tatsächlichen Schlüsselwörter ersetzt werden.
Wofür ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument dient als umfassender Überblick und dient der akademischen Analyse der Themen der zugrundeliegenden Arbeit. Es ist als Vorschau und Hilfsmittel gedacht, um die Struktur und den Inhalt der Arbeit schnell zu erfassen.
Welche Art von Informationen enthält das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis listet alle Kapitel und Unterkapitel der wissenschaftlichen Arbeit auf. Es bietet eine detaillierte Übersicht über die Struktur und den Aufbau des gesamten Textes. Es ermöglicht es, schnell einen bestimmten Abschnitt zu finden.
Wie kann ich das Dokument für meine eigene Recherche nutzen?
Das Dokument kann als Ausgangspunkt für die Analyse der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Arbeit verwendet werden. Die Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter erleichtern das Verständnis der behandelten Themen. Das Inhaltsverzeichnis hilft, sich im Text zu orientieren.
- Arbeit zitieren
- Martin Arndt (Autor:in), 2006, Diskursverarbeitung: Analyse der Rezeptionsphase im bilateralen Dolmetschen mit dem Sprachenpaar Deutsch-Russisch, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/71961