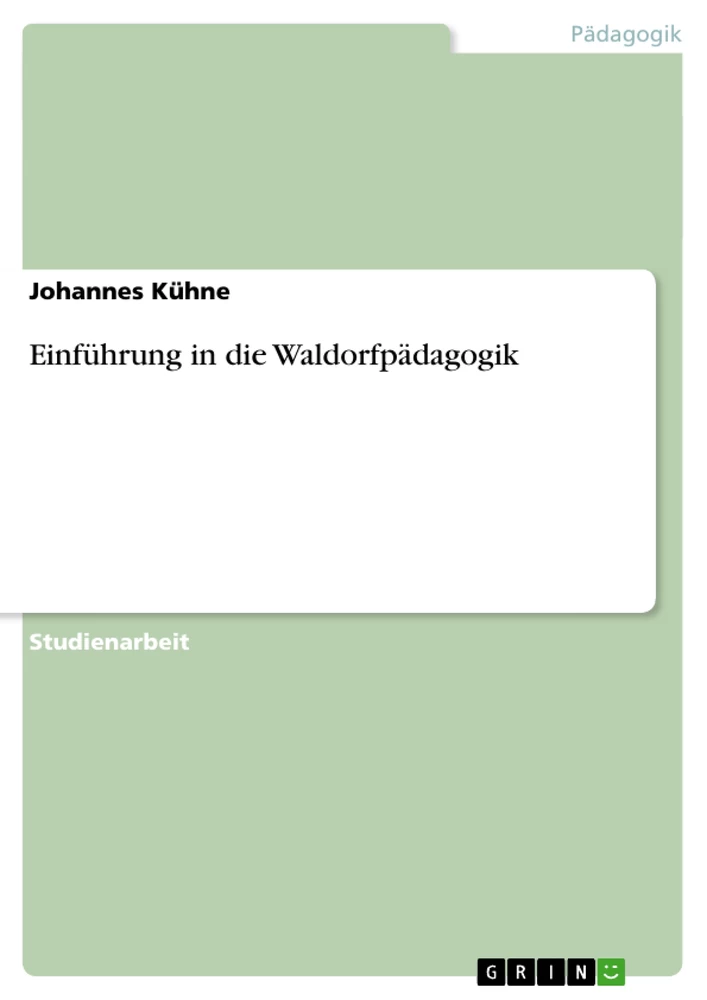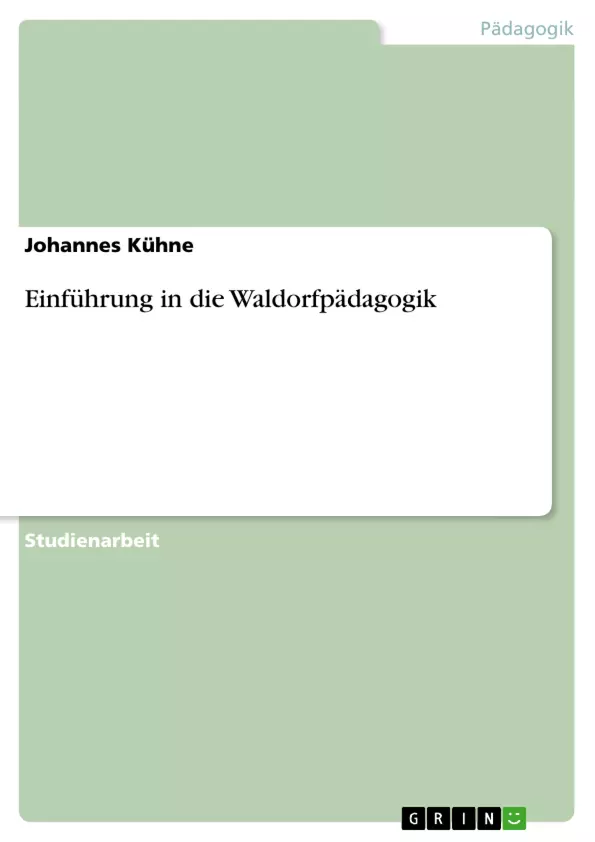„Die Begründung der Waldorfschulbewegung fällt in die entscheidungsvollen Jahre, die das Gesicht Europas in politisch-geschichtlicher Hinsicht tiefgreifend verändert haben.“ , schreibt Gerhard Wehr, ein Sozialpädagoge über die Entstehung der Waldorfschule. Rudolf Steiner, der Begründer der Waldorfschulen, war ein österreichischer Philosoph, Pädagoge und Naturwissenschaftler. 1913 gründete er die Anthroposophische Gesellschaft. Um die Jahrhundertwende fand er zu einer Weltanschauung, aus deren Philosophie schließlich die Pädagogik hervorging, auf der die Waldorfschule basiert.
Diese Arbeit wird kurz auf die Grundlagen der Anthroposophie und der daraus entstandenen Waldorfpädagogik eingehen und versuchen, eine Antwort auf die Frage zu geben, warum eine Schulform wie die Waldorfschule gerade in jener Zeit entstehen konnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Person Rudolf Steiner
- Grundlagen der Anthroposophie
- Die Verhältnisse der damaligen Zeit und das Konzept der Dreigliedrigkeit
- Die Waldorfpädagogik
- Die erste Schulgründung
- Die wesentlichen Inhalte des Lehrplans
- Die Verwaltung der Schule
- Der Waldorfkindergarten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Grundlagen der Anthroposophie und der daraus entstandenen Waldorfpädagogik. Sie untersucht, warum eine Schulform wie die Waldorfschule gerade im Kontext der gesellschaftlichen Umbrüche nach dem Ersten Weltkrieg entstand.
- Die Anthroposophie als Grundlage der Waldorfpädagogik
- Die Person Rudolf Steiner und seine Rolle bei der Entwicklung der Waldorfschule
- Die soziale Dreigliederung und ihr Einfluss auf die Entstehung der Waldorfschule
- Die wesentlichen Inhalte des Waldorflehrplans
- Die Besonderheiten der Waldorfschule im Vergleich zu anderen Schulformen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Waldorfpädagogik als Reaktion auf die gesellschaftlichen Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg vor.
- Zur Person Rudolf Steiner: Das Kapitel beleuchtet das Leben und Werk von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie und der Waldorfschule.
- Grundlagen der Anthroposophie: Hier werden die zentralen Ideen der Anthroposophie als philosophische und spirituelle Grundlage der Waldorfpädagogik erläutert.
- Die Verhältnisse der damaligen Zeit und das Konzept der Dreigliedrigkeit: Der Abschnitt beschreibt den historischen Kontext der Waldorfschulgründung und Steiners Konzept der sozialen Dreigliederung.
- Die Waldorfpädagogik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Gründung der ersten Waldorfschule, den wesentlichen Inhalten des Lehrplans, der Verwaltung der Schule und dem Waldorfkindergarten.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind: Waldorfpädagogik, Anthroposophie, Rudolf Steiner, Dreigliederung, soziale Neuordnung, Lehrplan, Waldorfkindergarten, gesellschaftliche Veränderungen, Erster Weltkrieg.
- Quote paper
- Johannes Kühne (Author), 2003, Einführung in die Waldorfpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/71728