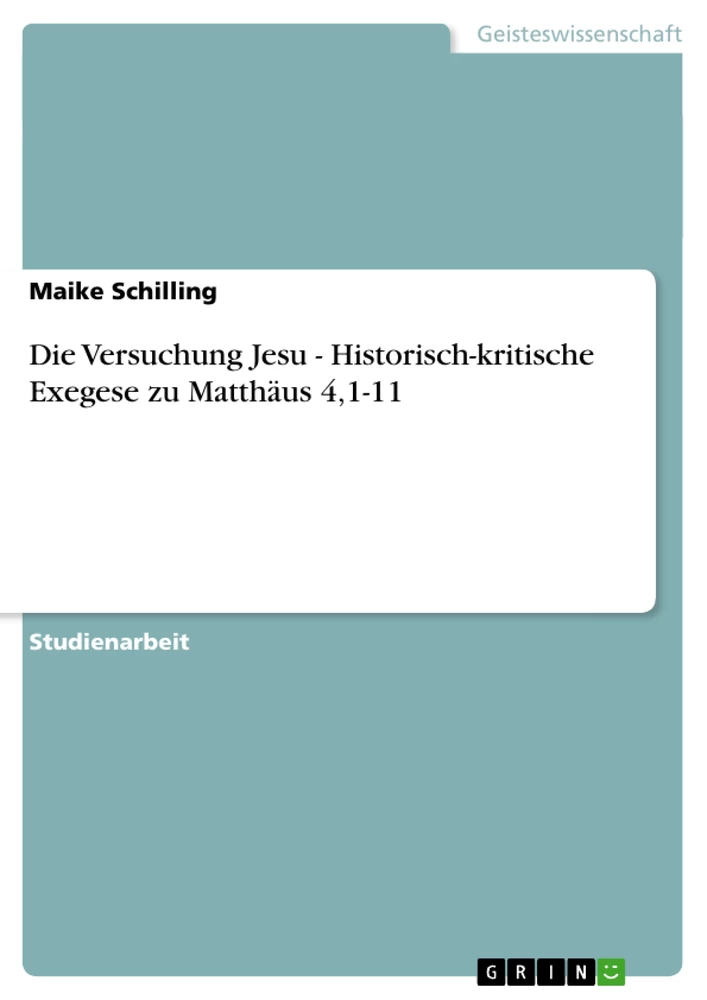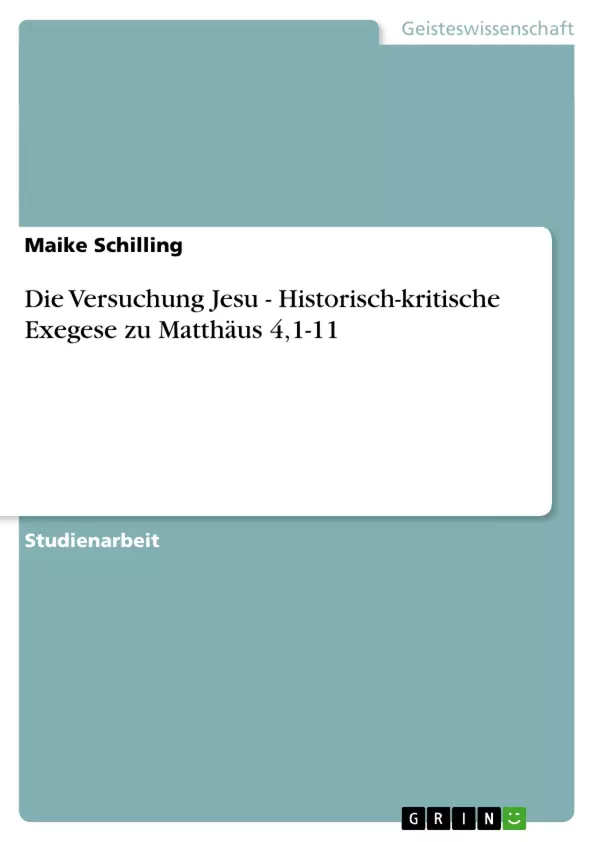Ich werde mich in meiner Exegese mit der Perikope „Jesu Versuchung“ (Mt 4,1-11) beschäftigen. Es gibt verschiedene Gründe, aus denen ich diese Geschichte ausgewählt habe. Zunächst fand ich sie beim ersten Lesen einfach interessant und mir sind spontan mehrere Fragen dazu eingefallen. Die erste Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, ist folgende: Will der Teufel einen Beweis dafür, dass Jesus Gottes Sohn ist oder will er ihn von Gott abbringen? Außerdem frage ich mich, ob es Jesus nicht reizt, dem Teufel zu zeigen, was er kann, was ja ein sehr menschliches Gefühl wäre. Daraus ergeben sich noch mehr Fragen, wie zum Beispiel, ob und wie wir selbst in Versuchung geführt werden und ob wir in solchen Situationen genauso standhaft sein können, wie Jesus es ist.
Gerade auf dem Hintergrund der letzten Fragen glaube ich, dass sich der Text auch gut dazu eignen würde, ihn mit Schülern zu besprechen, mit ihnen beispielsweise zu diskutieren, was sie als Versuchung bezeichnen und was nicht, oder ob sie „Versuchung“ überhaupt immer in Verbindung mit Gott sehen. Weiterführend könnte man auch darüber nachdenken, wie man selbst im Alltag an seinem Glauben festhalten kann, wenn man von anderen provoziert wird. Aufgrund all dieser Überlegungen denke ich, dass es sehr interessant sein wird, sich mit dem Text zu beschäftigen und hoffe, dass ich danach einige meiner Fragen beantworten kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Übersetzungsvergleich
- 2.1 Kurze Interpretation der Unterschiede
- 3.0 Literarkritik
- 3.1 Kontextkritik
- 3.2 Kohärenzkritik
- 4.0 Überlieferungskritik
- 5.0 Quellenkritik
- 5.1 Synoptischer Vergleich
- 6.0 Redaktionskritik
- 7.0 Formkritik
- 8.0 Gattungskritik
- 8.1 „Sitz im Leben“
- 9.0 Traditionskritik
- 10.0 Bestimmung des historischen Ortes
- 11.0 Klärung von Einzelaspekten
- 11.1 Begriffe
- 11.2 Sachfragen
- 12.0 Einzelexegese - Vers für Vers
- 13.0 Deutende Zusammenfassung der Ergebnisse der Exegese
- 14.0 Auslegung der Perikope mit Hilfe einer Kinderbibel
- 14.1 Art der Kinderbibel
- 14.2 Kontext
- 14.3 Ergänzungen
- 14.4 Intention der Geschichte
- 14.5 Illustrationen
- 15.0 Vergleich der beiden Auslegungsmethoden
- 16.0 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Exegese befasst sich mit der Perikope „Jesu Versuchung“ (Mt 4,1-11) und untersucht verschiedene Aspekte dieser Geschichte. Ziel ist es, die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und verschiedene Fragen zu beantworten, die sich beim Lesen des Textes stellen. Die Arbeit befasst sich auch mit der Frage, wie man den Text mit Schülern diskutieren kann und wie er im Alltag zum Nachdenken über den eigenen Glauben anregen kann.
- Übersetzungsvergleich verschiedener Bibelübersetzungen
- Literarische und kritische Analyse der Perikope
- Untersuchung der Überlieferung und Quellen des Textes
- Deutung der Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven
- Vergleich verschiedener Auslegungsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Perikope „Jesu Versuchung“ (Mt 4,1-11) vor und erläutert die Motivation für die Exegese. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit einem detaillierten Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen, einer literarischen und kritischen Analyse des Textes, der Untersuchung der Überlieferung und Quellen, der Deutung der Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven und einem Vergleich verschiedener Auslegungsmethoden.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter in diesem Text sind: Jesu Versuchung, Matthäus 4,1-11, Bibelübersetzungen, Literarkritik, Kontextkritik, Kohärenzkritik, Überlieferungskritik, Quellenkritik, Exegese, Auslegung, Kinderbibel, Glaube, Versuchung.
- Arbeit zitieren
- Maike Schilling (Autor:in), 2006, Die Versuchung Jesu - Historisch-kritische Exegese zu Matthäus 4,1-11, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/70463