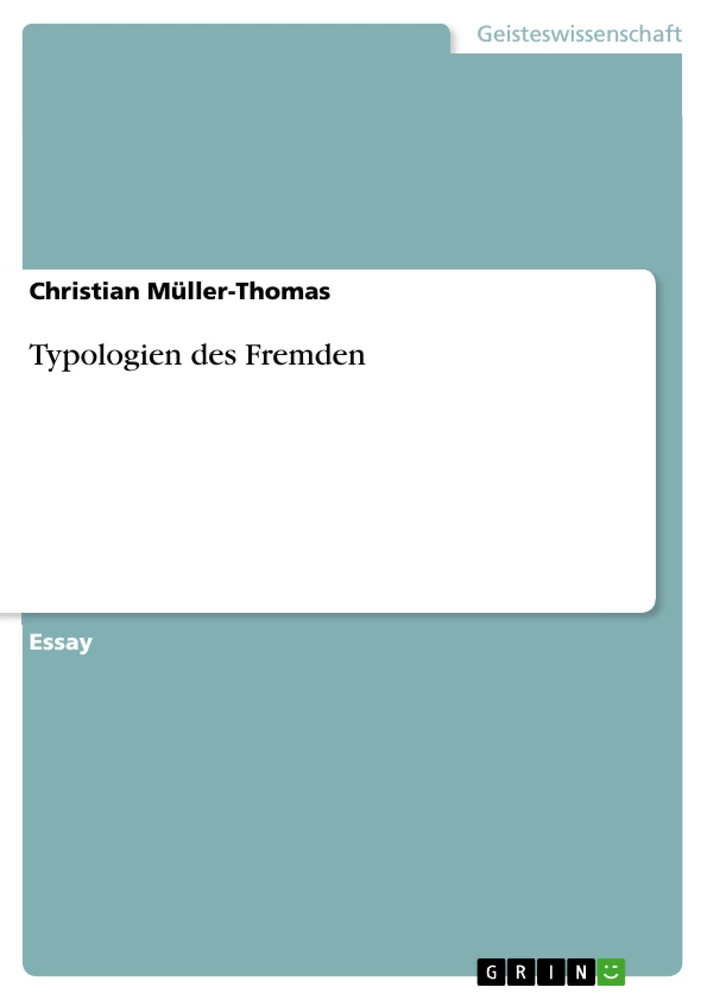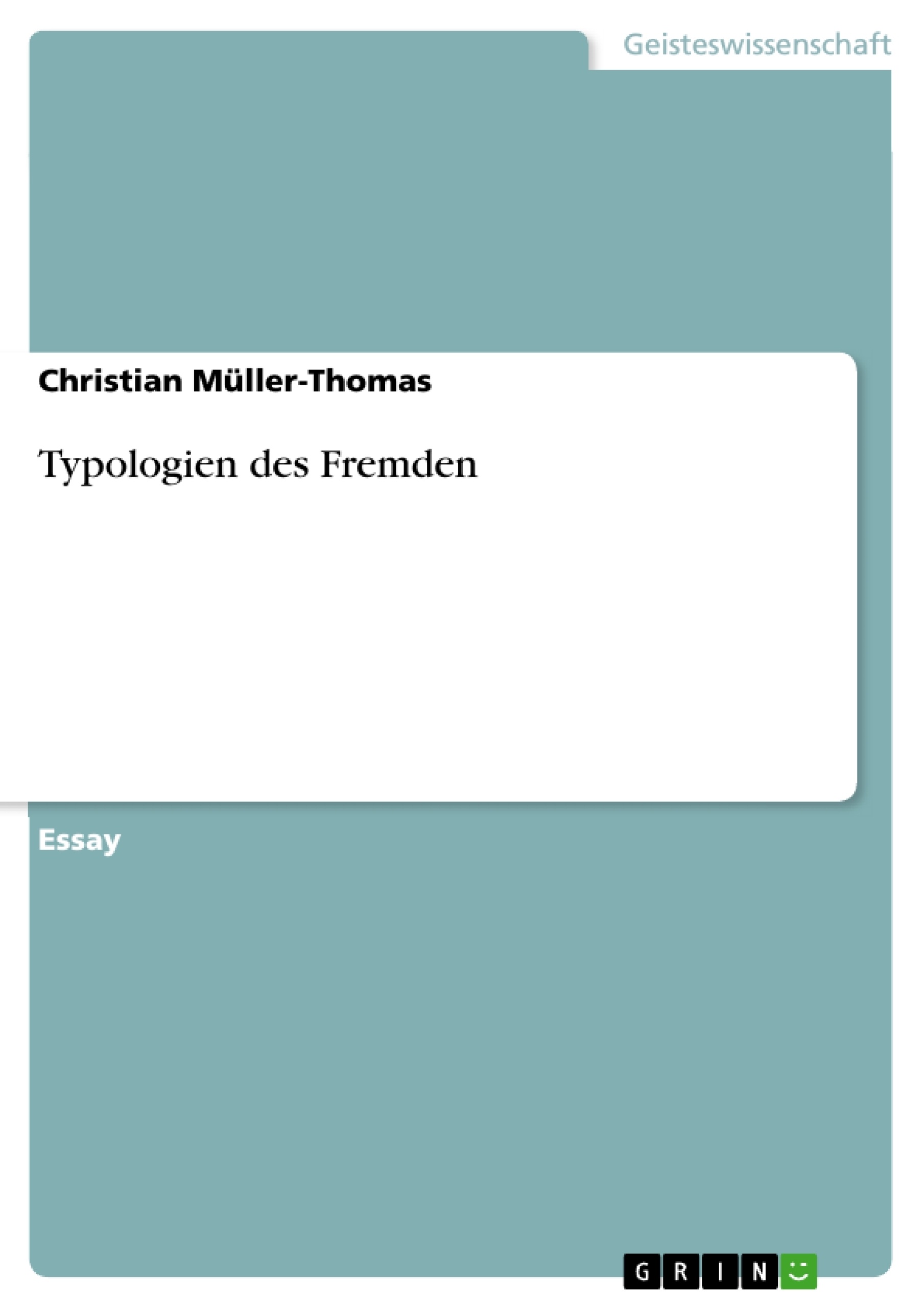Simmel vereinheitlicht in der soziologischen Form des Fremden den begrifflichen Gegensatz von Wandern und Fixiertheit. Der Fremde ist der potentiell Wandernde, der die Gelöstheit des Kommens und des Gehens nie ganz überwunden hat. Hier definiert Simmel: den Fremden, der heute kommt und morgen bleibt. Der Fremde gehört aufgrund seines mobilen Charakters nicht ganz zur Gemeinschaft, trägt dadurch aber wiederum fremde Qualitäten in sein Umfeld herein. Das Beispiel des Händlers kommt diesem Typus am nächsten. Anders als bei Schütz, wie im späteren noch erläutert werden wird, ist der Fremde nach Simmel von vorn herein kein Unbekannter. Für den gänzlich Unbekannten verwendet Simmel den aus dem griechischen abgeleiteten Begriff des „Sirius“.
Während Simmel den Fremden in seinem Umfeld fixiert sieht und ihn trotz Mobilität als ein Element der Gruppe selbst betrachtet, muss sich nach Schütz, der Fremde einer Gruppe annähern und von dieser dauerhaft akzeptiert oder zumindest geduldet werden. Kinder, Primitive, vor allem aber Gäste und Besucher zählen nach der schützschen Anschauung nicht als Fremde. Zudem zieht Schütz hier eine Parallele zwischen den beiden soziologischen Formen des Fremden und des Heimkehrers. Beide versuchen ihr relevantes System (Heimat oder Fremde) also die Welt um sich herum, zu einem beherrschbaren Feld zu ordnen, da sie in diesem fremd oder fremd geworden sind.
Inhaltsverzeichnis
- Hinter dem deutschen Ausdruck für „Fremd“ verbirgt sich ein komplexer Bedeutungsgehalt.
- Simmel vereinheitlicht in der soziologischen Form des Fremden den begrifflichen Gegensatz von Wandern und Fixiertheit.
- Während Simmel den Fremden in seinem Umfeld fixiert sieht und ihn trotz Mobilität als ein Element der Gruppe selbst betrachtet, muss sich nach Schütz, der Fremde einer Gruppe nähern und von dieser dauerhaft akzeptiert oder zumindest geduldet werden.
- Dem Fremden ist das gesellschaftliche Wissen über „in-group´s“ in der Fremde unvertraut.
- In seinem Aufsatz der Fremde beschreibt Schütz zudem, die Annäherung des Fremden auf eine „in-group“ und unterscheidet dabei zum einen zwischen homogenen und nicht-homogenen Gruppen und verdeutlicht zum anderen den Unterschied zwischen Fremdheitserfahrung und Fremdheitskonstruktion einer Gruppe gegenüber dem Fremden.
- Ein typisches Fremdenbild von nicht vollkommener Integration stellt der Gastarbeiter dar.
- Historisch und typologisch ist der emanzipierte Jude der Fremde par excellence und zugleich ein positives Musterbeispiel des „marginal man“, den Robert Park sogar als den „ersten Kosmopolit und Weltbürger“¹³ sieht.
- Der individuelle Migrant distanziert sich nicht nur physisch sondern auch kulturell von seiner Heimat indem er seine alten kollektiven Sitten und Gebräuche ablegt.
- Der Kosmopolit hingegen unterhält Beziehungen zu einer Vielzahl von fremden Kulturen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay beschäftigt sich mit der Typologisierung des Fremden und untersucht verschiedene Konzepte von Fremdenbildern, insbesondere die von Georg Simmel und Alfred Schütz. Der Fokus liegt auf der vergleichenden Darstellung dieser Konzepte, sowohl zueinander als auch in Bezug auf spätere Ansätze aus dem Themenblock II: „Typologien des Fremden“. Zusätzlich werden die Problemfelder beleuchtet, die in den verschiedenen Fremdentypologien zur Sprache kommen.
- Die Konzepte von Fremdenbildern bei Georg Simmel und Alfred Schütz
- Vergleichende Analyse der Konzepte von Simmel und Schütz
- Weiterentwicklung der Konzepte im Vergleich zu späteren Ansätzen
- Problemfelder der verschiedenen Fremdentypologien
- Anregungen zur weiteren Problemanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Essay beginnt mit einer kurzen Einführung in den komplexen Bedeutungsgehalt des Begriffs „Fremd“ und seiner Vielschichtigkeit in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen.
- Anschließend werden die Konzepte von Georg Simmel und Alfred Schütz zur Fremdenbilder vorgestellt. Simmel betrachtet den Fremden aus der Perspektive der „Nicht-Fremden“, während Schütz sich auf die Sichtweise „des Fremden“ selbst konzentriert.
- Der Essay vertieft die Analyse der Konzepte von Simmel und Schütz, indem er die Unterschiede in ihrer Sichtweise auf den Fremden sowie deren Mobilität und Integration in die Gesellschaft beleuchtet.
- Die Analyse erweitert sich auf die Rolle des Wissens und der Anpassung des Fremden in einer neuen Zivilisation und die damit verbundenen Herausforderungen.
- Der Essay untersucht die Bedeutung des Gastarbeiters als ein Beispiel für nicht vollkommene Integration und stellt den Zusammenhang mit dem Konzept des „marginal man“ her.
- Weiterhin wird der emanzipierte Jude als ein positives Musterbeispiel des „marginal man“ und dessen mögliche Beziehung zum Kosmopoliten beleuchtet.
- Die Analyse der Migrationserfahrungen von Park und die Entwicklung des Migranten vom alten zum neuen Umfeld werden vorgestellt.
- Der Essay führt den Kosmopoliten als eine Person ein, die Beziehungen zu verschiedenen Kulturen pflegt, und analysiert dessen komplexe Rolle und Fähigkeiten.
Schlüsselwörter
Der Essay behandelt die zentralen Themen des Fremdenbegriffs, der Fremdenbilder, der Typologisierung des Fremden, der Integration und Assimilation, der „in-group´s“, der Zivilisationszugehörigkeit, der „marginal man“ und des Kosmopoliten. Dabei werden die Konzepte von Georg Simmel, Alfred Schütz, Robert Park und Ulf Hannerz herangezogen.
- Quote paper
- Christian Müller-Thomas (Author), 2006, Typologien des Fremden, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/70207