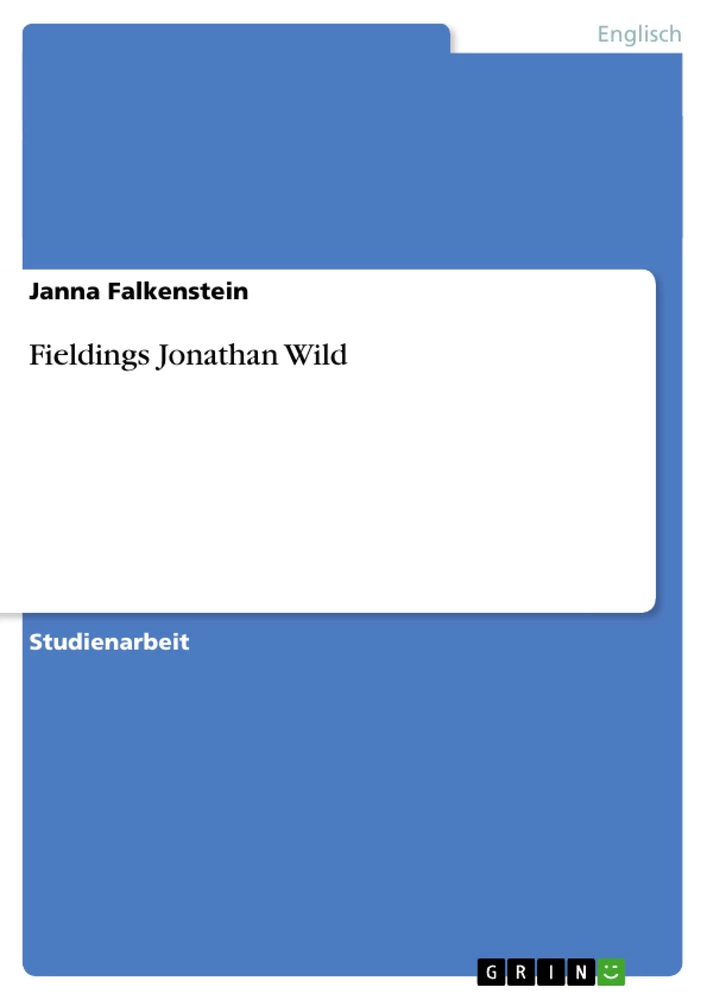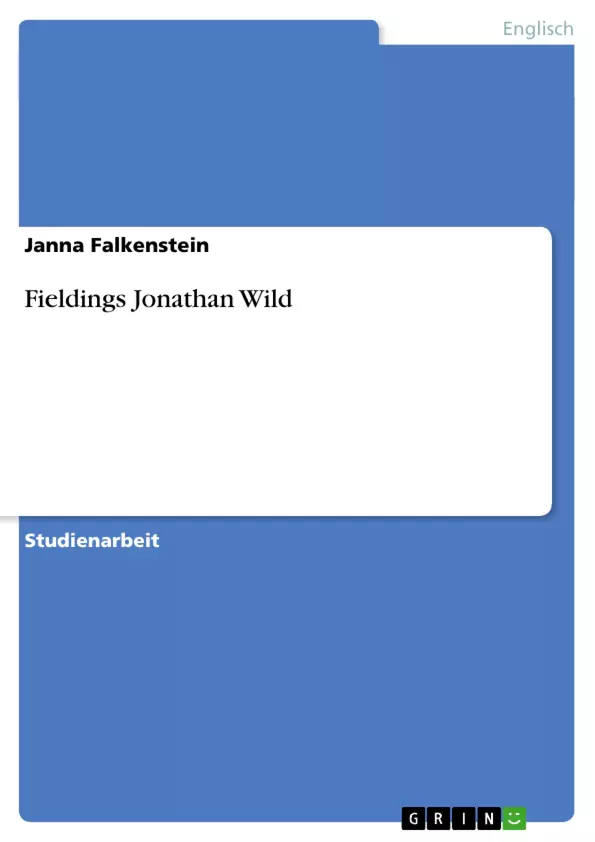Gegenstand dieser Arbeit ist Henry Fieldings Erzählung Jonathan Wild. Die Erzählung erschien erstmalig 1743 in Fieldings Sammlung Miscellanies und basiert zum einen auf dem Leben des berüchtigten Diebes und thief-takers Jonathan Wild und zum anderen auf fiktiven Elementen. Die Anzahl von Fielding hinzu gedichteter Begebenheiten und Charaktere ist so groß, dass man nicht mehr von einer Biographie von Jonathan Wild sprechen kann. Sein Leben und der schlechte Ruf, der ihm vorauseilte, dienen lediglich als Grundgerüst für eine bissige Erzählung, die sich die Verbrecher seiner Zeit vornimmt. Viele Kritiker sind der Meinung, dass Jonathan Wild in erster Linie eine politische Satire auf den damaligen Premierminister Englands Robert Walpole ist. Dies ist auch nicht von der Hand zu weisen. Die Moralvorstellungen die Fielding zu vermitteln versucht sind außerdem durchaus aktuell und können auch für „große Männer“ unserer Zeit gelten. Des Weiteren ist Fieldings Version von Jonathan Wilds Lebensgeschichte eine satirisch-ironische Darstellung der damaligen Londoner Gesellschaft. Vom kleinen Dieb über die untreue Ehefrau bis zum großen Politiker bekommt jeder sein Fett weg. Fielding rechnet geschickt und mit unnachahmlicher Ironie mit jedem Lügner und Betrüger ab. Trotz aller Übertreibungen zeichnet er dabei ein Bild der Gesellschaft, das der damaligen Realität recht nahe kommt. Diese Arbeit gliedert sich in vier Teile. Zunächst wird das Leben des wahren Jonathan Wild beschrieben, um eine Vorstellung davon zu vermitteln, auf welcher Grundlage Fieldings Werk entstand. Danach folgt ein Kapitel über Henry Fielding, seine Vorstellungen von Moral und welche Bedeutung diese für sein Werk haben. Danach wird die Geschichte des fiktiven Jonathan Wild umrissen und verglichen, inwieweit sich Fielding an das Original hielt, bzw. seiner Fantasie freien Lauf ließ. Anschließend wird auf den wichtigsten Schauplatz in Jonathan Wild, das Newgate Gefängnis, eingegangen. Im Laufe der Arbeit soll außerdem dargestellt werden, wie sich Fieldings Roman in das Bild der Londoner Gesellschaft des 18. Jahrhunderts einfügt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Fieldings Jonathan Wild – Eine Abrechnung
- Jonathan Wild - historische Hintergründe
- Henry Fielding - Autor und Jurist
- Jonathan Wild - the Great
- Schauplatz Newgate
- Jedem, was er verdient
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Henry Fieldings Erzählung "Jonathan Wild" und untersucht die Beziehung zwischen dem Leben des realen Jonathan Wild, einem berüchtigten Dieb und "thief-taker", und der fiktiven Darstellung in Fieldings Werk. Die Arbeit befasst sich auch mit Fieldings satirischen Absichten und wie er die Londoner Gesellschaft des 18. Jahrhunderts in seiner Erzählung darstellt.
- Das Leben des realen Jonathan Wild und die historischen Hintergründe
- Henry Fieldings Moralvorstellungen und ihre Bedeutung für "Jonathan Wild"
- Die fiktive Darstellung Jonathan Wilds in Fieldings Erzählung
- Die Rolle des Newgate-Gefängnisses in der Erzählung
- Fieldings satirische Darstellung der Londoner Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel befasst sich mit dem Leben des realen Jonathan Wild. Es beschreibt seine frühen Jahre, seine kriminellen Aktivitäten und die Methoden, mit denen er sich scheinbar auf der Seite des Gesetzes bewegte, während er gleichzeitig eine Bande von Dieben kontrollierte. Das Kapitel zeigt, wie Wilds System funktionierte und wie er sowohl die Justiz als auch die Bevölkerung für seine Machenschaften manipulierte.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Henry Fielding, seiner Persönlichkeit und seinen Moralvorstellungen. Es untersucht, wie Fieldings eigene Ansichten über Recht und Unrecht in "Jonathan Wild" zum Ausdruck kommen.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die fiktive Darstellung Jonathan Wilds in Fieldings Erzählung. Es analysiert die Unterschiede zwischen der realen und der fiktiven Figur und erörtert, inwieweit Fielding sich an die historischen Fakten hielt und wie er seine Fantasie einbezog.
- Das vierte Kapitel widmet sich dem Newgate-Gefängnis, das in "Jonathan Wild" eine zentrale Rolle spielt. Es untersucht die Bedeutung des Gefängnisses als Schauplatz und wie Fielding dieses in seine satirische Darstellung der Londoner Gesellschaft einblendet.
Schlüsselwörter
Jonathan Wild, Henry Fielding, Londoner Gesellschaft, Kriminalität, Moral, Satire, Newgate-Gefängnis, "thief-taker", historische Hintergründe, fiktive Darstellung, politische Satire, Ironie, Londoner Unterwelt.
- Quote paper
- Janna Falkenstein (Author), 2006, Fieldings Jonathan Wild, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/69921