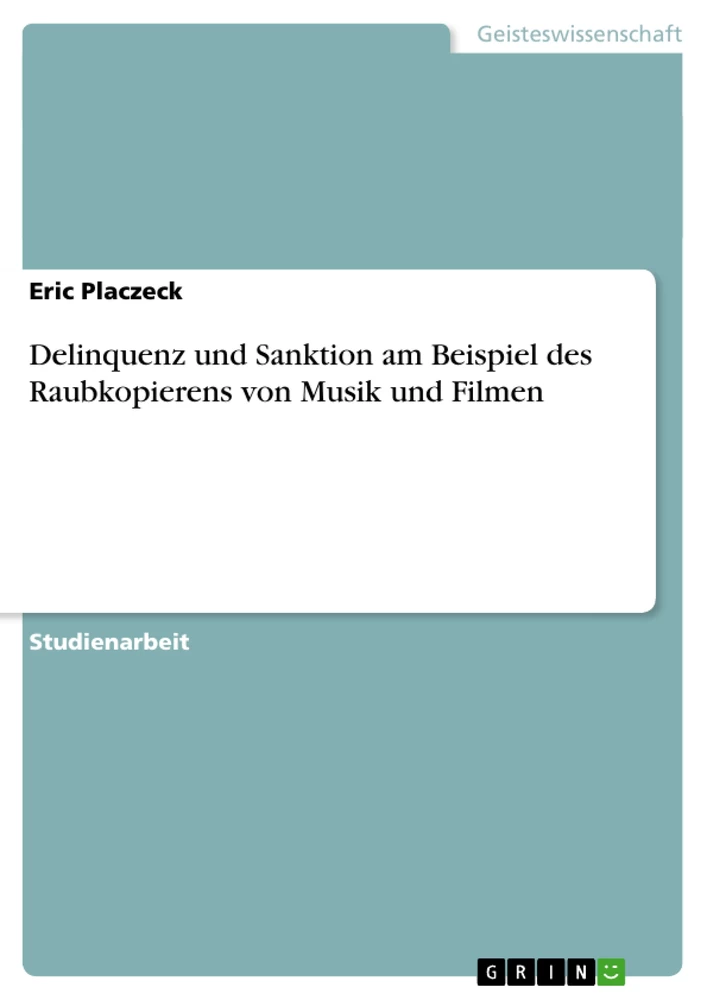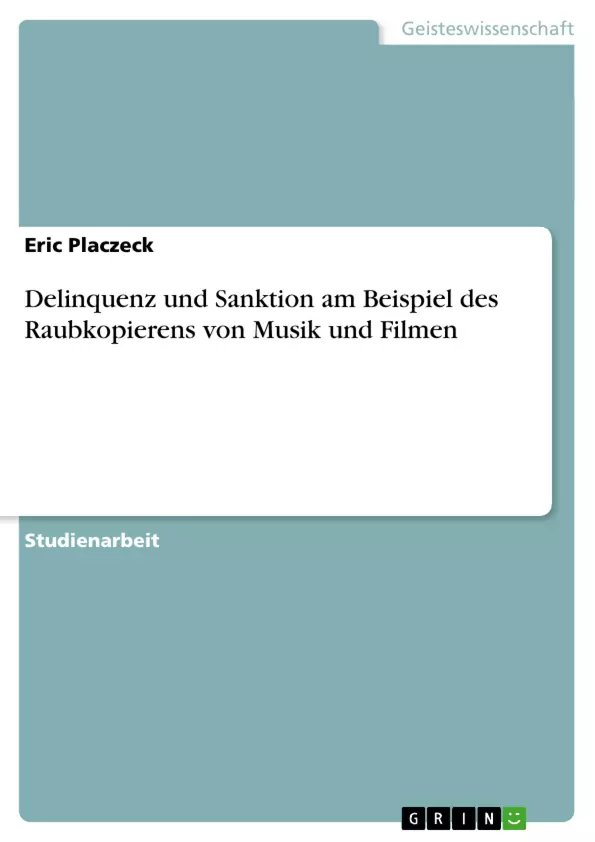Ein Sohn möchte seinen Eltern zu Weihnachten eine besondere Freude machen und stellt eine Audio-CD mit deren Lieblingsliedern zusammen. Die Lieder sammelt er teilweise von CDs, die er sich von den Eltern seiner Freunde ausgeliehen hat, und manche Songs lädt er sich aus dem Internet herunter – kostenlos natürlich. Bei der Bescherung freuen sich die Eltern über die CD, ob seiner Punktlandung auf ihrem Musikgeschmack.
Diese fiktive Geschichte schildert die kriminelle Tat einer Person, die sich der juristischen Tragweite ihres Handelns womöglich gar nicht bewusst ist. Der Sohn hat sich rechtlich des Herunterladens illegaler Musik aus dem Internet schuldig gemacht, weil er statt eines kostenpflichtigen ein kostenloses Downloadportal genutzt hat. Des weiteren könnten die geliehenen Tonträger bereits kopierte Exemplare sein zu deren Erstellung der Kopierschutz der Original-CDs umgangen wurde. Oder er selbst hat den Kopierschutz von geliehenen Originalen geknackt. Für die Qualität der Lieder ist die Anzahl der Vervielfältigungen ohnehin unerheblich. Werden ihm derartige Handlungen gerichtlich nachgewiesen hat er eine Strafe zu befürchten. Die statistische Dimension derartigen Verhaltens in Deutschland wird im ersten Abschnitt dargestellt.
Hinter dem geschilderten hypothetischen Beispiel steht eine internationale Diskussion um die urheberrechtliche Einordnung geistigen Eigentums. Die grundlegenden Weichen des World Intellectual Property-Vertrags mussten den Spagat zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Künstler und der Privatkopierfreiheit der Konsumenten schaffen. Diese hat im deutschen Urheberrechtsgesetz immer noch Bestand. Wie dieser schmale Grat in der Änderung des deutschen Urheberrechts 2003 beschritten wurde, ist Inhalt des zweiten Kapitels.
Ab dem dritten Teil wird aus soziologischem Blickwinkel auf das Thema „Raubkopie“ eingegangen. Zunächst wird an R. Mertons innovativem Anpassungstyp der gewerbliche Handel mit Raubkopien dargestellt. Anschließend wird eine Unterscheidung zwischen abweichendem und delinquentem Verhalten jenes Anpassungstyps vorgenommen. Gegenläufig zu dazu wird mittels des Rational-Choice-Ansatzes das mögliche Entscheidungsverhalten eines privaten Raubkopierers nachvollzogen.
Im letzten Teil wird die Wirkung verschiedener Sanktionsformen erörtert, mit denen seitens des Staates und seitens der Musikindustrie illegales Raubkopieren bestraft wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Dimension der Verbreitung digitaler Medien in Deutschland
- 1.1 Straftat „Raubkopie“
- 2. Geistiges Eigentum und das Urheberrecht
- 2.1 Die Reformen des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft
- 2.1.1 Der „Erste Korb“
- 2.1.2 Der „Zweite Korb“
- 2.1.3 Das Strafmaß
- 3. Delinquentes Verhalten am Beispiel des Raubkopierens
- 3.1 Die soziale Struktur bei Merton
- 3.1.1 Raubkopienhandel als delinquentes Verhalten des Innovationstypus’
- 3.1.2 Unterscheidung zwischen abweichendem und delinquenten Verhalten
- 3.2 Rational-Choice-Ansatz nach Gary S. Becker
- 3.2.1 Bewertung des Rational-Choice-Ansatzes für kriminelles Verhalten
- 4. Definition von Sanktion
- 4.1 Juristische Sanktionierung des Raubkopierens
- 4.1.1 Präventivwirkung der Sanktionen
- 4.2 Sanktionierungsformen der Musikindustrie
- 5. Fazit
- 6. Querverweise
- 7. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Problematik des Raubkopierens von Filmen und Musik, wobei der Fokus auf den soziologischen Aspekten des delinquenten Verhaltens liegt.
- Die Verbreitung digitaler Medien in Deutschland und die steigende Bedeutung des Internets als Verbreitungsmedium für Unterhaltungsinhalte.
- Das Urheberrecht und seine Reformen in der Informationsgesellschaft, insbesondere die Abwägung zwischen wirtschaftlichen Interessen der Künstler und der Informationsfreiheit der Konsumenten.
- Die Analyse des delinquenten Verhaltens am Beispiel des Raubkopierens unter Einbezug der soziologischen Theorien von Merton und Becker.
- Die verschiedenen Sanktionsformen, die von staatlicher Seite und der Musikindustrie zur Bekämpfung des Raubkopierens eingesetzt werden.
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Verbreitung digitaler Medien in Deutschland anhand von Daten der GfK Brennerstudie beleuchtet. Es wird die Verbreitung von CD- und DVD-Brennern, MP3-Playern und MP3-Handys sowie die Anzahl der bespielten Rohlinge dargestellt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem geistigen Eigentum und dem Urheberrecht. Es werden die Reformen des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, insbesondere die Einführung des „Ersten“ und „Zweiten Korbs“ im deutschen Urheberrechtsgesetz, behandelt.
Kapitel drei analysiert das delinquente Verhalten am Beispiel des Raubkopierens. Es werden die Theorien von Merton und Becker herangezogen, um die sozial-strukturellen Ursachen und das Entscheidungsverhalten von Raubkopierern zu erklären.
Im vierten Kapitel werden verschiedene Sanktionsformen erörtert, die von staatlicher Seite und der Musikindustrie gegen illegales Raubkopieren eingesetzt werden. Es werden juristische Sanktionen und die präventive Wirkung von Sanktionen sowie Sanktionierungsformen der Musikindustrie betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich dem Themenfeld des Raubkopierens von Filmen und Musik und befasst sich mit zentralen Begriffen wie Urheberrecht, geistiges Eigentum, delinquentes Verhalten, Sanktionen, Informationsgesellschaft, Merton, Becker und Rational-Choice-Ansatz.
- Quote paper
- Eric Placzeck (Author), 2007, Delinquenz und Sanktion am Beispiel des Raubkopierens von Musik und Filmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/69382