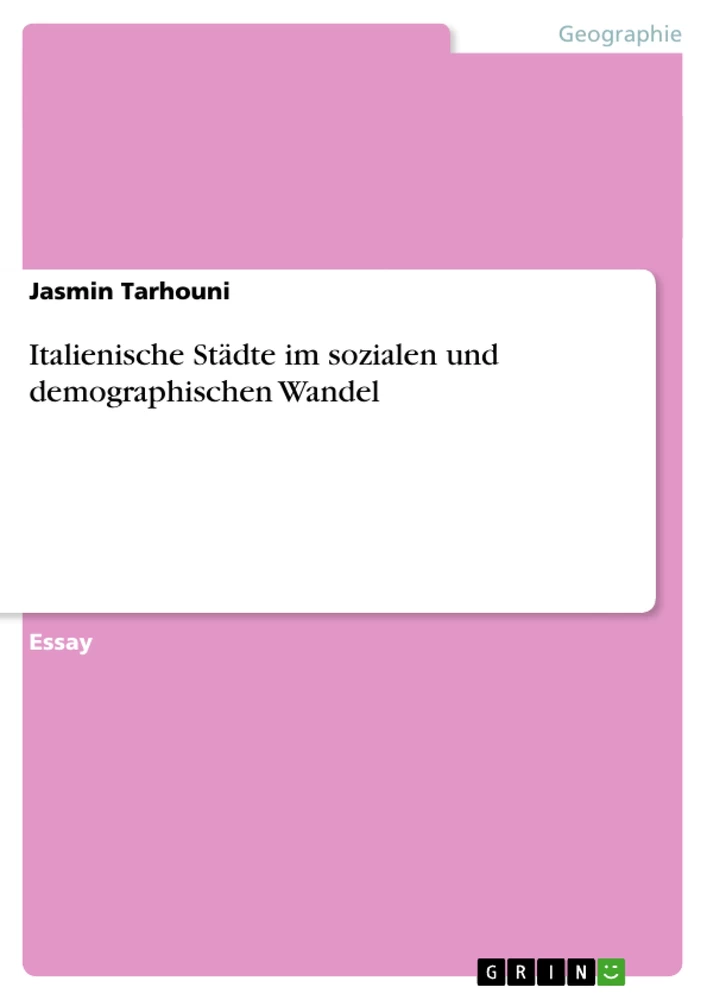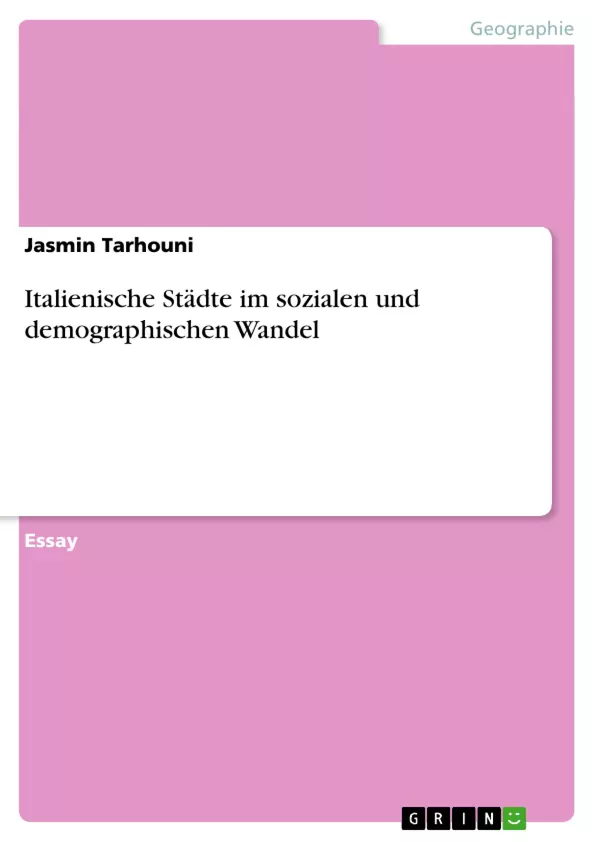Italien hat sich in den 1950/60er erfolgreich vom Agrar- zum Industriestaat gewandelt und gilt seit Beginn der fordistischen Wirtschaftsentwicklung als wichtigster Industriestaat im Mittelmeerraum. Das Wachstum der Wirtschaft war jedoch nicht nur durch ökonomische Faktoren bestimmt, sondern ebenso durch die Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen. Italien hat sich nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht modifiziert, auch das generative Verhalten der Bevölkerung hat sich dem der Partnerstaaten der EU angepasst. Da die Attraktivität der Städte mit dem positiven Wandel der Wirtschaft zunahm, war das Wachstum dieser unabwendbar. Die Großstädte wuchsen infolge der starken Landflucht und brachten immense Stadtregionen hervor. Die Stadtentwicklung, der soziale Wandel als auch die Veränderungen der Wirtschafts- und Erwerbsstruktur stellen demnach eine enge Verflechtung im Zuge der Industrialisierung dar und haben den Prozess der Verstädterung enorm beeinflusst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die italienische Bevölkerungsstruktur im Wandel
- Der demographische Wandel
- Der soziale Wandel
- Italien, der heterogene Raum
- Das Wachstum der italienischen Städte
- Das Wachstum der Großstädte
- Die Stadt Mailand
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel italienischer Städte im Kontext des sozialen und demografischen Wandels des Landes seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie beleuchtet die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, Bevölkerungsdynamik und städtebaulicher Entwicklung.
- Der demografische Wandel Italiens und sein Einfluss auf die Städte
- Der soziale Wandel und die Auswirkungen auf die Migration und die städtische Entwicklung
- Die regionale Disparität in Italien und ihre Manifestation in den Städten
- Das Wachstum italienischer Städte im Kontext der Industrialisierung und Landflucht
- Die Suburbanisierung als neuer Trend in der italienischen Stadtentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den erfolgreichen Wandel Italiens vom Agrar- zum Industriestaat in den 1950er und 1960er Jahren und dessen Einfluss auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen. Der zunehmende Wohlstand und die Attraktivität der Städte führten zu einem starken Wachstum, insbesondere der Großstädte, aufgrund von Landflucht. Die Arbeit betont die enge Verflechtung von Stadtentwicklung, sozialem Wandel und Veränderungen der Wirtschaftsstruktur.
2. Die italienische Bevölkerungsstruktur im Wandel: Dieses Kapitel analysiert den enormen Bevölkerungszuwachs Italiens von 1901 bis in die Nachkriegszeit und den anschließenden Übergang zu einer stagnierenden Entwicklung. Es erklärt diesen Wandel durch Veränderungen im generativen Verhalten, insbesondere den Rückgang der Geburtenrate. Es werden regionale Disparitäten im demografischen Wandel, insbesondere das Nord-Süd-Gefälle, hervorgehoben und der Einfluss von Migration auf die Bevölkerungsentwicklung wird diskutiert. Der soziale Wandel wird im Zusammenhang mit der Verbesserung der sozialen Mobilität und dem Verlassen ländlicher Gebiete beschrieben. Es wird herausgestellt, dass die typische italienische Großfamilie durch die Kernfamilie ersetzt wurde.
3. Italien, der heterogene Raum: Dieses Kapitel beschreibt Italien als einen heterogenen Raum, der sich in Nord- und Mittelitalien sowie Süditalien (Mezzogiorno) gliedert. Die Unterschiede sind auf die späte Einigung Italiens und die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung der Regionen zurückzuführen. Es werden verschiedene Typen von Stadtregionen in Italien unterschieden, wobei die Unterschiede zwischen Nord-, Mittel- und Süditalien in Bezug auf Bevölkerungsdichte, Wirtschaftsstruktur und Stadtentwicklung hervorgehoben werden. Die Schwierigkeiten der süditalienischen Städte bei der Eingliederung in den Gesamtraum werden ebenfalls erläutert.
4. Das Wachstum der italienischen Städte: Das Kapitel analysiert das Wachstum italienischer Städte im Kontext der Industrialisierung und Landflucht. Der starke Bevölkerungszuwachs in den 1950er und 1960er Jahren wird mit dem Übergang zur industriellen Wirtschaft und dem daraus resultierenden Arbeitskräftebedarf in den Städten in Verbindung gebracht. Das Kapitel beschreibt auch den Rückgang der Migration in den 1980er und 1990er Jahren und den beginnenden Prozess der Suburbanisierung. Es wird der Bevölkerungsverlust der Großstädte und das Wachstum der umliegenden Gebiete diskutiert.
Schlüsselwörter
Italien, Stadtentwicklung, demographischer Wandel, sozialer Wandel, Landflucht, Industrialisierung, Migration, Suburbanisierung, regionale Disparitäten, Nord-Süd-Gefälle, Mezzogiorno, Stadtregionen, Bevölkerungsdynamik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wandel italienischer Städte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Wandel italienischer Städte seit Mitte des 20. Jahrhunderts im Kontext des sozialen und demografischen Wandels Italiens. Sie beleuchtet die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, Bevölkerungsdynamik und städtebaulicher Entwicklung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den demografischen Wandel Italiens und dessen Einfluss auf die Städte, den sozialen Wandel und seine Auswirkungen auf Migration und städtische Entwicklung, regionale Disparitäten in Italien und deren Manifestation in den Städten, das Wachstum italienischer Städte im Kontext der Industrialisierung und Landflucht sowie die Suburbanisierung als neuer Trend in der italienischen Stadtentwicklung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel über den Wandel der italienischen Bevölkerungsstruktur, die Heterogenität Italiens als Raum, das Wachstum italienischer Städte und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Themen.
Was wird im Kapitel "Die italienische Bevölkerungsstruktur im Wandel" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert den enormen Bevölkerungszuwachs Italiens bis in die Nachkriegszeit und den darauffolgenden Übergang zu einer stagnierenden Entwicklung. Es erklärt diesen Wandel durch Veränderungen im generativen Verhalten (Rückgang der Geburtenrate), regionale Disparitäten (Nord-Süd-Gefälle) und den Einfluss von Migration. Der soziale Wandel wird im Zusammenhang mit verbesserter sozialer Mobilität und der Landflucht beschrieben.
Was wird im Kapitel "Italien, der heterogene Raum" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Heterogenität Italiens (Nord-, Mittel- und Süditalien) aufgrund der späten Einigung und unterschiedlicher wirtschaftlicher Entwicklung. Es unterscheidet verschiedene Typen von Stadtregionen und hebt die Unterschiede zwischen den Regionen hinsichtlich Bevölkerungsdichte, Wirtschaftsstruktur und Stadtentwicklung hervor. Die Schwierigkeiten süditalienischer Städte werden ebenfalls thematisiert.
Was wird im Kapitel "Das Wachstum der italienischen Städte" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert das Wachstum italienischer Städte im Kontext der Industrialisierung und Landflucht. Der starke Bevölkerungszuwachs in den 1950er und 1960er Jahren wird mit dem Übergang zur industriellen Wirtschaft in Verbindung gebracht. Der Rückgang der Migration in den 1980er und 1990er Jahren und die beginnende Suburbanisierung werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Italien, Stadtentwicklung, demografischer Wandel, sozialer Wandel, Landflucht, Industrialisierung, Migration, Suburbanisierung, regionale Disparitäten, Nord-Süd-Gefälle, Mezzogiorno, Stadtregionen, Bevölkerungsdynamik.
Welche Zeitspanne wird in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den Wandel italienischer Städte seit Mitte des 20. Jahrhunderts.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind im bereitgestellten HTML-Code nicht explizit aufgeführt, lediglich ein Fazit wird erwähnt.) Die Arbeit betont die enge Verflechtung von Stadtentwicklung, sozialem Wandel und Veränderungen der Wirtschaftsstruktur.
- Arbeit zitieren
- Jasmin Tarhouni (Autor:in), 2006, Italienische Städte im sozialen und demographischen Wandel, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/68913