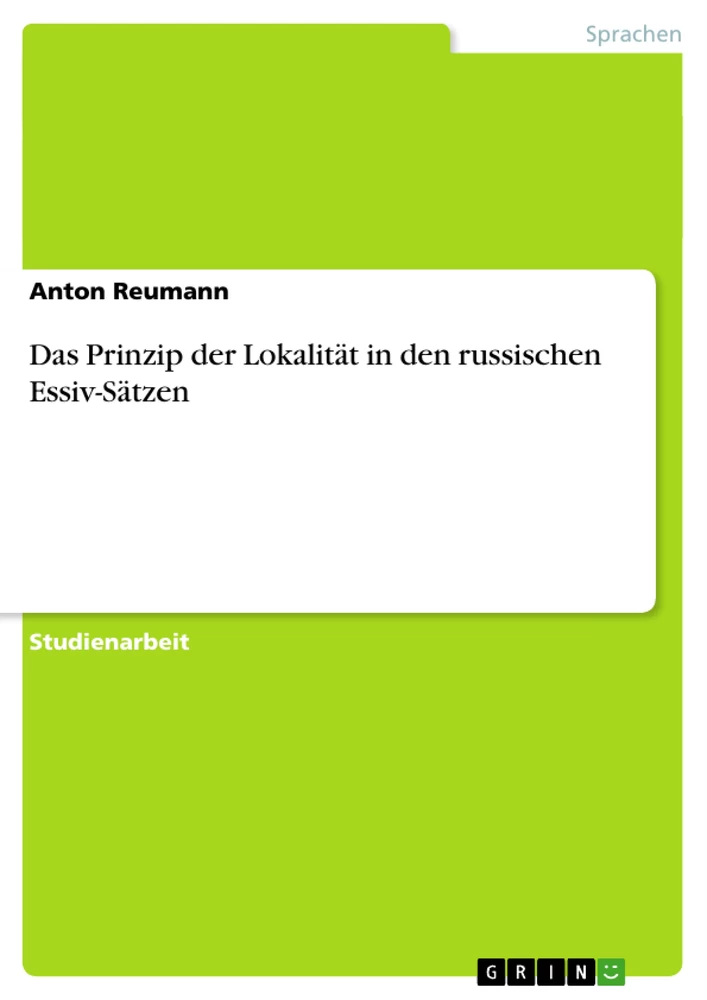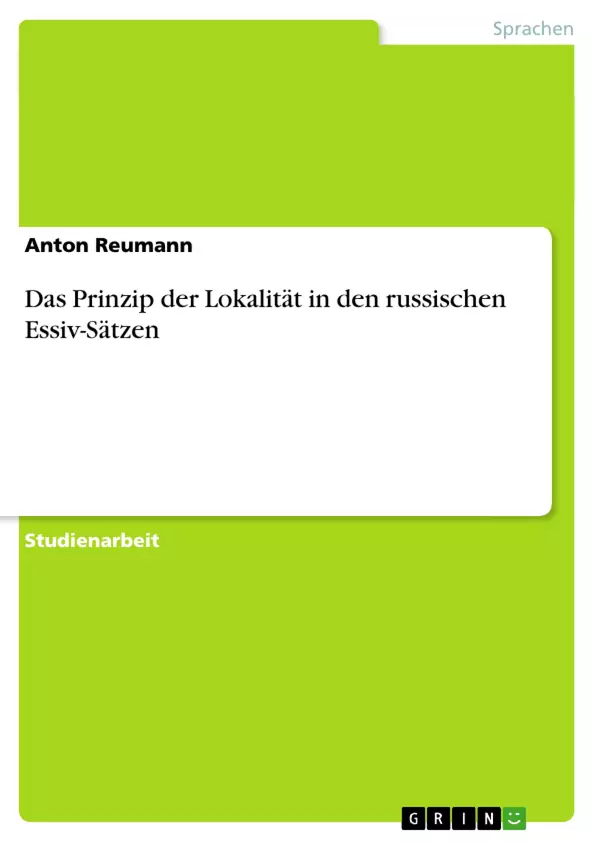Inhalt
0. Einleitung S. 3
1. Syntaktische Grundlagen und Begriffe S. 3
2. Die Untersuchungsmethode S. 4
3. Das Prinzip „Lokalität“ S. 5
Die Lokalisator – Stelle im Essiv – Satz S. 6
Das Essiv – Verb S. 8
Das Essiv – Objekt S. 12
Zusammenfassung S. 13
4. Fazit S. 14
5. Quellen S. 15
0. Einleitung
Die russische Sprache als be - Sprache hat ein besonderes Prinzip des Ausdrucks gedanklicher Konstruktionen beziehungsweise Zustände. Sowohl in der Literatur- als auch in der Alltagssprache treten Sätze mit Anzeichen für dieses Ausdrucksprinzip auf. Es ist das Prinzip der „Lokalität“ – etwas wird, als an/in einem Ort befindlich, zu einem Ort zugehörend, ausgedrückt. Es scheint so, als ob das nichts besonderes wäre, jedoch ist dieses „Lokalitätsprinzip“ das in der russischen Sprache mit am meisten gebräuchliche Ausdrucksprinzip und bildet somit ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber have – Sprachen . (Zum Beispiel: Er hat Gäste. [U nego gosti.})
So soll der Gegenstand dieser Arbeit dieses Phänomen der „Lokalisierung“, dessen Erscheinungsformen und dessen inhaltlicher Aspekt sein. Drücken Lokalitäten wirklich dieselben Verhältnisse aus, die in anderen Sprachen in weniger abstrakter Art ausgedrückt werden, oder liegt dem sprachlichen Ausdruck der Lokalität ein vollkommen anderes Welt – Konstrukt zugrunde? Die Fragewörter WAS und WIE bestimmen den Hauptteil der Arbeit, auf das WARUM soll im letzten Teil eingegangen werden. Jedoch sollen zuerst Begriffe und Grundlagen erörtert werden, mit denen in dieser Arbeit argumentiert werden soll, es soll geklärt werden, welcher Theorien sich hier bedient wird.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Syntaktische Grundlagen und Begriffe
- 2. Die Untersuchungsmethode
- 3. Das Prinzip „Lokalität“
- Die Lokalisator - Stelle im Essiv – Satz
- Das Essiv - Verb
- Das Essiv - Objekt
- Zusammenfassung
- 4. Fazit
- 5. Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Prinzip der „Lokalität“ in russischen Essiv-Sätzen, ein charakteristisches Merkmal der russischen Sprache, das sich von Sprachen mit einem Besitz-Paradigma unterscheidet. Sie untersucht, wie dieses Prinzip zur Darstellung von Verhältnissen und Konzepten beiträgt und ob es ein eigenes Weltbild widerspiegelt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, wie und wodurch diese Lokalität im Satz ausgedrückt wird.
- Analyse des „Lokalität“ – Prinzips in russischen Essiv – Sätzen
- Untersuchung der grammatischen Struktur und Funktionsweise von Essiv – Sätzen
- Vergleich mit Sprachen mit einem Besitz-Paradigma
- Bedeutung des „Lokalität“ – Prinzips für das Verständnis des russischen Weltbildes
- Erörterung der unterschiedlichen grammatischen und semantischen Aspekte von „Lokalität“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und beleuchtet das besondere Prinzip der „Lokalität“ in der russischen Sprache. Das erste Kapitel behandelt die syntaktischen Grundlagen und Begriffe, die für die Analyse der Essiv-Sätze relevant sind. Es wird auf unterschiedliche Satzdefinitionen, insbesondere die logisch-semantische Sichtweise, eingegangen und wichtige Begriffe wie Thema, Rhema, Subjekt und Prädikat erläutert. Das zweite Kapitel beschreibt die Untersuchungsmethode, die auf einem logisch-semantischen Ansatz basiert, der russische Sätze in drei Typen unterteilt: Essiv-Sätze, Identitätssätze und Prädikat-Sätze. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Essiv-Sätze.
Das dritte Kapitel erörtert das Prinzip der „Lokalität“ in russischen Essiv-Sätzen, seine Erscheinungsformen und seine inhaltliche Bedeutung. Es wird analysiert, wie das Thema und das Rhema in Essiv-Sätzen miteinander verbunden sind und wie das Prinzip der „Lokalität“ zur Ausdrucksweise in verschiedenen Bereichen der russischen Sprache beiträgt. Dazu werden Beispiele verwendet, die die Funktionsweise des Prinzips verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Russische Sprache, Essiv-Sätze, Lokalität, Satzstruktur, Syntax, Semantik, Thema, Rhema, Subjekt, Prädikat, Vergleichende Sprachwissenschaft, Weltbild, Sprachphilosophie, Logisch-semantischer Ansatz, Kommunikative Richtung, Psychologische Richtung.
- Arbeit zitieren
- Anton Reumann (Autor:in), 2004, Das Prinzip der Lokalität in den russischen Essiv-Sätzen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/68880