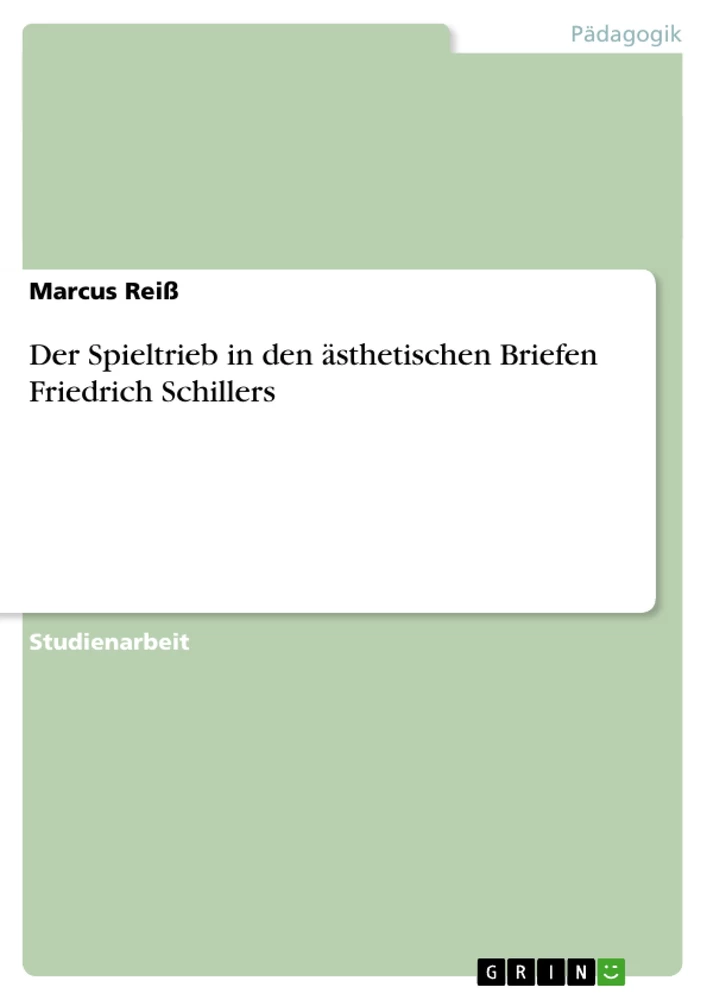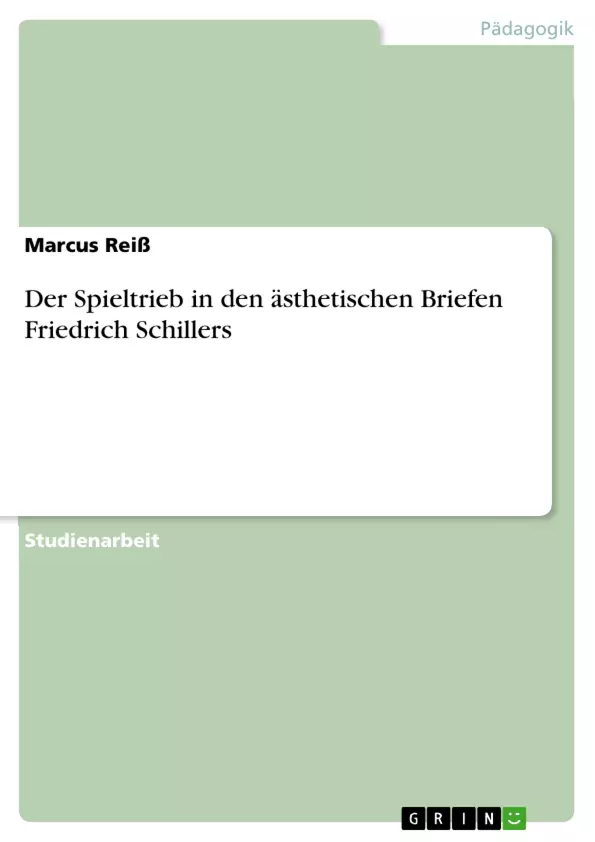Der Begriff des Spiels ist wohl jedem Menschen bekannt. Seit der frühesten Kindheit
wird mit Bällen oder anderen Materialien gespielt und selbst in fortgeschrittenem
Alter geht der Spass an spielerischen Aktivitäten keineswegs verloren. In allen
Kulturen haben Spiele ihren festen Platz in der Gesellschaft, so dass diesem global
vorhandenen Phänomen eminente Bedeutung zukommt.
Doch was genau ist denn charakteristisch für das Spiel? Aus den zahlreichen
Deutungen, die zu diesem Thema vorhanden sind, greife ich nun die Spieltheorie von
Friedrich Schiller heraus, die, formuliert in den Briefen „Über die ästhetische
Erziehung des Menschen“ , eingebettet in dessen Vorstellung des ästhetischen Staates
ist. Geht etwa damit einher, dass das Spiel ein ästhetisches Moment hat? Wenn ja,
wie kann dieses erklärt werden und welche Deutungen lassen sich daraus ableiten?
Aus diesen Fragestellungen heraus werde ich versuchen, die einzelnen
Gedankengänge Schillers in ihren wichtigsten Zügen darzustellen.
Zu Beginn ist es notwendig, das Gesellschaftsbild zu erläutern, auf das der Aufklärer
seine Deduktionen stützt. Ausgehend davon wird im Verlaufe der Arbeit zunächst
bestimmt, welches Menschenbild dem schillerschen Ideal entspricht, um das Ziel der
Abhandlung hinreichend erfassen zu können. Diesen Bestimmungen zufolge muss
dann eine Analyse der anthropologischen Grundlagen des Menschen erfolgen, aus
denen dann der eigentliche Spieltrieb hergeleitet wird.
An diesem Punkte bleibt Schiller aber nicht stehen. Ihm geht es zudem um eine
Erläuterung der Momente, die helfen das Spiel näher und eingehender zu
beschreiben. Fragen bezüglich einer möglichen Selbstbestimmung des Menschen im
Spiel werden an dieser Stelle erst zu klären sein.
Vor der Zusammenfassung der Hauptaussagen am Schluss dieser Arbeit werde ich
kurz das vorstellen, was Schiller unter dem „ Ideal“ versteht und wie sich dieses auf
eine mögliche Umsetzung der Spieltheorie in die Praxis beziehen lässt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Tendenzen der Aufklärung
- Die Kritik der Verhältnisse
- Wildheit
- Barbarei
- Das Ziel: Der „menschliche Charakter”
- Person und Zustand
- Die zwei Grundtriebe des Menschen
- Stofftrieb
- Formtrieb
- Wechselwirkung
- Das Spiel: Synthese
- ,,Lebende Gestalt”
- Der ästhetische Zustand
- Passive Bestimmbarkeit
- Aktive Bestimmbarkeit
- Das Ideal
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Friedrich Schillers Spieltheorie, die in seinen „Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen" dargelegt wird. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, inwiefern das Spiel ein ästhetisches Moment beinhaltet und wie dieses in Schillers Vorstellung des ästhetischen Staates eingebettet ist.
- Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse im Zeitalter der Aufklärung
- Erörterung des Menschenbildes, das Schillers Ideal entspricht
- Untersuchung der anthropologischen Grundlagen des Spieltriebs
- Erläuterung der Momente, die zur Beschreibung des Spiels beitragen
- Diskussion der Selbstbestimmung des Menschen im Spiel
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Begriff des Spiels vor und erläutert die Relevanz von Schillers Spieltheorie. Außerdem wird die Zielsetzung der Arbeit und die Vorgehensweise beschrieben.
- Das Kapitel „Tendenzen der Aufklärung" beleuchtet die gesellschaftlichen Entwicklungen im Zeitalter der Aufklärung, auf die sich Schiller bezieht. Insbesondere wird die Kritik an den Verhältnissen der Zeit, die Bedeutung der Kunst sowie die Utopie des „sittlichen Staates" behandelt.
- Das Kapitel „Person und Zustand" erläutert das Menschenbild, das dem schillerschen Ideal entspricht. Hierbei wird die Verbindung zwischen „Person" und „Zustand" hergestellt und der Fokus auf die Bedeutung der „freien Wahl" gelegt.
- Das Kapitel „Die zwei Grundtriebe des Menschen" analysiert Schillers Vorstellung von den „Stofftrieb" und dem „Formtrieb", die die menschlichen Bedürfnisse und Handlungen bestimmen. Die Wechselwirkung dieser beiden Triebe wird ebenfalls erläutert.
- Das Kapitel „Das Spiel: Synthese" geht auf Schillers Verständnis vom Spiel als Synthese der beiden Grundtriebe ein. Hierbei wird die Bedeutung des Spiels für die Selbstbestimmung des Menschen und die Entwicklung des „menschlichen Charakters" betont.
- Das Kapitel „‚Lebende Gestalt’" beschreibt Schillers Vorstellung von der „ästhetischen Gestalt" als Ausdruck der Harmonie zwischen den beiden Grundtrieben. Die Bedeutung der „ästhetischen Form" für die Bildung des Menschen und die Entwicklung der Gesellschaft wird hervorgehoben.
- Das Kapitel „Der ästhetische Zustand" behandelt Schillers Vorstellung von zwei Formen der Bestimmbarkeit: der passiven und der aktiven. Die „passive Bestimmbarkeit" beschreibt den Zustand der Unterordnung unter äußere Zwänge, während die „aktive Bestimmbarkeit" die Selbstbestimmung des Menschen durch die freie Wahl und den Einsatz des Verstandes betont.
Schlüsselwörter
Schillers Spieltheorie, Ästhetische Erziehung, Ästhetischer Staat, Spieltrieb, Stofftrieb, Formtrieb, Selbstbestimmung, Freiheit, Kunst, Vernunft, Aufklärung, Menschliches Ideal, Lebende Gestalt, Ästhetischer Zustand.
- Quote paper
- Marcus Reiß (Author), 2000, Der Spieltrieb in den ästhetischen Briefen Friedrich Schillers, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/6803