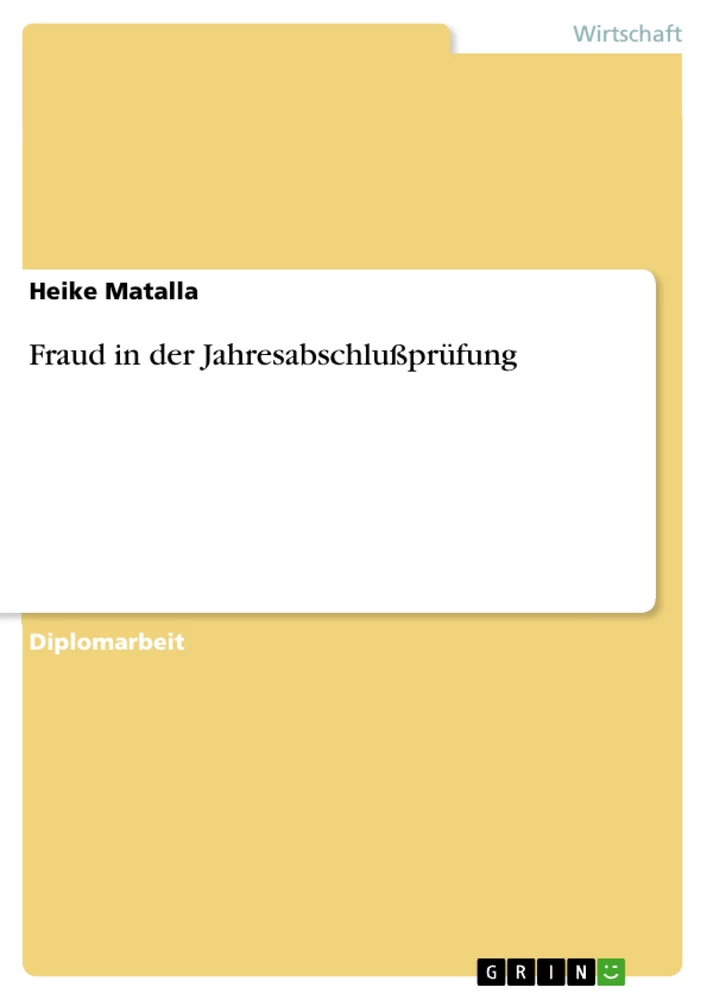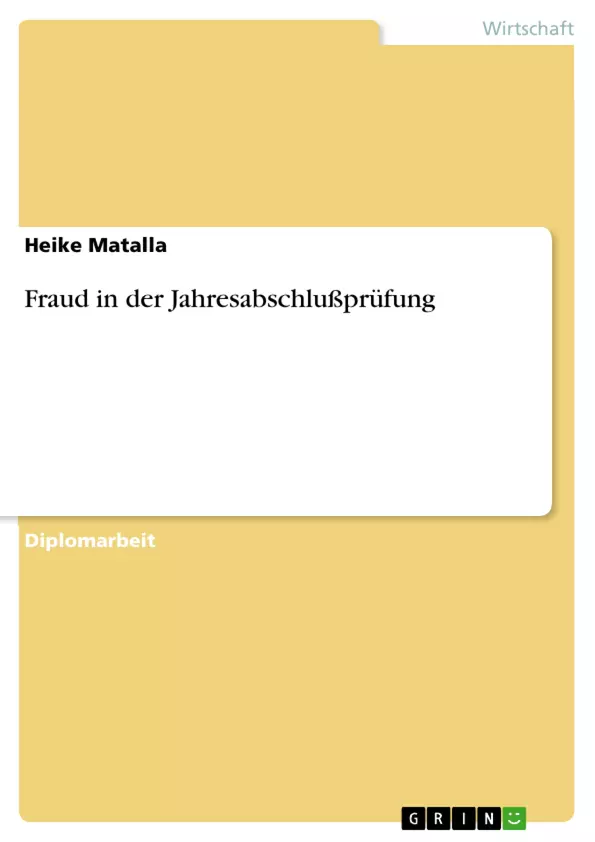Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Abschlußprüfung wurde durch spektakuläre Unternehmensschieflagen beeinträchtigt. Diese Erschütterung wurde national durch die Skandale um Balsam, Flowtex, Holzmann und Comroad wie auch international durch Unternehmen wie Enron oder Worldcom ausgelöst. Im Fall der Balsam AG beispielsweise wurden in den Jahren 1989 bis 1994 Banken, Geschäftspartner und die Öffentlichkeit aufgrund von betrügerischen Manipulationen und Bilanzfälschungen, die intelligent, dauerhaft und plausibel angelegt waren, um eine Milliarde Euro geschädigt. Durch den Verkauf von Luftforderungen an die Factoringfirma Procedo GmbH wollte der Vorstand der Balsam AG liquide Mittel beschaffen, ohne daß überhaupt eine Forderung entstanden war, was von dem beauftragten Abschlußprüfer nicht aufgedeckt wurde. Ebenso wurden durch die Flowtex Technologie GmbH & Co. KG umfangreiche Scheingeschäfte getätigt, die Anfang 2000 im Rahmen einer Steuerprüfung aufgedeckt wurden und einen Schaden von mehr als zwei Milliarden Euro verursachten. Die Phantomgeschäfte mit Bohrsystemen erreichten eine Größenordnung von 560.000 bis 820.000 Euro. Der Fall Enron kann in den USA als die bisher größte Unternehmensinsolvenz angesehen werden. Als zeitweise weltweit größter Energiehändler korrigierte das Unternehmen im Jahr 2001 die Gewinne rückwirkend für vier Jahre um minus 597 Millionen Dollar, da jahrelang Verbindlichkeiten bei Partnerfirmen versteckt wurden.
Diese Arbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, Fraud bzw. betrügerische Handlungen in der Bilanz zu untersuchen. Wie die oben genannten Beispiele demonstrieren, werden bei solchen Skandalen häufig sehr hohe Schadenssummen hervorgerufen, die mit Sicherheit auch in Zukunft auftreten werden. Insofern ist es erforderlich, sich mit der Aufdeckung von Bilanzmanipulationen auseinanderzusetzen und sich zu fragen, wie diese verbessert werden kann. Gerade im Hinblick auf die Erwartungen der Öffentlichkeit muß zu diesem Zweck analysiert werden, inwieweit Abschlußprüfer überhaupt zur Aufdeckung von Manipulationen verpflichtet sind und welche Hilfsmittel ihnen dazu zur Verfügung stehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Begriffsbestimmung
- 2.2 Zu beachtende Vorschriften und ihre Bindungswirkung für den deutschen Abschlußprüfer
- 2.2.1 Gesetzliche Vorschriften
- 2.2.2 Fachliche Verlautbarungen
- 2.2.3 Internationale Normen
- 2.3 Nationale und internationale Prüfungsgrundsätze zur Aufdeckung von Fraud
- 2.3.1 IDW PS 210
- 2.3.2 ISA 240 (n. F.)
- 2.3.3 SAS 99
- 2.4 Fraud-Triangle-Ansatz
- 2.4.1 Motiv
- 2.4.2 Möglichkeit
- 2.4.3 Rechtfertigung
- 3 Verantwortung des Abschlußprüfers zur Aufdeckung von Fraud
- 3.1 Gegenstand und Umfang der Abschlußprüfung
- 3.2 Unternehmensinterne Instrumente und ihre Verantwortlichkeit zur Verhinderung von Fraud
- 3.2.1 Vorstand
- 3.2.2 Aufsichtsrat
- 3.3 Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten nach IDW PS 210
- 3.4 Unterschiede in der Verantwortung und Prüfungsdurchführung nach ISA 240
- 3.4.1 Kritische Grundhaltung
- 3.4.2 Besprechungen im Prüfungsteam
- 3.4.3 Prüfungshandlungen zur Erkennung und Beurteilung von Risiken
- 3.4.4 Manipulierte Umsatzerlöse
- 3.4.5 Reaktionen auf die Risiken wesentlicher falscher Angaben aufgrund von Verstößen
- 3.5 Unterschiede in der Berücksichtigung von Fraud nach SAS 99
- 3.6 Zwischenergebnis
- 4 Risikoindikatoren als Hilfe zur Aufdeckung von Fraud
- 4.1 Vergleich der Risikofaktoren aus IDW PS 210, ISA 240 und SAS 99
- 4.2 Empirische Studien zur Eignung von Risikoindikatoren
- 4.2.1 Beurteilung von Risikofaktoren auf Basis von Checklisten
- 4.2.1.1 Überprüfung vorhandener Red Flags
- 4.2.1.2 Existenz von Risikoindikatoren in tatsächlichen Manipulationsfällen
- 4.2.1.3 Identifikation von Red Flags aus Sicht der SEC
- 4.2.1.4 Einfluß der Unternehmensgröße auf Risikoindikatoren
- 4.2.1.5 Rangfolge von Red Flags
- 4.2.1.6 Grenzen von Red Flag-Checklisten
- 4.2.2 Mathematisch-statistische Methoden zur Beurteilung des Fraud-Risikos
- 4.2.2.1 Statistische Logit-Modelle
- 4.2.2.2 Neuronale Netze
- 4.2.2.3 Methode des Maschinellen Lernens
- 4.3 Eignung von Risikofaktoren zur Aufdeckung von Fraud
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Verantwortung des Abschlussprüfers bei der Aufdeckung von Bilanzfälschungen (Fraud). Ziel ist es, die relevanten gesetzlichen Vorschriften, Prüfungsgrundsätze und empirischen Studien zu analysieren und die Eignung verschiedener Methoden zur Identifizierung von Fraud-Risiken zu bewerten.
- Verantwortung des Abschlussprüfers bei der Aufdeckung von Fraud
- Relevante nationale und internationale Prüfungsgrundsätze (IDW PS 210, ISA 240, SAS 99)
- Analyse von Risikoindikatoren und deren Eignung zur Fraud-Aufdeckung
- Bewertung verschiedener Methoden zur Risikobeurteilung (Checklisten, statistische Modelle)
- Vergleich der Ansätze und deren Grenzen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Bilanzprüfung und der Aufdeckung von Betrug ein. Es beschreibt die Problemstellung, nämlich die Herausforderungen für Wirtschaftsprüfer bei der Identifizierung von Bilanzfälschungen, und skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beinhaltet eine Begriffsbestimmung von "Fraud", eine detaillierte Betrachtung der relevanten gesetzlichen Vorschriften und Prüfungsgrundsätze (IDW PS 210, ISA 240, SAS 99) sowie eine Erläuterung des "Fraud-Triangle-Ansatzes" mit seinen drei Komponenten Motiv, Möglichkeit und Rechtfertigung. Die Kapitel beschreibt die jeweiligen nationalen und internationalen Normen und deren Bedeutung für die Praxis der Wirtschaftsprüfung.
3 Verantwortung des Abschlußprüfers zur Aufdeckung von Fraud: Dieses Kapitel analysiert die Verantwortung des Abschlussprüfers bei der Aufdeckung von Bilanzfälschungen. Es untersucht den Gegenstand und Umfang der Abschlussprüfung, die unternehmensinternen Kontrollmechanismen (Vorstand, Aufsichtsrat) und die konkreten Prüfungshandlungen zur Erkennung und Beurteilung von Risiken nach IDW PS 210, ISA 240 und SAS 99. Die Unterschiede in der Verantwortung und Prüfungsdurchführung nach den verschiedenen Standards werden detailliert beleuchtet. Besondere Aufmerksamkeit wird der kritischen Grundhaltung des Prüfers gewidmet.
4 Risikoindikatoren als Hilfe zur Aufdeckung von Fraud: In diesem Kapitel werden verschiedene Risikoindikatoren und Methoden zur Aufdeckung von Fraud untersucht. Es beinhaltet einen Vergleich der Risikofaktoren aus den verschiedenen Prüfungsgrundsätzen (IDW PS 210, ISA 240 und SAS 99) sowie die Auswertung empirischer Studien, die die Eignung von Checklisten und mathematisch-statistischen Methoden (Logit-Modelle, Neuronale Netze, Maschinelles Lernen) zur Beurteilung des Fraud-Risikos bewerten. Die Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Abschlussprüfung, Wirtschaftsprüfung, Fraud, Bilanzfälschung, IDW PS 210, ISA 240, SAS 99, Risikoindikatoren, Red Flags, Risikofaktoren, statistische Methoden, Logit-Modelle, Neuronale Netze, Maschinelles Lernen, Verantwortung des Prüfers, unternehmensinternes Kontrollsystem.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Verantwortung des Abschlussprüfers bei der Aufdeckung von Bilanzfälschungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Verantwortung des Abschlussprüfers bei der Aufdeckung von Bilanzfälschungen (Fraud). Sie analysiert relevante gesetzliche Vorschriften, Prüfungsgrundsätze und empirische Studien, um die Eignung verschiedener Methoden zur Identifizierung von Fraud-Risiken zu bewerten.
Welche Prüfungsgrundsätze werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Prüfungsgrundsätze IDW PS 210, ISA 240 und SAS 99, vergleicht diese und untersucht ihre Unterschiede bezüglich der Verantwortung des Abschlussprüfers bei der Aufdeckung von Fraud.
Welche Methoden zur Risikobeurteilung werden untersucht?
Die Arbeit bewertet verschiedene Methoden zur Risikobeurteilung, darunter Checklisten zur Identifizierung von "Red Flags" und mathematisch-statistische Methoden wie Logit-Modelle, Neuronale Netze und Methoden des Maschinellen Lernens.
Welche Rolle spielen Risikoindikatoren?
Die Arbeit analysiert verschiedene Risikoindikatoren und deren Eignung zur Aufdeckung von Fraud. Ein Vergleich der Risikofaktoren aus den verschiedenen Prüfungsgrundsätzen (IDW PS 210, ISA 240 und SAS 99) bildet einen Schwerpunkt. Es werden empirische Studien ausgewertet, die die Eignung von Checklisten und mathematisch-statistischen Methoden zur Beurteilung des Fraud-Risikos bewerten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Problemstellung und Gang der Untersuchung), Grundlagen (Begriffsbestimmung, Vorschriften, Prüfungsgrundsätze, Fraud-Triangle), Verantwortung des Abschlussprüfers (Gegenstand und Umfang der Prüfung, unternehmensinternen Instrumente, Vergleich der Standards), Risikoindikatoren (Vergleich der Risikofaktoren, empirische Studien, Bewertung verschiedener Methoden), und Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Abschlussprüfung, Wirtschaftsprüfung, Fraud, Bilanzfälschung, IDW PS 210, ISA 240, SAS 99, Risikoindikatoren, Red Flags, Risikofaktoren, statistische Methoden, Logit-Modelle, Neuronale Netze, Maschinelles Lernen, Verantwortung des Prüfers, unternehmensinternes Kontrollsystem.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Zielgruppe dieser Arbeit sind primär Personen, die sich mit Abschlussprüfungen, Wirtschaftsprüfung und der Aufdeckung von Bilanzfälschungen auseinandersetzen, wie z.B. Wirtschaftsprüfer, Studenten der Wirtschaftswissenschaften und Personen mit Interesse an Compliance und Risikomanagement.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet die Eignung der untersuchten Methoden zur Aufdeckung von Fraud. Es werden die Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze diskutiert und ggf. Empfehlungen für die Praxis gegeben (genaue Schlussfolgerungen müssen aus dem vollständigen Text entnommen werden).
- Quote paper
- Heike Matalla (Author), 2005, Fraud in der Jahresabschlußprüfung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/66702