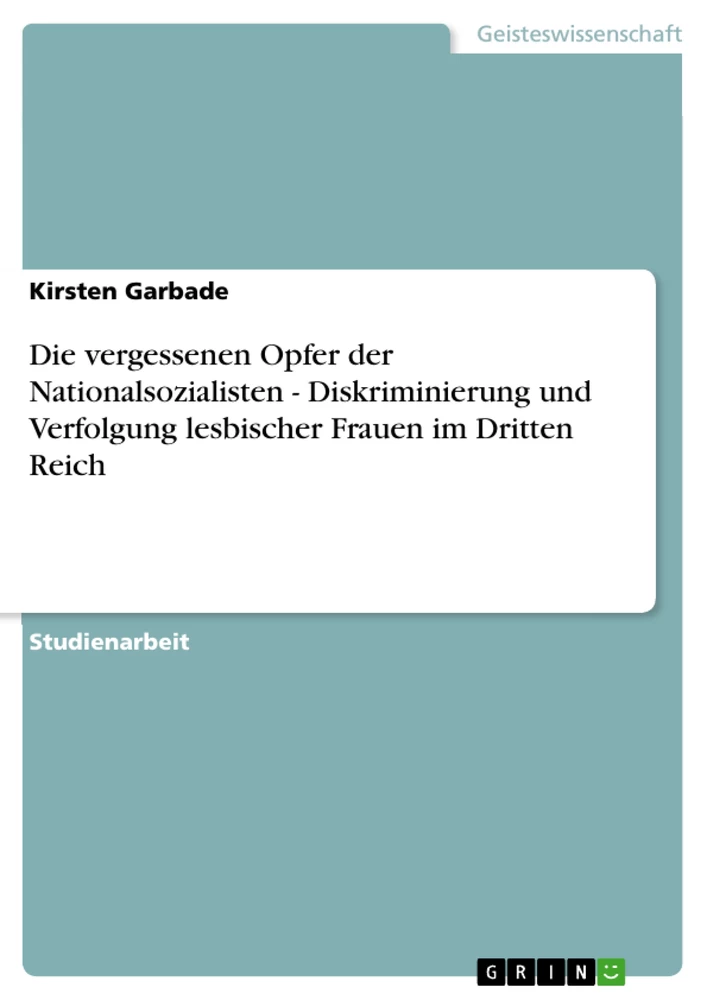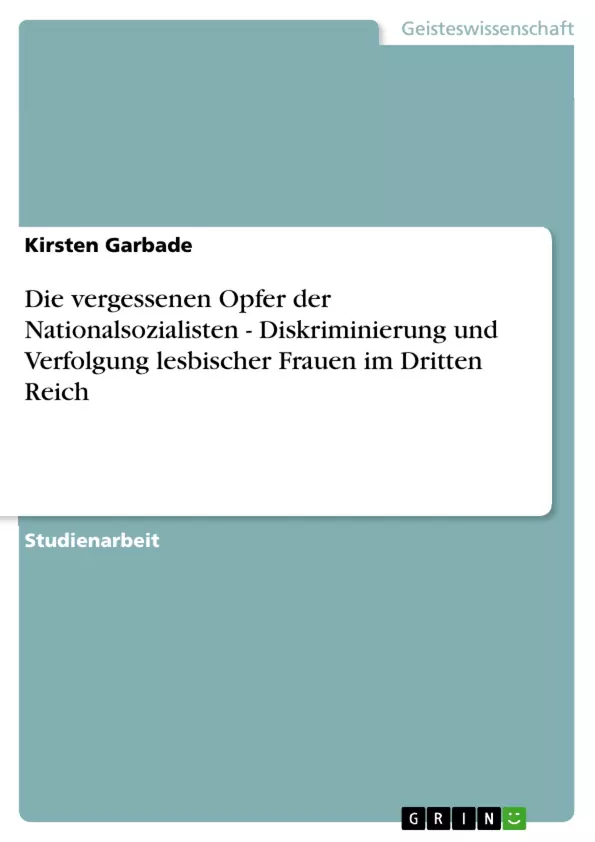Die Verachtung, Ausgrenzung und Verfolgung von Homosexuellen begann nicht etwa in der Zeit der NS-Diktatur in Deutschland, sondern zieht sich seit Jahrhunderten durch die Geschichte. Die gesellschaftliche Haltung gegenüber Homosexualität (der Begriff wurde nicht von Beginn an verwendet, sondern erst im Jahre 1869 in Deutschland geprägt 1 ) entsprach in den verschiedenen Epochen nicht immer der juristischen Sichtweise oder dem medizinischen beziehungsweise dem wissenschaftlichen Entwicklungsstand. Hingegen standen diese sich zeitweise gar konträr gegenüber.
Vehementer Gegner von Homosexualität war schon früh die christliche Kirche, da gleichgeschlechtliche Liebe ihrer Auffassung nach gegen die Gesetze Gottes und der Natur verstoße. Bereits im 4. Jahrhundert wurde in den meisten christlichen Staaten gleichgeschlechtliche Liebe zwischen männlichen Personen, häufig aber auch die zwischen Frauen, mit Todesstrafe geahndet. 2
Zur Zeit der Reformation und der Gegenreformation fand sich in deutschen Landen eine weitreichende Verdrängung des Themas Homosexualität, die auch in den Kreisen der christlichen Kirche vorkam. Im 16. Jahrhundert kam es schließlich zu einer Welle der Kriminalisierung, die sich unter anderem in Artikel 116 der Peinlichen Gerichtsordnung 3 Kaiser Karls V. von 1532, der so genannten Carolina, widerspiegelte. 4 Dieser ist zu entnehmen:
„So ein Mensch mit einem Vieh, Mann mit Mann, Weib mit Weib, Unkeusch treibet, die haben das Leben verwirkt, und man soll sie der gemeinen Gewohnheit nach mit dem Feuer vom Leben zum dem Tode richten.“ 5
Formell blieb die Carolina in ihrer ursprünglichen Form zwar bis zur Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 bestehen, jedoch entwickelten die Territorialstaaten im Laufe des 18. Jahrhunderts eigenständige Strafrechte. Somit kam es zur Zeit der Aufklärung unter dem Einfluss des napoleonischen Rechts zum ersten Mal zur Entkriminalisierung gleichgeschlechtlicher Handlungen, indem einige deutsche Staaten das Strafmaß für Homosexualität einschränkten oder es gar aufhoben. 6
Im Zeitalter der Aufklärung wurde zum ersten Mal wieder öffentlich über gleichgeschlechtliche Liebe diskutiert. Obwohl sie ihr gegenüber kein Verständnis zeigten, versuchten die Vertreter der Aufklärung das Phänomen des Schwulseins mit reiner Vernunft zu erklären. Hingegen bezeichneten Juristen Homosexualität als unvernünftig, da sie nicht der Fortpflanzung diente. [....]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die vergessene Opfergruppe des nationalsozialistischen Terrorregimes
- Diskriminierung lesbischer Frauen
- Praxis der Verfolgung lesbischer Frauen
- Diskurs zur Kriminalisierung weiblicher Homosexualität
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Diskriminierung und Verfolgung lesbischer Frauen im Dritten Reich. Sie beleuchtet eine vergessene Opfergruppe des nationalsozialistischen Terrorregimes und untersucht die spezifischen Herausforderungen, denen lesbische Frauen in dieser Zeit ausgesetzt waren. Die Arbeit zeichnet die historische Entwicklung der Kriminalisierung von Homosexualität in Deutschland nach und analysiert den Einfluss des Paragraphen 175 des Reichsstrafgesetzbuches auf das Leben lesbischer Frauen im Nationalsozialismus.
- Die vergessene Opfergruppe lesbischer Frauen im Nationalsozialismus
- Diskriminierungsformen und Verfolgungsmethoden gegenüber lesbischen Frauen
- Der Einfluss des Paragraphen 175 auf die Lebensrealität lesbischer Frauen
- Der Diskurs um die Kriminalisierung weiblicher Homosexualität im Dritten Reich
- Die gesellschaftlichen und rechtlichen Folgen der Verfolgung von Homosexualität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung gibt einen Überblick über die historische Entwicklung der Verfolgung von Homosexualität in Deutschland und beleuchtet die Diskriminierung lesbischer Frauen in verschiedenen Epochen.
- Die vergessene Opfergruppe des nationalsozialistischen Terrorregimes: Dieses Kapitel stellt die Verfolgung lesbischer Frauen im Dritten Reich in den Kontext der allgemeinen Verfolgung von Homosexuellen und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, denen lesbische Frauen ausgesetzt waren.
- Diskriminierung lesbischer Frauen: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Formen der Diskriminierung, die lesbische Frauen im Dritten Reich erlebten, von gesellschaftlicher Ausgrenzung bis hin zu rechtlicher Verfolgung.
- Praxis der Verfolgung lesbischer Frauen: Dieses Kapitel beschreibt die konkreten Methoden, die zur Verfolgung lesbischer Frauen eingesetzt wurden, von Denunziation über Inhaftierung bis hin zur Zwangssterilisation.
- Diskurs zur Kriminalisierung weiblicher Homosexualität: Dieses Kapitel analysiert die Debatten und Diskurse um die Kriminalisierung weiblicher Homosexualität im Dritten Reich und untersucht die zugrundeliegenden Ideologien und Motive.
Schlüsselwörter
Lesbische Frauen, Homosexualität, Nationalsozialismus, Diskriminierung, Verfolgung, Paragraph 175, Strafrecht, Geschichte, Geschlecht, Identität, gesellschaftliche Normen, Terrorregime, Opfergruppe, Lebensrealität, Widerstand, Erinnerungskultur.
- Quote paper
- Kirsten Garbade (Author), 2005, Die vergessenen Opfer der Nationalsozialisten - Diskriminierung und Verfolgung lesbischer Frauen im Dritten Reich, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/66579