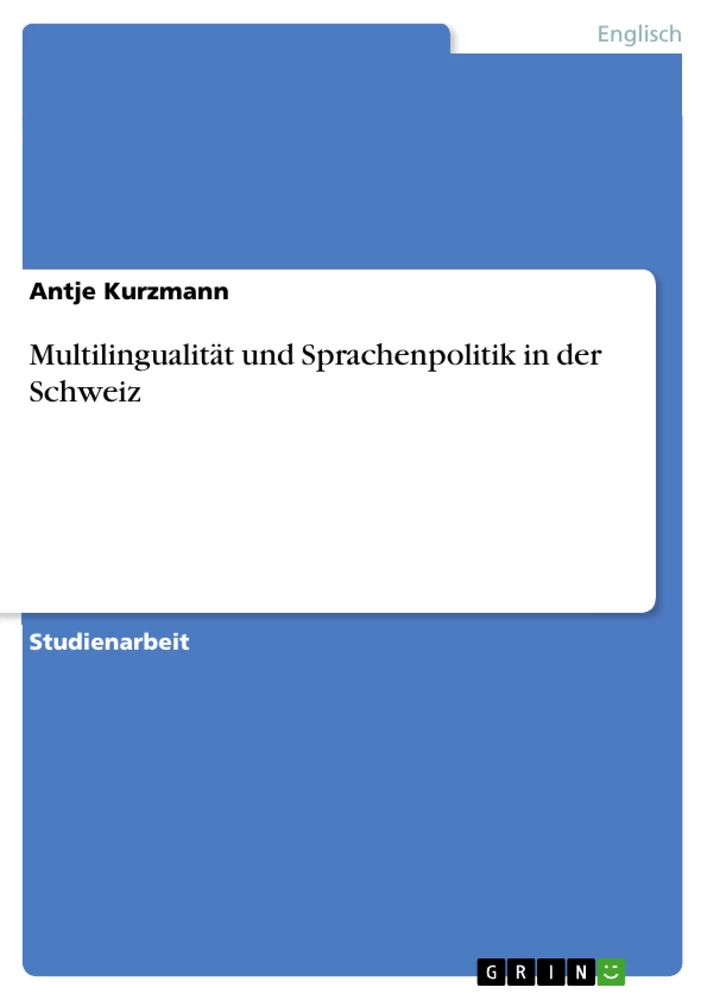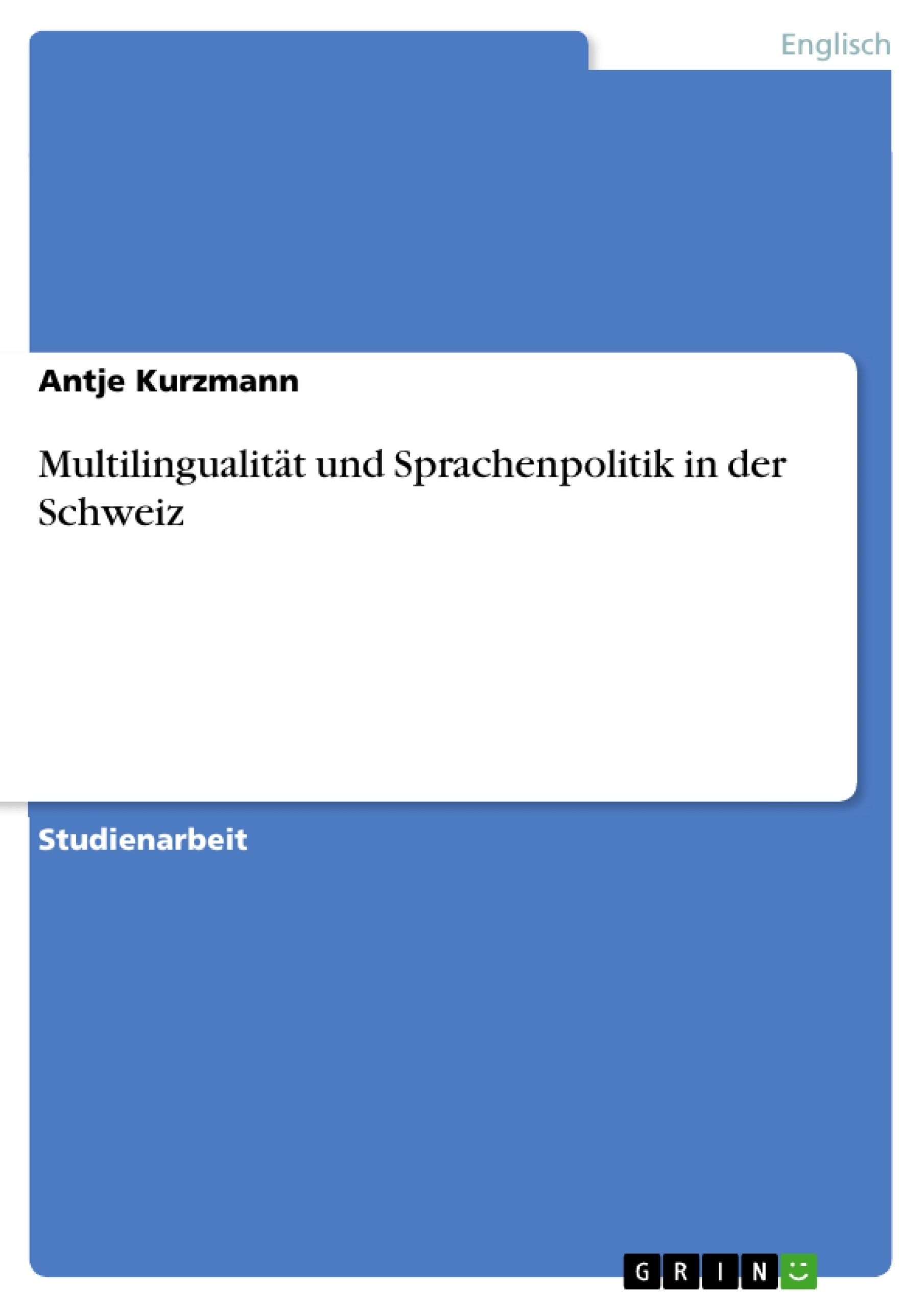Der Tagesspiegel titelte am 1. Mai 2005:
„Der Turmbau zu Brüssel – Das neue Euroland spricht in 20 Sprachen. Oder wird Englisch zur heimlichen Amtssprache? Zwischenbilanz nach einem Jahr Erweiterung“ (Fetscher 2005, 25).
Europa wird immer größer und damit immer vielfältiger, sowohl aus kultureller wie auch aus sprachlicher Perspektive. Mittlerweile umfasst die Europäische Union 25 Länder und besitzt damit 20 Amtssprachen (vgl. ebd.). Ganz aktuell ist die Diskussion der europäischen Bildung mit den dazugehörigen Schlagwörtern der Multilingualität und Multikulturalität. Ist es Ziel eine Sprache für alle BürgerInnen Europas festzulegen oder soll jedes Land seine Sprache(n) beibehalten? Die sprachlich-kulturelle Pluralität stellt die Obersten Europas vor ein Problem. Niemand will, dass „seine“ Sprache wegrationalisiert wird und trotzdem wollen sich alle irgendwie verständigen. Bildung und Erziehung in einem Europa, das schon jetzt sehr stark von Migration und dazugehöriger Mobilität geprägt ist und es auch in Zukunft noch sein wird, sollte und ist teilweise schon fokussiert auf kulturelle und sprachliche Vielfalt. Das zusammenwachsende Europa steht vor der Aufgabe jedem Land und jeder Sprache gerecht zu werden. Eine Aufgabe, mit der sich die Schweiz schon lange auseinandersetzt. Die Schweiz ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ein relativ kleines Land, doch es besitzt „viel“ Sprache oder genauer gesagt Sprachpotential. „Formal, historisch und politisch [ist die Schweiz] vier-, jedoch infolge verschiedener Einwanderungswellen vielsprachig.“ (Allemann-Ghionda 1994a, 11). Wie die Schweiz sich der Aufgabe einer mehrsprachigen Bildung in einem vielsprachigen Land stellt, soll in dieser Arbeit veranschaulicht werden. Außerdem wird die Theorie der Realität gegenübergestellt. Zeigt die Praxis, was in Gesetzen verlangt wird? Wer hält sich an die Grundsätze und wie werden sie umgesetzt? Es erfolgt zuerst ein Überblick über die Sprachen der Schweiz, gefolgt von der Erläuterung der aktuellen Sprachenpolitik. Dann widmet sich die Arbeit der Vorschulbildung und Sprache(n) in der Schule. Im Anschluss wird der Mythos des polyglotten Schweizers der Realität gegenübergestellt. Um in der Praxis zu verbleiben, werden an dieser Stelle einige Besonderheiten der Schweiz aufgezeigt. Zum Abschluss der Arbeit wird ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachen in der Schweiz
- Geschichtliche Entwicklung
- Gegenwärtige Sprachenverteilung
- Das Deutsche und das Rätoromanische
- Sprache(n) und Politik
- Definition des Begriffes Sprach(en)politik
- Zuständigkeiten in der Schweiz
- Sprachregelungen der Schweiz
- Sprachenfreiheit
- Territorialitätsprinzip
- Allgemeines zu den Sprachen in der Bundesverfassung
- Vorschulbildung und Sprache(n) in der Schule
- Vorschulbildung
- Sprache(n) in der Schule
- Einführung von Fremdsprachen
- Mehrsprachigkeit - Der Mythos vom multilingualen Schweizer
- Eigenheiten der Schweiz
- Der Röstigraben
- Der Polentagraben
- Immersionsunterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der sprachlichen Situation und der Sprachenpolitik der Schweiz. Ziel ist es, die Herausforderungen der Mehrsprachigkeit in einem kleinen Land mit einer vielfältigen Sprachlandschaft zu beleuchten und aufzuzeigen, wie die Schweiz die Aufgabe einer mehrsprachigen Bildung meistert. Dabei wird die Theorie der Realität gegenübergestellt und analysiert, ob die Praxis den in Gesetzen festgelegten Grundsätzen entspricht.
- Historische Entwicklung der Sprachen in der Schweiz
- Gegenwärtige Sprachenverteilung und -entwicklung
- Sprachpolitik und -regelungen in der Schweiz
- Mehrsprachigkeit in der Vorschulbildung und Schule
- Eigenheiten der Schweizer Sprachenlandschaft und Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung thematisiert die wachsende sprachliche und kulturelle Vielfalt in Europa und beleuchtet die Herausforderungen der europäischen Bildung im Kontext der Multilingualität und Multikulturalität. Sie führt den Leser an das Thema der Arbeit heran und stellt die Schweiz als ein Beispiel für ein mehrsprachiges Land vor.
- Sprachen in der Schweiz: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die historische Entwicklung der Sprachen in der Schweiz, von der einst einsprachigen Situation bis zur Anerkennung des Rätoromanischen als Nationalsprache. Es stellt die aktuelle Sprachenverteilung und die Entwicklung der Nichtlandessprachen dar und erläutert die Bedeutung des Deutschen und des Rätoromanischen.
- Sprache(n) und Politik: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Sprach(en)politik der Schweiz. Er definiert den Begriff, erläutert die Zuständigkeiten in der Schweiz und analysiert die Sprachregelungen, insbesondere die Sprachenfreiheit, das Territorialitätsprinzip und die allgemeinen Bestimmungen in der Bundesverfassung.
- Vorschulbildung und Sprache(n) in der Schule: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Sprache(n) in der Vorschulbildung und im Schulsystem der Schweiz. Es beleuchtet die Sprachförderung in der Schule und die Einführung von Fremdsprachen.
- Mehrsprachigkeit - Der Mythos vom multilingualen Schweizer: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Mythos des polyglotten Schweizers und stellt ihn der Realität gegenüber. Es untersucht, inwiefern die Schweizer Bevölkerung tatsächlich mehrsprachig ist und welche Herausforderungen die Mehrsprachigkeit in der Praxis mit sich bringt.
- Eigenheiten der Schweiz: Dieser Abschnitt zeigt einige Besonderheiten der Schweizer Sprachenlandschaft und des Bildungssystems auf. Er beleuchtet den "Röstigraben", den "Polentagraben" und den Immersionsunterricht als Beispiele für die Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit in der Schweiz.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Multilingualität, Sprachenpolitik, Schweiz, Bildung, Mehrsprachigkeit, Sprachentwicklung, Sprachverteilung, Rätoromanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Sprachenfreiheit, Territorialitätsprinzip, Bundesverfassung, Vorschulbildung, Schule, Immersionsunterricht, Röstigraben, Polentagraben.
- Quote paper
- Antje Kurzmann (Author), 2005, Multilingualität und Sprachenpolitik in der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/66310