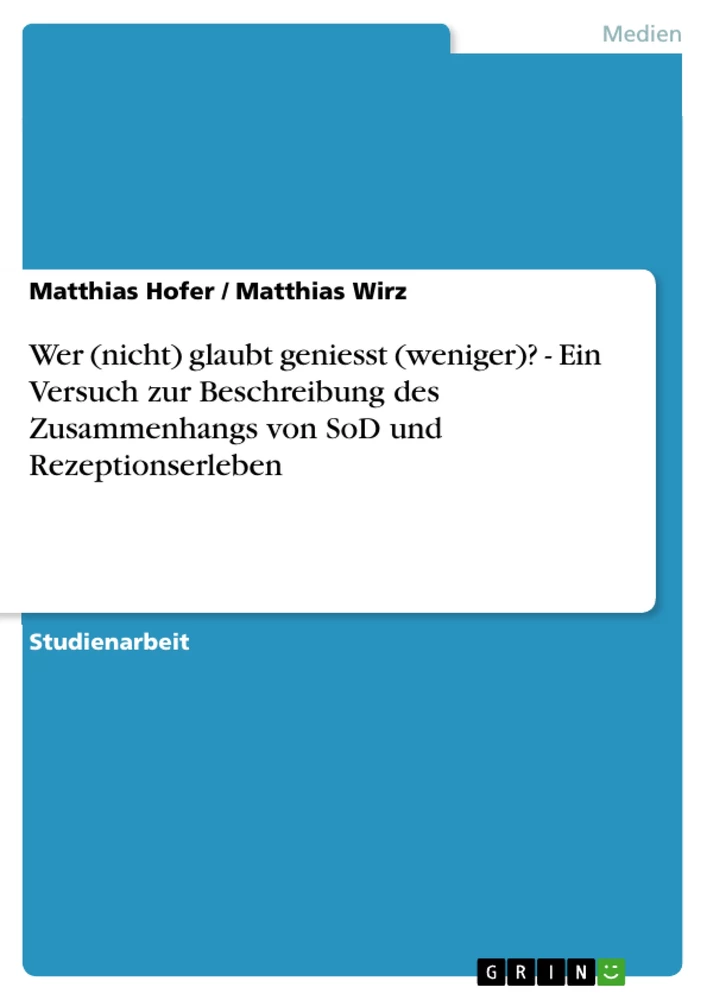The Willing Suspension of Disbelief (nachfolgend stets SoD genannt) ist ein Konzept, welches schon früh Eingang in den Sprachgebrauch der Geisteswissenschaften fand - und neuerdings auch in den der Neuropsychologie und der empirischen Publizistikwissenschaft (vgl. Coleridge 1817; Holland 1967; Holland 2002; Böcking/Wirth 2005; Böcking/Wirth/Risch 2005). So haben Theater- und Literaturwissenschaftler sich immer wieder - implizit oder explizit - auf diesen Begriff berufen (vgl. Böcking/Wirth 2005: 3). Grundsätzlich meint man mit SoD die Tatsache, dass ein fiktionaler narrativer Medieninhalt - sei es die Geschichte in einem Roman, eine Theateraufführung oder ein Actionfilm - oftmals von Ereignissen oder Personen erzählt, die sich so in der „Realität“ 1 nicht zutragen können. In „Crouching Tiger Hidden Dragon“ können die Protagonisten, scheinbar schwerelos, ihre Kämpfe in der Luft ausfechten - eine Fähigkeit, die jeder vernünftige Mensch keinem auch noch so begabten Schwertkämpfer zusprechen würde. Um einen solchen Film trotzdem geniessen zu können, indem man die Inhalte nicht ständig auf ihre Übereinstimmung mit der Realität prüft, muss ein Rezipient eine gewisse Toleranz gegenüber dem Gezeigten aufbringen, in dem Sinne, dass er inkonsistente Ereignisse oder logische Brüche im Plot nicht ständig hinterfragt, sein Nicht-Glauben also ausblendet. Neben den unrealistischen Inhalten gibt es aber auch noch andere SoD-auslösende Faktoren. Inhaltliche und logische Brüche in der Handlung oder unverständliche Handlungen können ebenfalls dazu führen, sein Disbelief zu suspendieren. Es scheint also ein wichtiger Bestandteil der Rezeption von narrativen fiktionalen Medieninhalten zu sein, sein Nicht-Glauben in den Hintergrund treten zu lassen, sich auf den Inhalt einzulassen, um sich selbst den Filmgenuss nicht zu verderben. Böcking/Wirth/Risch (2005: 40) halten fest, dass sich zwar verschiedene Autoren des Begriffs bedient haben, dass aber „bislang ein einheitliches Verständnis von Willing Suspension of Disbelief, das auch für eine empirische Untersuchung dieses Phänomens fruchtbar gemacht werden könnte“, fehlt (Hervorheb. i.O.). Verschiedene Faktoren können nun einen Einfluss haben, ob und in welchem Masse der Rezipient 2 bereit ist, sich auf den fiktionalen narrativen Inhalt einzulassen und somit SoD als Verarbeitungsmodus anzuwenden oder nicht. Als auslösender Faktor spielen die oben genannten Inkonsistenzen beim Medieninhalt eine wichtige Rolle. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- SoD: Wesen - Einflussfaktoren - Wirkungen
- Was ist eigentlich SoD? Herkunft und Geschichte des Begriffs
- Perceived Reality - ein mehrdimensionales Phänomen
- Rezeptionserleben
- Unterhaltung als Makroemotion
- Enjoyment – the core of Media Entertainment.
- Spatial Presence
- Zusammenfassung und Ausblick auf die Empirie
- Forschungsfragen
- Methode und Design
- Experimentaldesign und Stimulusauswahl.
- Fragebogenaufbau und Messung der Variablen
- Unabhängige und abhängige Variablen
- Die unabhängige Variable
- Enjoyment - Operationalisierung
- Enjoyment - Indices
- Spatial Presence – Operationalisierung und Indexbildung
- Auswahlverfahren der Versuchspersonen
- Ablauf und Durchführung der Studie.
- Ergebnisse
- Vorbereitende Datenanalyse.
- Vertiefte Auswertung.
- Schlussfolgerungen
- Interpretation der Ergebnisse und Diskussion.
- Methodenkritik und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen dem Willing Suspension of Disbelief (SoD) und dem Rezeptionserleben. Das Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen von SoD auf verschiedene Aspekte des Rezeptionserlebens, wie z.B. Unterhaltung, Enjoyment und räumliche Präsenz, zu untersuchen. Hierzu wird ein Experiment durchgeführt, bei dem den Versuchspersonen unterschiedlich inkonsistentes Filmmaterial gezeigt wird, um die Auswirkungen von SoD auf die Rezeption des Filmes zu erforschen.
- Das Konzept des Willing Suspension of Disbelief (SoD)
- Einflussfaktoren für SoD auf Medien- und Rezipientenseite
- Das Rezeptionserleben als mehrdimensionales Phänomen
- Zusammenhang zwischen SoD und Rezeptionserleben
- Empirische Untersuchung der Auswirkungen von SoD auf das Rezeptionserleben
Zusammenfassung der Kapitel
In Kapitel 2 wird das Konzept des Willing Suspension of Disbelief (SoD) genauer beleuchtet. Es werden die verschiedenen Faktoren, die SoD beeinflussen können, sowohl auf Seiten des Mediums als auch auf Seiten des Rezipienten, dargestellt. Im Fokus stehen die Einflussfaktoren wie Perceived Reality, Inkonsistenzen im Plot, die Erwartungen des Rezipienten und die verschiedenen Rezeptionsstrategien, die der Rezipient anwenden kann. Kapitel 3 definiert die Forschungsfragen der Arbeit, welche den Zusammenhang zwischen SoD und verschiedenen Aspekten des Rezeptionserlebens, wie z.B. Unterhaltung, Enjoyment und räumliche Präsenz, untersuchen sollen. Kapitel 4 erläutert das Design und die Methode des durchgeführten Experiments. Hier werden die verwendeten Stimuli, die Konstruktion des Fragebogens und die Operationalisierung der verschiedenen Variablen, wie z.B. SoD, Enjoyment und räumliche Präsenz, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe der Arbeit sind Willing Suspension of Disbelief (SoD), Perceived Reality, Rezeptionserleben, Unterhaltung, Enjoyment, Spatial Presence, Experimentaldesign, Filmrezeption, Inkonsistenz, Rezeptionsstrategien, Medienwirkung und Medienforschung.
- Quote paper
- Matthias Hofer (Author), Matthias Wirz (Author), 2005, Wer (nicht) glaubt geniesst (weniger)? - Ein Versuch zur Beschreibung des Zusammenhangs von SoD und Rezeptionserleben, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/66079